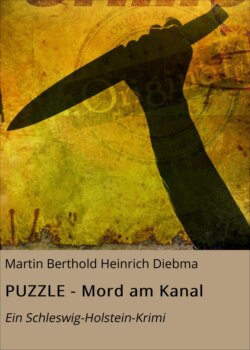Читать книгу PUZZLE - Mord am Kanal - Martin Berthold Heinrich Diebma - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Freya
ОглавлениеEs war mitten in der Nacht, und Tim stapfte schon wieder mit Cano durch den Wald, in dem sie den skelettierten Arm gefunden hatten. Da mussten doch noch mehr Teile zu finden sein. »Such!«, befahl er seinem Hund. »Such! Such!« Aber Cano stellte sich nur provozierend vor ihm hin und bellte ihn an wie einen Unbekannten oder wie jemanden, der ihm etwas schuldig ist. Irgendetwas nahm er ihm anscheinend furchtbar übel. Nur was? Hatte er denn etwas Unrechtes getan? Aber ja: Er hatte Cano noch nicht für die vorenthaltenen Knochen entschädigt. Wütend fletschte Cano die Zähne, immer aggressiver wurde sein Gebell, als wollte er seinen Herrn, den er kaum noch zu respektieren schien, im nächsten Augenblick anfallen. Du meine Güte, dachte Tim, hoffentlich finde ich noch den Kopf, den muss ich ihm schon geben, damit er wieder Ruhe gibt. Erschrocken, unsicher wich er zurück, stolperte über einen am Boden liegenden Ast und bemerkte erst beim Aufstehen, als er sich nach dem Grund für seinen Sturz umsah, die wahre Ursache für Canos Aufregung. Der Ast, über den er gestolpert zu sein glaubte, war kein Ast, es war ein gewaltiger Knochen wie von einem menschlichen Oberschenkel. Jetzt sah er aus dem Dunkel weitere Skelett-Teile vor seinen entsetzten Augen auftauchen: Ein Bein lag links, rechts noch ein Arm, Rippen weiter hinten, Wirbelknochen ... Nur der Kopf fehlte. Wo war nur der Kopf? Unter Tims Füßen begann plötzlich die Erde zu beben. Oder bildete er sich das nur ein? Nein, auch die Knochen vibrierten, bewegten sich, fingen an zu tanzen. Panik ergriff Tim. Er wollte nur noch weg. Als er den ersten Schritt tat, stellte er mit Entsetzen fest, dass es nicht die Erde war, die sich bewegt hatte, sondern der Oberschenkelknochen des Skeletts, das sich nicht erheben konnte, solange er darauf herumstand. Die Skelett-Teile waren nämlich alle dabei, sich zu sammeln und in der richtigen Ordnung wieder zusammenzufügen. Tim sah, wie einzelne mit einem schlürfenden Geräusch Fleisch ansetzten, blutiges, rotes Fleisch. Ein ekelerregender Anblick. Bei alledem machte das Skelett eine höchst bemitleidenswerte Figur. Es war eine arme, geschundene Kreatur oder, besser gesagt, Ex-Kreatur. Natürlich war Tim inzwischen längst klar, dass er sich in einem widerlichen Alptraum befinden musste, aber wie daraus entkommen? Nun vernahm er auch noch eine gehauchte weibliche Geisterstimme, die sagte: »Der Kopf! Gib mir meinen Kopf!« Erst jetzt bemerkte Tim, woher die Stimme kam: Er hielt einen Totenkopf an der Schädeldecke mit zwei Fingern in den Augenhöhlen fest wie eine Bowlingkugel, während der Unterkiefer auf- und niederklappte und wiederholte: »Der Kopf! Gib mir meinen Kopf!« Von Grauen geschüttelt, schleuderte Tim den Schädel so weit er konnte von sich fort. Doch Cano spurtete sofort hinterher, um ihn sich zu schnappen. »Du steckst tief in der Scheiße«, hörte Tim eine andere Stimme sagen. Dann wandte er sich ab und trat mit dem nächsten Schritt durch die alte, überraschenderweise nicht verriegelte Dielentür seines Bauernhofs, hinter der ihn Cano bereits mit wedelndem Schwanz erwartete, den Schädel im Maul. »Pfui! Pfui!«, schrie Tim außer sich vor Verzweiflung und erwachte endlich. Er war schweißnass.
Tim gehörte eigentlich nicht zu den zart Besaiteten, aber die Ereignisse des abgelaufenen Tages hätten wahrscheinlich auch bei noch härteren Gemütern als dem seinen im seelischen Grenzbereich zwischen Bewusstem und Unterbewusstem ein Auslassventil in Gestalt nächtlicher Spukgeschichten gefunden. Daran, dass ihm dieser Alptraum einen gewaltigen Schrecken eingejagt hatte, der erst mal verdaut sein wollte, änderte diese Erkenntnis nichts. »Pfui! Pfui!«, sprach Tim noch einmal leise zu sich selbst. Er vergewisserte sich, dass weder links noch rechts von seinem Bett irgendwelche Skelett-Teile herumlagen, noch Cano, der neben seinem Bett zu nächtigen pflegte und ihn nun wegen der zusammenhanglosen Pfuis verstört aus müden Augen ansah, einen Kopf im Maul hatte, und machte bis zum Morgengrauen kein Auge mehr zu.
◊
Dr. med. Freya Meisenberg musste nach Meinung ihrer männlichen Kollegen jeden Morgen ein beachtliches Maß an Zeit aufwenden, um ihr langes, mittelblondes Haar zu jenem Zopf von besonderer Perfektion zusammenzuflechten, der jeden von ihnen neugierig darauf machte, wie sie mit offenem Haar aussehen mochte. Nie hatte einer die begabte junge Orthopädin anders gesehen als eben mit diesem kunstvollen Geflecht im Nacken. Freya selbst hielt ihre Frisur vor allem für eine pragmatische Lösung. Sie hatte es auch überhaupt nicht nötig mit ihrem Aussehen zu kokettieren, seit sie im Anschluss an das »mit Auszeichnung« bestandene zweite Staatsexamen und ihre AIP-Zeit eine nicht ganz unbedeutende Funktion in der Orthopädie der Kieler Universitätsklinik ausübte. Mit Knochen kannte sie sich aus.
Der Anruf des alten Mitstreiters aus Uni-Tagen war nach all den Jahren doch etwas überraschend gekommen. Und die Geschichte, die er ihr am Telefon kurz angedeutet hatte, kam ihr noch merkwürdiger vor. Knochen von einem Waldspaziergang. Was mochte das sein: ein Hirsch, ein Reh? Dafür war doch wohl eher ein Förster oder Tierarzt zuständig! Wie auch immer, die Aussicht, Tim nach so langen Jahren wiederzusehen, löste bei ihr eine kaum zu unterdrückende Vorfreude aus. Die hatte Freya zwar Mühe sich einzugestehen, aber es gab sie. Warum hatte sie Tim eigentlich immer so gern gehabt? Weil er nicht übel aussah – natürlich. Und dann war er keiner von diesen unausstehlich arroganten Schürzenjägern mit Titel und Kittel, mit denen sie sich hier ständig herumzuschlagen hatte. Vor allem aber hatte er diese geheimnisvoll tiefgründigen dunklen Augen. Auf die Augen kommt es an; das war Freyas Überzeugung schon immer gewesen. Niemals hätte sie sich in einen Typen mit diesen mattblauen bis trüb-grauen Augen verlieben können, die auch charakterlich jeden Tiefgang vermissen ließen – die Augen als Spiegel der Seele. Inzwischen war sie zwar so gut wie verheiratet, aber Tim war ... Tim. Haben konnte man ihn sowieso nicht. An ihn war unmöglich heranzukommen. Das Vorhaben, den Schiefen Turm von Pisa zurechtzurücken, schien entschieden aussichtsreicher. Tim umgab eine mysteriöse Mauer fast schon priesterlicher Unantastbarkeit, eine Mauer, die selbst die Posaunen von Jericho nicht zum Einsturz hätten bringen können. So jedenfalls war es ihr immer vorgekommen. Man wagte einfach nicht, ihn um eine Verabredung oder Derartiges zu bitten. Es kursierten ein paar sehr abschreckende Anekdoten über Fälle, in denen jemand versucht hatte, ihn aus der Reserve zu locken. Und die Moral dieser Geschichten lautete immer gleich: Finger weg.
Natürlich hatte Tims unorthodoxer um nicht zu sagen: exzentrischer Umgang mit dem anderen Geschlecht der Fantasie einiger (es kann sich nur um die Autorinnen besagter Anekdoten handeln) mächtige Flügel verliehen. »Du musst irgendwann mal ganz übel auf die Schnauze gefallen sein«, hatte Tim sich sagen lassen müssen oder (die verständnisvoll-feinfühlige Variante): »Dir muss jemand mal sehr weh getan haben.« Gemeint war natürlich, dass Tim von seiner großen Liebe brutal enttäuscht worden war und deswegen ein Trauma mit Langzeitwirkung erlitten hatte. Tim dagegen leuchtete überhaupt nicht ein, warum man gleich ein Trauma-Geschädigter sein musste, wenn man nicht darauf bestand, einen unkomplizierten und unproblematischen Lebensentwurf zu korrigieren. Und so konterte er: »Genau umgekehrt: Solche traumatischen Erfahrungen sind es gerade, die ich auf diese Weise geschickt umgehe.« Denn so viel verstand Tim auch damals schon von der Welt, wenn auch aus bloßer Theorie, dass er die mit Abstand größte Problemquelle im Leben eines Mannes zielsicher ausmachen konnte (und damit zugleich die Quelle potentieller Traumata, denn was ist ein Trauma anderes als das traurige Ergebnis eines Problems, das scharfe Krallen ausfahren kann?). Außerdem fragte er sich, warum manche Leute einfach nicht begreifen konnten, dass ein Leben ohne Frau das Einfachste von der Welt und vor allem in jedem Fall einfacher war als eines mit, insbesondere wenn man das Wort »einfach« einfach mal wörtlich nahm. Und selbst wenn man selbiges aus irgendeinem Grunde nicht einzusehen befähigt war, gab es deswegen noch längst keinen Grund, von sich auf andere zu schließen.
Die Sachlage war also eindeutig und Tim eine geheimnisvolle, uneinnehmbare Festung. Was nicht bedeutete, dass man sich mit ihm, dem Philosophen, nicht vortrefflich unterhalten konnte. Tim verfügte, nicht nur seines Studienfachs wegen, über ein ausgesprochen umfangreiches literarisches Wissen. Seine Allgemeinbildung war phänomenal. Ihm fiel zu so ziemlich jedem Fachgebiet – sei es Medizin, Recht, Chemie oder sonst was – genug ein, um einem Experten über die Dauer eines Small-talks hinaus folgen zu können, egal ob es um den Vietnamkrieg, den Zitronensäurezyklus oder Ethnien im Regenwald von Papua-Neuguinea ging. Schwierig wurde es erst, wenn man auf Privates zu sprechen kam, auf seine Biografie. Es schien, als hätte er die meisten Brücken zur Vergangenheit abgebrochen. Von seinem Vater wusste man gar nichts, seine Mutter lebte in Hamburg, er aber hatte es vorgezogen, in Göttingen und Kiel zu studieren, und nur selten ließ es sich vernehmen, dass er mal für ein Wochenende seine Mutter besuchte; vom Vater ganz zu schweigen.
Kennen gelernt hatten sich Freya und Tim in der Evangelischen Studentengemeinde, die regelmäßig zum »Philosophisch-religiösen Zirkel«, kurz PRZ, lud. Einmal wöchentlich hatten sich Studenten – oder Studierende, wie man heute an deutschen Hochschulen sagt, wenn man nicht unangenehm auffallen will – aller möglichen Fachbereiche in den Räumlichkeiten der ESG an der Uni zum Austausch über Bibel, Gott und die Welt getroffen. Dabei konnte es auch schon mal die Mao-Bibel sein, aus der zitiert wurde. Gelegentlich unternahmen Einzelne aus der Gruppe gemeinsam etwas am Wochenende, betätigten sich sportlich, gingen ins Kino oder Theater oder zum Italiener, und sofern nicht die Gefahr bestand, irgendwann mit einer weiblichen Studierenden allein gelassen zu werden, war Tim allem Anschein nach gerne mit von der Partie, auch wenn er nicht gerade die größte Stimmungskanone war. Nach ein paar gemeinsamen Semestern in der Gruppe hatten sich die Wege von Tim und Freya dann getrennt. Freya konnte sich noch gut an ihre letzte PRZ-Diskussion erinnern. Sein ständiges Gegen-den-Strom-Schwimmen und sein eigenwilliges Infragestellen von Ansichten, die bei den meisten anderen gesetzt waren (oder Gesetz), hatten Letztere entnervt und ihn selbst zermürbt. Sie gipfelten auf der letzten gemeinsamen Zusammenkunft damals am Semesterende in seiner strittigen Forderung, Gott als Gesetzgeber erst dann abzusetzen, wenn er erwiesenermaßen inexistent sei. Er aber habe dafür keine Beweise gefunden, nur Mehrheitsbeschlüsse und stillschweigenden Konsens, den »Konsens des Mainstream«. Was jedoch war »Mainstream«? Tims Antwort: »Das, was die meisten Menschen, fehlbare, vergängliche, in ihren Überzeugungen wechselhafte und verführbare Menschen, innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts für richtig halten, zum Beispiel zum Thema Judentum in der Nazi-Zeit.« Es war um die Frage gegangen, wie ein universelles menschliches Ethos in der Welt verankert werden könne. Die eine Seite vertrat den Standpunkt, der gesunde Menschenverstand oder Commonsense, das menschliche Gewissen, ein der Wissenschaft zu verdankender Wissensstand, ethische Grundregeln und Erkenntnisse aus der Philosophie könnten das sittlich Gute und Richtige durch eine gemeinsame Anstrengung aller gebildeten Menschen in der Welt verankern. Die Fehler der vergangenen zweihundert Jahre seien ein letztes Aufbäumen der Dummheit und Barbarei gewesen gegen das, was alle längst als richtig und gut begriffen hätten. Gegen diesen »aufklärerischen Illusionismus« und »blauäugigen Idealismus« hatte sich keiner so vehement zur Wehr gesetzt wie Tim. Per Mehrheitsbeschluss, so sein Vorwurf, sei eine neue, primär von fehlbaren Menschen komponierte Religion aus der Taufe gehoben worden. Robespierre habe dasselbe versucht und sei kläglich gescheitert. Als hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Menschen als Autoren und Bürgen eines dauerhaft gültigen Sittengesetzes überfordert sind. Denn wenn ein Mensch in seiner angeborenen Fehlbarkeit irren könne, dann könnten die Menschen auch mehrheitlich irren und somit falsche Maßstäbe setzen, die zwar in einer bestimmten Zeit oder Epoche richtig aussehen mochten, aber ein Verfallsdatum besaßen. Was sich aber nur zeitweilig als wahr erweise, sei überhaupt keine Wahrheit. Als Beispiel hatte Tim in einer als niederträchtig empfundenen Parade das Dritte Reich angeführt. Damals hätte sich in fast allen Schichten eine Mehrheit für den Führerkult gefunden; das, was damals nur eine Minderheit vertreten habe, sei heute als richtig anerkannt. »Wer hat damals den gesünderen Menschenverstand gehabt?«, hatte Tim provokativ in die Runde gefragt, in der natürlich jeder wusste, wie viele ihren Widerstand gegen die Nazis mit dem Tode bezahlt hatten. Freya erinnerte sich, als wäre es gestern gewesen. Schweigend hatten sie dagesessen, als Tim gleich im Anschluss die Frage stellte: »Und was ist in hundert Jahren Konsens? Vielleicht sind wir ja heute alle im Irrtum!« Eine dritte Fraktion, der Freya angehört hatte, versuchte erfolglos zu vermitteln und in Anlehnung an Kant die Religion als Stifterin eines Sittengesetzes irgendwie in die Gegenwart hinüberzuretten. Aber Tim war kein Freund von Kompromissen. Ein Semester später hatte er seinen verlorenen Posten geräumt.
Als Freya ihr Medizinstudium abschloss, hatten sie sich längst aus den Augen verloren – aber nicht ganz aus dem Sinn, wie Tims Anruf jetzt bewies. Immerhin wusste er, was aus ihr geworden war, ein paar alte Verbindungen bestanden also noch.
Am Samstagnachmittag um drei Uhr betrat er verabredungsgemäß die Teeküche der Orthopädie, wohin eine hilfsbereite Krankenschwester ihn gelotst hatte. Freya hatte einen Tee vorbereitet und offerierte, nachdem die alten Studienfreunde sich, für Tims Verhältnisse vergleichsweise herzlich, begrüßt hatten, ein paar Kekse. Tim stellte die Plastiktüte, in die er die Knochen gelegt hatte, beiseite und setzte sich an den irgendwie steril wirkenden Tisch. Vielleicht rührte der Eindruck der Sterilität auch nur von Freyas weißer Arbeitstracht und den vielen Medikamenten her, die auf den Regalen und auch sonst überall im Raum herumstanden. Sogar der Tee schmeckte irgendwie nach Medizin. »Was'n das für'n Tee?«, fragte Tim, als er die Tasse wieder absetzte. Er wusste, was er sich bei Freya herausnehmen durfte. »Blasen- und Nierentee?«
»Ach Timmi«, musste Freya lachen, »immer noch der alte Skeptiker, was? Lieber sterben als mit einem negativen Urteil hinterm Berg halten.«
»Immer im Dienste der Wahrheit«, erwiderte Tim mit einem schelmischen Lächeln. »Die Wahrheit ist das höchste Gut. Suchen nicht alle Philosophen und Wissenschaftler, auch in der Medizin, immer nach der letzten, ultimativen Wahrheit, nennen wir sie Gott, Tao, Brahman oder sonst wie?«
»Aber du hast heute schon noch was Konkreteres im Visier als die philosophischen Streitfragen von damals, oder? Ich würde jetzt gern mal die Wahrheit erfahren über deine komischen Knochen. Sind die etwa da drin?« Freya deutete auf Tims Plastiktüte. Er nickte, griff mit einer raschen Handbewegung nach ihr und packte aus. Stück für Stück legte er den gesamten Fund auf den Tisch. Dr. Meisenberg wurde ein wenig blass, verlor aber, als Ärztin so einiges gewohnt, nicht die Fassung. »Das ... ist von einem Menschen!«, rief sie aus. Und nun musste Tim auch mit dem Rest seiner Geschichte herausrücken. Unterdessen sah sich Freya die Knochen etwas genauer an. »Also«, sagte sie schließlich, »eins steht fest: Der ist schon 'ne ganze Weile tot, Jahre, vielleicht Jahrzehnte.«
»Könnte er auch eine Sie sein? Und kann man das Alter nicht genauer bestimmen?«
»Oh«, entglitt es Freya plötzlich, als hätte sie etwas entdeckt. Tims Frage schien sie überhaupt nicht zur Kenntnis genommen zu haben. »Was ist denn das?« Sie griff nach einem der Mittelhandknochen. Ihre wissenschaftliche Neugier schien erwacht. »Sieht aus, als hätte unser Freund hier irgendwann mal einen Handbruch erlitten. Man kann die Fraktur noch erkennen«, sagte sie mehr zu sich selbst als zu Tim. »Äh, was wolltest du wissen?«
»Kann man nicht eine genaue Analyse machen, um über den Zeitpunkt des Todes, über die Herkunft des Opfers und solche Sachen mehr zu erfahren?«
»Sag mal, spinnst du? Das ist hier keine Gerichtsmedizin!«
»Aber zu der bestehen doch bestimmt Kontakte.«
»Willst du jetzt Detektiv spielen oder was?«
»Immer im Dienste der Wahrheit«, sagte er ruhig.
»Das ist ein Fall für die Polizei!«
»Polizei! Du weißt doch genauso gut wie ich, dass das Einzige, was die wirklich interessiert, die Verteilung von Knöllchen an jeden deutschen Parksünder ist. Glaubst du, die machen ihren Rücken für so'ne uralte Geschichte krumm, die zig Jahre zurückliegt? Das ist Zusatzarbeit für Unterbezahlte.«
»Und wenn das nun ein Mord gewesen ist? Dann ist das ein Fall für die Mordkommission.«
»Das ist mein Fall«, widersprach Tim so energisch, dass das erst mal ein Schweigen gebot. Tim merkte, dass er etwas übers Ziel hinausgeschossen war und versuchte abzuschwächen: »Zunächst ist das mal mein Fall. Ich hab' schließlich die Dinger da gefunden.«
»Du hast vielleicht Humor«, fand Freya ihre Sprache wieder, »knallst mir hier 'n paar Menschenknochen auf'n Tisch und sagst: ›Das ist mein Fall!‹ Wir sind hier doch nicht bei Quincy, das ist blutiger Ernst!«
»O.k., o.k., du hast recht. Ich werde die Polizei benachrichtigen. Aber auf ein oder zwei Tage wird es ja wohl nicht ankommen, nachdem die Leiche dort jahrzehntelang verbuddelt gewesen ist.«
»Die Leiche? Hast du denn noch mehr ...?«
»Nein. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt hab'. Ich war zwar gestern mit dem Hund noch mal da und hab' stundenlang das Gelände durchwühlt, aber es war nichts weiter zu finden. Demnach kann man gar nicht wissen, ob wirklich jemand gestorben ist ...«
»Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Oder hast du jemals davon gehört, dass jemand sich 'n Arm abhackt, um ihn danach im Wald zu vergraben? Ich hab' in meiner medizinischen Praxis schon 'ne Menge abnormer Dinge erlebt, aber das –«
»Abnorm ist die Sache allemal«, unterbrach Tim sie, »und ich träum’ nachts auch schon schlecht davon.«
Freya rückte ihre Brille zurecht und sah sich einige der Knochen gründlicher an. »Sieht in der Tat so aus, als wäre am Oberarm gesägt worden, diese Spuren ... Mal überlegen ... Was hältst du von folgender Hypothese: Jemand wurde ermordet und, um Spuren zu verwischen, um die Identifikation zu erschweren, hat sein Mörder ihn zersägt. Uh!« Die Vorstellung ließ ihr einen Schauer in die Glieder fahren. »Und die einzelnen Leichenteile wurden dann an verschiedenen Orten verscharrt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Von so einem Fall hab' ich schon häufiger gehört. Wenn es nicht so makaber wäre – es erscheint zumindest logisch.«
»Die Logik eines Mörders«, stimmte Tim zu.
»Mann, wo bin ich da reingeraten? Gruselig. Mit dir erlebt man wirklich die unglaublichsten Dinge, Timmi. Ich glaub', ich mach' uns noch 'n Tee. Was hast du eigentlich gemacht seit damals? Noch mehr so Sachen?«
Tim fiel darauf keine Antwort ein, mit der er hätte zufrieden sein können. Schweigen breitete sich aus. Freya legte nach: »Wie ist es dir ergangen?«
Gern sprach er nicht über sich selbst und über sein Leben. Ja, seit dem Studium war Zeit vergangen. Und in dieser Zeit hatte Tim sich, wenn er ehrlich war, zurückentwickelt. So musste man das wohl nennen. Ein Sonderling war er ja immer gewesen, aber doch immerhin einer mit Humor, schlagfertig sogar und mit wacher Lust am Gespräch. Und jetzt?
Seit knapp drei Jahren arbeitete er als Lektor für einen Verlag, der vorwiegend Bildbände herausgab. Den Großteil seiner Arbeit konnte er zu Hause am Computer erledigen. Nur zwei, drei Mal pro Woche fuhr er nach Hamburg, um vor Ort Detailfragen zu klären, Absprachen mit Kollegen zu treffen, Anweisungen zu geben, an Sitzungen und Besprechungen teilzunehmen, mit Autoren und Fotografen zu reden, teure Ferngespräche zu führen oder teure Farblaserausdrucke machen zu lassen, eben all die Dinge, für die ein Büro in der Großstadt von Nutzen ist. Tim liebte die Stadt nicht. Und er liebte die Menschen nicht. »Nichts flößt mir weniger Vertrauen ein als Menschen«, hatte er in der Anfangszeit einem Kollegen gestanden, dem er offensichtlich sympathisch war. Das beruhte allerdings nicht auf Gegenseitigkeit. »Hast du Lust mit rüber zum Döner-Laden?«, hatte der einmal sogar gefragt. Einige aus dem Verlag aßen dort regelmäßig zu Mittag. Aha, so'n sozial Kompetenter, hatte Tim gedacht, der Menschen gern heimlich analysierte. Er hatte auf seine Tupperdose mit Schwarzbrot-Stullen verwiesen, verlegen gelächelt und dankend abgelehnt. Er rechnete sich selbst, und zwar völlig ungehemmt, der Spezies seltsamer Einsiedler zu. Irgendetwas hielt ihn von der Menschheit fern, irgendeine unbestimmte Angst. Schon als Kind hatte er den Alm-Öhi aus »Heidi« bewundert, vor allem in der Lebensphase vor Heidi. Tatsächlich erinnerte seine Lebensweise von ferne an das literarische Vorbild: Zurückgezogen lebte er in einem renovierten Bauernhaus. Statt der Berge gab es den Kanal. Die nächste Siedlung, eine Art »Dörfli«, war fünf Kilometer entfernt und ihr wichtigstes Gebäude ein Altenheim. Man kann schwerlich umhin, aus all diesen Beobachtungen zu folgern: Tim brauchte keinen Menschen auf der Welt. Und vielleicht war es auch keine Übertreibung zu sagen: Andere Menschen waren ihm total egal. Aber sollte er das alles seiner alten Studienkollegin anvertrauen? Was würde sie davon halten?
Tim antwortet: »Ach, man leibt und lebt.« Und erst als der Satz schon ausgesprochen im Raum stand, bemerkte er, dass er die Reihenfolge der beiden Verben durcheinander gebracht hatte. Das mit dem Verlag erwähnte er auch noch kurz. Dann nahm er einen Schluck Tee und schlürfte dabei leicht.
Als die Dämmerung einsetzte, verabschiedete sich Tim ebenso plötzlich, wie er mit dem Telefonanruf nach so langer Zeit aus der Versenkung aufgetaucht war. Dieser Tim Schlüter war doch ein unergründlicher Kerl. Aber Freya mochte ihn, sie mochte seine unterkühlte, scharfsinnige und bisweilen ironisch-spitzfindige Art. Und sie hatte gleich gewusst, dass sie ihm seine Bitte nicht würde abschlagen können. Sie versprach ihm also, sich um die erwünschte Analyse zu bemühen. »Sobald die Ergebnisse vorliegen, ruf' ich dich an. Deine Nummer hab' ich noch irgendwo. Immer noch das einsame, alte Bauernhaus zwischen Kiel und Rendsburg, das du von deinem Opa geerbt hast?«
»Inzwischen mit komplett renovierten Wohnräumen. Manche Träume werden eben doch Wirklichkeit.«
»Wusste gar nicht, dass man beim Verlag so gut verdient.«
»Man braucht im Leben immer etwas Glück. Neben allem Können. Bis dann also, ich verlass' mich auf dich.«
»Und ich verlass' mich darauf, dass du die Polizei informierst. Du hast es versprochen.«
»Klar.«
Allein in der Teeküche ihrer Station zurückgeblieben, nippte Freya an ihrem kalten Tee und knabberte den letzten Keks auf, während sie mit der anderen Hand an ihrem hübschen Zopf drehte und mit wachen Augen auf Menschenknochen starrte.