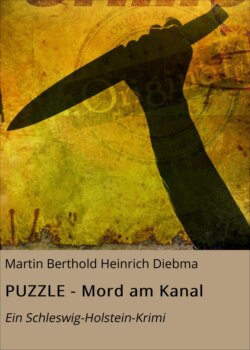Читать книгу PUZZLE - Mord am Kanal - Martin Berthold Heinrich Diebma - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Eisenkrug
ОглавлениеWenn jemand an einem der folgenden Tage, es war später Oktober, in Rendsburg, Eckernförde, Kiel oder irgendwo dazwischen ein Juweliergeschäft betreten hat und sich an einen jungen, gut aussehenden Mann mit glatten, gleichmäßigen Gesichtszügen, etwas altmodisch auf Seitenscheitel gekämmten, dunkelblonden Haaren und südländisch dunklen, forschenden Augen erinnert, der mit einer schneidend scharfen, klaren Männerstimme mit norddeutschem Akzent von einem verwundert dreinblickenden Juwelier eine recht merkwürdige Auskunft verlangte, einen zerschlissenen Bundeswehrparka im Stil der Siebziger trug und vor dem Geschäft einen Hund angebunden hatte, der einem zu klein geratenen Schäferhund entfernt ähnlich sah, dann kann die betreffende Person davon ausgehen, dass sie Tim persönlich begegnet ist. Mit äußerster Verbissenheit folgte er nämlich seiner Spur, betrat Geschäft um Geschäft, holte den goldenen Anhänger mit der Aufschrift Regina ein ums andere Mal aus der Tasche und stellte immer wieder dieselben Fragen: »Können Sie sich erinnern, diesen Anhänger verkauft zu haben? Haben Sie vielleicht eine Idee, woher er stammen könnte?« Tim wusste, dass er jetzt in besonderer Weise auf Glück angewiesen war, denn er setzte voraus, dass dieser Anhänger in der Nähe des Fundortes erworben worden war, wofür zwar die Wahrscheinlichkeit sprach; einen Beweis dafür gab es jedoch nicht. Das Ding konnte ebenso gut aus München, Mailand oder Miami stammen. Aber warum sollte ihm Fortuna nicht mal hold sein, wenn er nur mit genügend Geduld zu Werke ging? Die brachte er in der Tat in bewundernswerter Weise auf. Und schließlich kam es, im Juwelierladen Eisenkrug in Kiel, zu einer ausgesprochen bemerkenswerten Begegnung. Der Inhaber hatte tatsächlich eine Idee, woher das Ding stammen könnte. Er war ein hagerer, kahlköpfiger Mann mit einer uralten Brille, deren riesige Gläser in ein dickes Gestell aus dunklem Plastik eingefasst waren, wie sie anno 2000 eigentlich nur noch chinesische Politiker trugen. Dahinter lugten seine durch die Linse erheblich vergrößerten grauen Augen hervor wie fette Fische aus den Bullaugen eines Schiffswracks auf dem Meeresgrund, während er einen wissenschaftlich fundierten Blick auf das goldene Kleinod warf. »Tja, das kommt mir schon irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das stammt aus unseren Beständen. Moment!« Damit verschwand er hinter einem grauen Vorhang im Hintergrund des Ladens. Tim hörte das Geräusch von auf- und zugeschobenen Schubladen. Der Juwelier brummte etwas vor sich hin. Dann kehrte er stolz mit einem glänzenden Stück Schmuck wieder, das Tims Fund so täuschend ähnlich war, dass er sich mit einem raschen Blick auf die Theke vergewisserte, ob es sich nicht um dasselbe handelte, nur perfekt aufpoliert. Doch »sein« Anhänger lag unberührt da, wo ihn der Juwelier wenige Minuten zuvor abgelegt hatte. »Wie ein Ei dem andern, nicht wahr?«, freute sich der Juwelier, als er sein Schmuckstück neben das von Tim gelegt hatte. Dozierend fuhr er fort: »Nur die Gravur fehlt, die wird ja individuell angefertigt. Aber genau die hat mich auf die Spur gebracht. Sehen Sie diesen Schnörkel am R? Es sieht fast aus wie ein B, nicht wahr?«
»Ja?«
»Diese Spirale am Anfang ist nicht gewöhnlich. Sehen Sie, die macht fast zwei Umdrehungen, völlig unüblich. Das ist die Handschrift von Eisenkrug.«
»Ist es möglich, sich zu erinnern, wann diese Gravur hier angefertigt wurde?«
Der Mann zuckte mit den Achseln. »Ich führe das Geschäft hier erst drei Jahre«, erwiderte er.
»Sagen Sie nicht, Ihr Vorgänger ist tot!«, rief Tim in einem Anflug von Panik.
»Keine Bange. Der alte Eisenkrug ist viel zu reich, um schon totzubleiben. Er hat sich irgendwo zwischen hier und Eckernförde in einer stattlichen Villa zur Ruhe gesetzt, um gemeinsam mit seiner Frau das Rentnerdasein zu genießen – wohlverdient nach einem langen, arbeitsreichen Geschäftsleben wie dem seinen. Aber wie das Leben so spielt: Alles war wunderbar hergerichtet oder hingerichtet – wie sagt man? – na, jedenfalls renoviert. Eine wahre Idylle, in der es richtig Spaß bringen musste, alt zu werden. Und dann, vier Monate nach dem Einzug, stirbt ihm die Frau weg – Krebs! –, und die Lebensfreude ist dahin. Da fragt man sich doch: Wozu das alles? Wofür müht man sich nun sein ganzes Leben mit Geldverdienen ab, wenn man's nachher nicht mal anständig genießen kann?«
»Es gibt eine Menge Misstöne auf der Klaviatur des Lebens«, sagte Tim leise. »Können Sie mir nicht seinen Namen und vielleicht seine Anschrift sagen?«
»Du meine Güte, wozu ist denn das bloß so wichtig? Nach all den Jahren kann man doch an dem Teil nichts mehr reklamieren.«
»Es handelt sich um eine wichtige, persönliche Angelegenheit«, erklärte Tim.
»So, so, ein wichtige, persönliche Angelegenheit. Na, von mir aus. Wissen Sie, der alte Eisenkrug ist nicht etwa mit mir verwandt. Ich hab' eigentlich gar nichts mit ihm zu tun. Ich hab' lediglich sein Geschäft gekauft ... und den Namen beibehalten. Wegen der Ironie. Sie verstehen: Juwelier – Eisenkrug. Lustig, oder?« Der Juwelier lächelte Tim an. Doch dem war nicht zum Lachen zumute. »Außerdem darf man seine Kunden nicht überfordern. Es gibt nichts Konservativeres als Kunden, vor allem hier oben. Wenn Sie Ihr Kind halb tot prügeln, dann stört das keinen, aber ändern Sie nie was, was schon immer so war! Wenn Sie aus einem altmodischen, provinziellen Lädchen ein neues, professionell geführtes Geschäft machen wollen, dann geben Sie den Laden lieber gleich auf und bringen Ihr Guthaben auf die Bank, solange Sie noch welches haben. Hier gleich um die Ecke gab's früher mal die Drogerie Lindemann, geführt seit Ende des Krieges von einem alten Herrn gleichen Namens. Vernünftige Arzneien gab's da nicht, aber dafür Dauerlutscher, kleine, bunte, steinharte Zuckerkügelchen für einen Pfennig das Stück, bei uns als Kindern der Renner. Weit und breit war sonst für einen Pfennig nämlich nirgendwo was zu kriegen. Der alte Herr starb, und mit ihm erlosch die Drogerie Lindemann. Sie wurde von Edwin Pingel aufgekauft, dem Inhaber eines gut gehenden Lebensmittelgeschäfts in diesem Stadtteil, jemand mit Expansionsabsichten. Pingel steckte jede Menge Geld in den Laden und renovierte wie der Teufel: alter Fußboden raus, neuer Parkettboden rein, alte Regale raus, neue rein und so weiter. Am Ende strahlte der Laden wie aus dem Ei gepellt und war nicht wiederzuerkennen. Natürlich hieß er auch nicht mehr Lindemann, sondern Pingel, Drogerie Pingel. Der Warenbestand war erheblich aufgestockt worden. Was es allerdings nicht mehr gab, waren Opa Lindemanns Dauerlutscher für einen Pfennig, wie einem alle Kinder enttäuscht mitteilten. Ich weiß nicht, vielleicht hatte der alte Lindemann die selber hergestellt, was Edwin Pingel natürlich nicht konnte. Er war ja kein richtiger Drogist, nur ein Kaufmann. Vielleicht war das sein Problem. Jedenfalls, ohne Dauerlutscher schien der Laden nicht mehr zu laufen. Und ein Jahr später konnte Pingel seine Drogerie dichtmachen. Sie hätten fragen können, wen sie wollten: Jedem im Viertel tat es leid, dass es nun keine Drogerie mehr hier gab. Aber dort eingekauft hatte keiner. Sie können ja gleich mal daran vorbeigehen. Heute befindet sich ein gut gehendes Blumengeschäft darin, immer noch auf Edwin Pingels schickem, neuem Parkettboden. Jetzt wissen Sie, warum ich Stücke im Sortiment habe, die ich eigentlich unmöglich finde, und warum ich dem alten Eisenkrug dankbar dafür sein muss, dass ich das Geschäft unter seinem Namen weiterführen durfte. Eisenkrug – was für ein Name für ein Juweliergeschäft! Das klingt nach billigem Ramsch, den keiner braucht. Mein Name ist Oldmann. Passt der nicht viel besser zu kostbaren Juwelen? Aber der Kunde ist König. Und er liebt es so. – Wie waren wir darauf gekommen?«
»Ihr Vorgänger, wo –?«
»Ach so, ja. Alfred Eisenkrug. Der Ort, wo er seine Villa stehen hat, warten Sie mal, das war ... in ... in Gettorf, glaube ich. Aber fragen Sie mich bloß nicht nach der Straße!«
◊
An einem Sonntagnachmittag stand Tim bei sonnigem Spätherbstwetter zum zweiten Mal vor dem Haus der Wilhelmsens. Er bog andächtig in die Zufahrt zum weißen Haus ein und lenkte seinen alten Ford geradewegs auf den Mittelpunkt des Anwesens zu, die Haustür, die sich schon aus der Ferne groß und dunkelbraun von dem weißen Putz abhob. Der Vorhof des Hauses war kreisförmig mit Kieselsteinen ausgelegt, auf denen Tim, während sie unter ihm knirschten, dahergerollt und schließlich zum Stillstand kam. Er parkte direkt vor ein paar kahlen Rosensträuchern an der trüben Hausfassade, wo gleich neben ihm schon ein roter Golf stand, zweite Generation. Dann stieg er drei überaus breite Stufen empor, las neugierig das Namensschild auf dem Briefkasten und erlebte eine böse Überraschung. Der Name lautete nicht Wilhelmsen, sondern Manstein. Umgezogen, geisterte es durch seinen Kopf. Er zögerte und entschloss sich dann, trotzdem zu klingeln. Es öffnete ihm eine junge, schwarzhaarige Frau in Jeans und Pullover, eine formvollendete Schönheit, deren große, weit auseinander liegende und etwas traurige Augen ihn neugierig und skeptisch anblickten und deren silberne Ohrringe eine leichte Erschütterung erkennen ließen. Tim musste unwillkürlich an die Schauspielerin Svenja Pages denken, die er mehrfach in Derrick gesehen hatte und eine Zeit lang für die zweitschönste Frau der Welt gehalten hatte, übertroffen nur noch von Winona Ryder.
»Guten Tag, äh«, brachte er unsicher und ohne jegliche Anstalten näherzutreten hervor, »mein Name ist Tim Schlüter. Sie kennen mich nicht, aber –« Er bemerkte, dass sie befremdet ihre feinen, schwarzen Augenbrauen senkte, was ihren Blick noch skeptischer und Tim noch unsicherer machte. Hinzu kam eine gehörige Portion dieser eigenartigen Fahrigkeit und Nervosität, mit der wohl jeder Erwachsene bei der ersten Begegnung mit einem Menschen des anderen Geschlechts von äußerst anziehendem Äußeren schon Bekanntschaft gemacht hat, eine nur bedingt angenehme Bekanntschaft. Sie hatte definitiv Ähnlichkeit mit Svenja Pages, vor allem im Profil. Vielleicht war Svenja Pages nur ein Künstlername und die Schauspielerin lebte unter ihrem echten Namen zurückgezogen in einem einsamen Landhaus in Schleswig-Holstein. »Sind Sie Frau Pa...nstein, Frau Manstein? Oder Fräulein ...? Ich bin nämlich auf der Suche nach einer gewissen –«
»Wilhelmsen«, fiel sie ihm ins Wort.
»Äh, ja, genau. Wie –?«
»Ich bin Charlotte Wilhelmsen. Manstein ist der Mädchenname meiner Mutter. Sie hat ihn wieder angenommen aus Gründen, die für Sie wohl kaum von Belang sind.«
»Vielleicht doch. Ich bin hier, weil ich möglicherweise etwas weiß über Regina Wilhelmsen, Ihre Schwester, wie ich annehme?«, stieß er nun rasch hervor, womit die Rollen vertauscht waren. Jetzt war er der Wissende und sie die Verunsicherte. Bei seinen letzten Worten war sie merklich zusammengezuckt. Sie kniff nachdenklich ihre blass roten Lippen zusammen und öffnete sie erst nach einer ganzen Weile wieder, um Tim zum Eintreten aufzufordern. Sie führte ihn durch den Korridor in ein üppig und stilvoll ausgestattetes, sehr geräumiges Wohnzimmer mit auffällig hoher Decke, in dessen Kamin ein paar Holzscheite in hellen Flammen standen. Auf dem Kaminsims thronte ein prächtiger ausgestopfter Auerhahn neben einem gerahmten Foto, und die Wände waren, abgesehen von ein paar düsteren Gemäldereproduktionen, die sich aber farblich nahtlos einfügten, übersät mit Geweihen, Hörnern und anderen klassischen Jagdtrophäen. Vom Sofa aus, in dem er Platz nehmen durfte und das gegenüber vom großen Wohnzimmerfenster stand, hatte man einen herrlichen Blick auf den üppigen, aber vernachlässigt wirkenden Garten. Dahinter waren zum Horizont hin leicht ansteigende kahle Felder zu sehen, über denen am kristallklaren und kristallkalten Himmel ein paar Krähen sich, wohl nur aus Langeweile, durch die Luft treiben ließen. Tim gewann den Eindruck, dass er in einem nicht ganz armen Hause saß, dem es trotzdem am Wesentlichen fehlte.
Mit dem Versprechen, in einer Minute zurück zu sein, kehrte die schwarzhaarige Schönheit Tim den Rücken zu, dem er einen interessierten Blick hinterherwarf. Keck tänzelte und wippte der Pferdeschwanz auf ihrem Rücken, während sie den gemütlich warmen Raum verließ. Mit dem Ansatz eines Lächelns, der das Traurige, Schwermütige in ihren Augen nicht auszulöschen vermochte, kehrte sie in Begleitung einer dampfenden Kanne Tee, einer Zuckerdose und dem nötigen Geschirr auf einem Tablett zurück. Tim schätzte Menschen, die Gastfreiheit für selbstverständlich erachten und solche Dinge einfach aus einem Impuls heraus tun, ohne fragen oder lange nachdenken zu müssen. Er selbst war nämlich völlig anders gestrickt und hatte mit jeder Art von Selbstverständlichkeit erhebliche Mühe. Als sie beide bequem saßen und einen ersten vorsichtigen Schluck Tee geschlürft hatten, sagte sie mit ihrer sehr hellen, aber klaren und festen Stimme: »Es stimmt, ich bin Reginas Schwester. Wissen Sie, dass wir seit über zwölf Jahren nichts von ihr gehört haben?« Während sie an ihrer Teetasse nippte, sah sie ihm über den Tassenrand hinweg immer noch kritisch ins Gesicht, musterte ihn, als forsche sie im Gesicht eines Tatverdächtigen nach irgendeiner schrecklichen Wahrheit. Dabei wirkte sie wie eine Schachspielerin auf der Hut vor einer Falle.
»Nein«, erwiderte Tim. Er zögerte, mehr zu sagen.
»Sie ist damals spurlos verschwunden, von einem Tag auf den andern. Was wissen sie von ihr? Ist sie am Leben?« Das schien sie selbst nicht zu glauben.
»Ich weiß eigentlich gar nichts von ihr«, übte Tim sich in Zurückhaltung. »Das Ganze ist eine höchst merkwürdige Geschichte. Ich habe einen Hund. Sein Name ist Cano. Und mit ihm mache ich regelmäßig so meine Spaziergänge. Sie müssen wissen, ich wohne in der Nähe des Nord-Ostseekanals, und da –«
»Sie ist tot, nicht?«, fuhr sie auf einmal ganz ruhig dazwischen.
»Das kann ich noch nicht sagen, ich meine, das kann ich überhaupt nicht sagen, aber ... Hatte Ihre Schwester mal einen Unfall, bei dem sie sich die rechte Hand gebrochen hat?«
»Ein Handbruch? Wie kommen Sie ...? Moment. Ja! Ja, da war mal so eine Geschichte, ein ganz unangenehmer Bruch, den sich Regina beim Volleyball in der Schule zugezogen hat. Sie war angerempelt worden und gestürzt. Der ganze Arm wurde eingegipst.«
»Versuchen Sie sich ganz genau zu erinnern, denn das ist jetzt wichtig«, sagte Tim. Eine fieberhafte Spannung ergriff wieder Besitz von ihm. Und geradezu beschwörend stellte er seine entscheidende Frage: »Um welche Knochen handelte es sich?«
»Du meine Güte! Meinen Sie, wir haben das Röntgenbild von damals bei uns an der Wand hängen? Das muss an die zwanzig Jahre her sein. Ich war damals vielleicht gerade zehn oder elf, was interessieren einen da anatomische Details? Sie hatte eben einen Bruch, fertig.«
»Es ist wichtig«, beharrte Tim und nahm einen geradezu hypnotischen Blick an.
»Tut mir leid, ich muss meine Mutter fragen. Wenn sie gleich reinkommt, kriegen Sie bitte keinen Schreck, und sagen Sie ihr nichts, was sie aufregen könnte, vor allem nicht über Regina. Ihren Namen am besten gar nicht erwähnen. Und egal, was ich meiner Mutter erzähle, nicken Sie einfach nur, nicken Sie die ganze Zeit. Haben Sie verstanden?« Sie wiederholte: »Nicken Sie!« Tim nickte.
Jeder kennt Anekdoten von Menschen, denen der Kummer auf geradezu übernatürliche Weise zugesetzt hat. So soll es vorgekommen sein, dass jemand vor Entsetzen, Trauer oder Schmerz gleichsam über Nacht im wahrsten Sinne des Wortes alt und grau geworden ist. Chronisten berichten von plötzlichem Haarausfall oder völliger Entfärbung der Haare. Von anderen liest man, dass ein Zusammenbruch erfolgt sei, von dem es keine völlige Genesung mehr gegeben habe, oder dass eine dauerhafte Schwäche und Mattigkeit Besitz von ihnen ergriffen habe. Menschen hätten den Verstand verloren, seien »an gebrochenem Herzen« gestorben, eine andere Erklärung sei nicht zu finden. Tim glaubte nicht an derart unwissenschaftliche Erklärungen für Krankheitsbilder. Aber er änderte seine Meinung beim Anblick von Frau Vera Manstein, einst verehelichte Wilhelmsen. Denn wenn er diesen Anblick mit dem Familienfoto auf dem Kaminsims verglich, auf dem dieselbe Person abgebildet war, so konnte kein Zweifel daran bestehen, dass Vera Manstein ein Musterbeispiel für gleich alle der oben beschriebenen Syndrome war. Sie sah so mitleiderregend aus, dass jeder, der sie so sah, auch Tim, sich sagen musste, sie wäre besser an gebrochenem Herzen gestorben. Niemals zuvor hatte er in ein derart verwüstetes Gesicht geschaut. Die Furchen im blutleeren Antlitz der Alten waren so unnatürlich tief, dass man auf die Idee kommen konnte, der Schmerz persönlich wäre vorbeigekommen und hätte ihr jede einzelne selbst mit einem Messer in die Haut geritzt. Es waren Falten wie Narben. Ihre Augen waren blutunterlaufen und blickten müde und trübe aus tiefen, düsteren, feuchten Höhlen. Schwerfällig blinzelten sie ab und zu. Das Haar hing ihr in langen, zerzausten, grauen Strähnen lustlos und ungepflegt auf die Schultern herab. Ihre nach unten verzogenen Mundwinkel, aus denen manchmal, offenbar unkontrolliert, Speichel zum Kinn hinabfloss, ihre schlaff herabhängenden Lippen und Tränensäcke vervollkommneten den Eindruck von Trostlosigkeit, den diese Frau erweckte, eine Greisin, wie jedermann unvoreingenommen geurteilt hätte.
»Mama, dieser junge Mann hier ist ein alter Freund von Regina«, sagte Charlotte laut und vernehmlich und machte dazu erklärende Handbewegungen so überdeutlich, dass man hätte meinen können, die Angeredete sei taubstumm oder Ausländerin. Die ausgezehrte und gebeugte Gestalt der Alten setzte sich in den Schaukelstuhl, der am Kamin stand, und begann sanft hin- und herzuwippen. Dabei schaukelte ihr Kopf ein wenig mit. Vielleicht war es auch ein bewusstes Nicken oder jenes Nicken, das alte Menschen bisweilen auf Grund eines Defekts im Nervensystem überkommt. Man konnte es nicht eindeutig sagen.
»Ein Schulfreund«, brachte sie schließlich mit ihrer zittrigen, belegten Stimme so langsam und bedächtig und zugleich so unkontrolliert laut hervor, dass es sich anhörte wie eine künstlich verlangsamte Tonbandaufnahme, bei der allerdings der Lautstärkeregler zu weit aufgedreht war. Auch konnte man nicht zweifelsfrei entscheiden, ob es sich der Intonation zufolge um eine Frage oder um eine Bestätigung des Gesagten handeln sollte. Noch bevor sie gesprochen hatte, war ein kleiner Tränentropfen am Unterlid des linken Auges hervorgequollen und rann nun im Schneckentempo – passend, ja wie abgestimmt auf die langsame Redeweise – die Wange hinunter. Tim rührte der Anblick dieser gebrochenen, kranken Frau zutiefst, und obwohl er wie gesagt ein rationeller, kontrollierter und seelisch gefestigter Mensch zu sein glaubte, würgte ihn doch in seinem Halse ein Knoten des Mitgefühls. Er nickte, und Charlotte fuhr fort: »Er kann sich sogar noch an ihren Sportunfall erinnern. Weißt du noch, Mama, sie hatte so lange einen Gipsverband. Wir haben alle unsere Namen draufgeschrieben. Dauerte es nicht über einen Monat, ehe er abkam? Und –«
»Und das alles für einen einzigen Finger«, setzte die Alte plötzlich ein, immer noch mit dieser Schneckentempo-Stimme. Ihre feuchten Augen stierten geradeaus, als stünde sie unter Hypnose. »Die arme Regina, sie kann gar nicht mehr schreiben, dabei schreibt sie doch so gerne in ihr Tagebuch, kleine Gedichte. Andere Kinder in der Schule wären wohl froh, die rechte Hand in Gips zu haben, man braucht ja nicht mehr zu schreiben und keine Hausaufgaben mehr zu machen ... Aber Regina nicht! Regina ist traurig. Sie schreibt ja so gerne ... Und alles nur wegen eines einzigen Fingers ...«
»Finger, Mama? War es nicht die Hand, die gebrochen war?«
»Ja, ja, der Finger von der Hand.« Mit einer sanften Bewegung strich sich die Alte, ohne ihren Blick zu senken, mit den eingefallenen Fingerkuppen der linken über den runzeligen Rücken der rechten Hand und deutete so genau die Bruchstelle an, dass Tim Zweifel an der Identität mit der Hand aus dem Wald kaum bleiben konnten. »In der Mitte«, fügte sie erklärend hinzu, »hier.«
»Ja, eine böse Geschichte«, sagte Tim, Lautstärke und Tonfall von Charlotte imitierend, und musste dabei ein bisschen um die Kontrolle über seine Stimme ringen. Denn zum einen machte ihn Frau Wilhelmsen – bei diesem Namen wollte er der Einfachheit bleiben – mit ihren greisenhaften Zügen unsäglich betroffen, zum andern gellte in seinem Innern ein Jubelschrei des Triumphs.
»Mittelfingerhandknochen«, wiederholte die Alte mit wissendem Blick. Und während Charlotte sie unter einem Vorwand wieder aus dem Zimmer geleitete, brabbelte sie immer noch wie geistesabwesend vor sich hin: »Und alles nur für einen einzigen Finger. Mittelfingerhandknochen. Sie schreibt ja so gerne. Andere Kinder in der Schule wären wohl froh ...«
»Es bricht einem das Herz«, sagte Charlotte, als sie zurück war und wieder in ihrem Sessel Platz genommen hatte. Ihre Augen waren ein wenig feucht geworden und der traurige Ausdruck in ihnen kam jetzt so zur Geltung, als hätte jemand durch das Aufziehen eines Theatervorhangs den Blick auf die Bühne freigegeben.
»Ja, ein Trauerspiel«, sagte Tim. »Wo haben Sie sie hingebracht?«
»Sie schält in der Küche Kartoffeln, das kann sie gut. Es beschäftigt sie und lenkt sie ein wenig ab. Sie kommt sich nützlich vor, auch wenn kein Mensch so einen Berg Kartoffeln essen kann. Sie schält nämlich immer für die ganze Familie. Vielleicht sollten Sie mal zum Essen kommen.« Da lächelte sie wieder.
Gute Idee, dachte Tim. »Wohnt sonst niemand hier?«, fragte er.
»Nein. – Hören Sie, Herr – Entschuldigung, ich habe Ihren Namen vergessen ...«
»Tim«, sagte Tim.
»Hören Sie, Tim ...« Sie hielt einen Moment inne, als sei ihr etwas Wichtiges eingefallen. »Meinen Sie, wir könnten uns duzen?«
»Ich denke schon, denke ich«, stammelte Tim, der solche Situationen wegen der ihnen eigenen Peinlichkeit hasste. »Ich meine, mich stört's nicht, Sie, ich meine, dich ... hab' sowieso schon gedacht, dass das komisch ist –«
»Komisch mich zu siezen?«, lachte sie. »Hoffentlich verkraftet mein Selbstwertgefühl das.«
Tim lächelte verlegen.
»Willst du mir, wo das jetzt geklärt ist, nicht endlich sagen, was du weißt und warum du hergekommen bist? Dann erzähle ich dir 'n bisschen was über meine Familie, einverstanden?« Man musste diese Charlotte einfach mögen.
Als Charlotte Tims Kriminalgeschichte in ihren wesentlichen Zügen kannte, sagte sie mit traurig gesenktem Blick: »Ich wusste es ja, ich wusste es die ganze Zeit. Sie konnte nicht mehr am Leben sein.« Tim verspürte ein Verlangen, sie tröstend in den Arm zu nehmen, aber das ging natürlich nicht. Das hier war kein Film. »Dieses Haus ist kein glückliches Haus«, fuhr Charlotte fort. »Du wirst es vielleicht nicht für möglich halten, aber meine Mutter ist erst 54, und es gab Zeiten, da schätzte man sie jünger, als sie war. Sie war das blühende Leben, ein Mensch voller Schwung, voller Witz und Energie, Lebensfreude pur. Sie war glücklich verheiratet, hatte zwei halbwegs wohl geratene Töchter auf dem Weg zum Abi und wirkte wie eine Studentin im ersten Semester. Na gut, sie fing nachher langsam an zu ergrauen, aber nur sehr langsam. Du wirst es nicht glauben, aber auf dem Foto hier ist sie 37.« Sie holte das Familienfoto vom Kaminsims und zeigte es Tim. Er erkannte Charlotte im Backfischalter, mit forschem Blick und glänzendem Haar. Aber sein eigentliches Interesse galt dem Mädchen neben ihr, das ihn sofort unnatürlich anzog. Ja, das musste Regina sein. Sie war blond, etwas größer und reifer als Charlotte und auf diesem Bild auch hübscher, eine bereits voll entwickelte Schönheit, ein attraktiver Teenager, dem man trotz oder auch wegen seiner Unerfahrenheit Lust auf jede Menge Abenteuer zutraute und dem man eine noch größere Menge schnippischer Antworten auf Vorhaltungen der Eltern förmlich von den Augen ablesen konnte. Neugierig, erwartungsfroh, ein wenig frech auch und herausfordernd blickte sie in die Kamera, vielleicht hatte sie so auch in die Welt hinausgeblickt, die eigentlich noch vor ihr lag, als sie sie plötzlich und unerwartet verlassen musste. Und wieder hatte Tim, wie zuvor im Zeitungsarchiv, das Gefühl, irgendwo in den Untiefen seines Gedächtnisses ließe sich vielleicht eine Spur von Erinnerung ausmachen, wenn er sich genug anstrengte. Nur – nicht jetzt.
Hinter den vor ihnen knienden Töchtern standen deren Eltern, ein seriös wirkender, ansehnlicher Mann in den besten Jahren mit schwarzem Vollbart und Charlottes kastanienbraunen Augen, und die Mutter, blond, jugendlich, strahlend im blumig-bunten Sommerkleid, ganz so, wie Charlotte sie beschrieben hatte.
»Kaum wiederzuerkennen, nicht?«
»Nein«, pflichtete Tim gedankenverloren bei, »kaum wiederzuerkennen. – Dein Vater?«
»Ja, das ist mein Vater. Als er starb, brach unsere Welt zum ersten Mal zusammen. Es war sozusagen der tragische Wendepunkt. Von da an ging es nur noch bergab. Ein Unglück kommt selten allein. Weißt du, das Glück ist eine launische Diva. Sie kommt und man heißt sie willkommen, ohne so recht zu wissen, womit man eine solche Ehre verdient hat, und man weiß auch nicht, wie man sich richtig verhält, damit sie bleibt, aber man gewöhnt sich schnell an ihre Gegenwart, viel zu schnell. Und plötzlich geht sie wie ein ungebetener Gast. Hat man sie vielleicht beleidigt, ohne es zu ahnen, fragt man sich ratlos. Aber nein, sie hat eben nur ihre Launen. Und als sie gegangen war, blieben nur Trümmer übrig, die Trümmer unserer heilen Familienwelt, zerbrochen in tausend wertlose Scherben.«
Tim seufzte betroffen.
»Dass ein Mann mit vierzig plötzlich stirbt, hängt in den meisten Fällen mit Krebs, Herzinfarkt oder einem Autounfall zusammen. Nicht so bei meinem Vater. Für ihn gab das Schicksal eine extravagante Sondervorstellung. Eigentlich ist die Geschichte, wie er ums Leben gekommen ist, zu blöd, um wahr zu sein, und wenn sie nicht so traurig wäre, müsste man wahrscheinlich lauthals darüber lachen, so absurd und lächerlich ist sie.« Aber Charlotte lachte nicht, sie wurde nur viel trauriger, und hin und wieder musste sie abbrechen, um ihre versagende Stimme durch einen Schluck kalten Tee zu stärken, während sie erzählte: »Mein Vater war ganz in Ordnung. Er hatte nur, wie alle Männer, einen Tick, der ihn manchmal für die Normalen, das heißt diejenigen, die diesen Tick nicht haben, schwer erträglich machte. Wenn du dich hier umsiehst, errätst du schon, worum es sich handelt.«
»Er war vermutlich ein leidenschaftlicher Jäger.«
»Ja, an der Leidenschaft hat es nicht gefehlt, aber ein guter Jäger wäre aus meinem armen Daddy in tausend Jahren nicht geworden. Die ganzen Trophäen hier an den Wänden – lass dich ja nicht täuschen. Alles gekauft. Er hatte eben diesen Tick. Den ganzen Herbst und Winter rannte er mit so einer albernen Pelzmütze in der Walachei rum, so 'ner Trappermütze mit einem schicken Schweif aus Wolfs- oder Fuchsfell, was weiß ich. Ich glaub', wir haben ihm das Ding mit ins Grab gelegt.«
»Aber er war kein Jäger?«
»Das war sein persönliches Drama: Er hat den Jagdschein abgeben müssen, den er in jungen Jahren gemacht hatte. Er war ein Jäger ohne Knarre, ein Treiber. Jedes Jahr im Herbst finden hier in dieser Gegend Treibjagden statt, um den Wildbestand zu regulieren. Dabei postieren sich die Jäger an der Flanke eines Feldes. Das Gelände vor diesem Feld gehört den Treibern, die wie eine Kette – man nennt das eine Treiberkette – mit lautem Gegröle und Getöse über das Land oder durch den Wald ziehen, um das Wild aufzuscheuchen. Auf freiem Feld lauert der Tod. An der Seite stehen nämlich, quer zur Marschrichtung der Treiber, die ganzen Jäger mit ihren Gewehren. Das aufgescheuchte Wild hat kaum eine Chance. Es läuft in die Falle und wird abgeballert. Manchmal, wenn der Wind günstig steht, laufen die Tiere sogar direkt auf die geladenen Schrotflinten zu, leichte Beute. Aber manchmal erwischt es auch Menschen. Solche Idioten wie meinen Vater, der natürlich keine Treibjagd ausgelassen hat. Weiß der Geier, was ihm eingefallen ist, den Jägern vor die Flinte zu laufen. Irgendwie muss er in einem Waldstück den Anschluss an die anderen Treiber verloren haben – und dann die Orientierung. Vielleicht musste er pinkeln und sein Reißverschluss klemmte, was weiß ich , irgendso'ne saublöde Geschichte. Als er hinter einem Baum am Waldrand hervortrat, flitzte plötzlich vor seiner Nase ein Hase aus dem Wald. Eins zu Null für Daddy. Er hatte den Hasen schließlich aufgescheucht. Und schon ging das Geballer los.«
»Und er – wurde getroffen?«
»Nicht so schnell. Erst mal warf er sich in Deckung. Nun muss man natürlich wissen, was für ein Ehrgeiz und Eifer die Jäger beseelt und welches Konkurrenzdenken. Wer die meisten Abschüsse hat, ist der King. Und King möchte bekanntlich jeder gerne sein. Da reagiert der Finger am Abzug schon mal schneller als das Gehirn. Mein Vater hatte ein wahres Feuerwerk ausgelöst. Alles schoss auf den armen Hasen. Mein Vater lag am Boden und konnte nur hoffen, nicht verwechselt zu werden. Aber er hatte die Rechnung ohne seine saublöde Mütze gemacht! Die ragte nämlich verräterisch aus der Deckung hervor, und das Schwänzchen baumelte lustig hin und her, weil es im Herbst in diesen Breitengraden mitunter ganz schön windig sein kann. Ein paar Jäger haben natürlich mitgekriegt, dass da irgendwas schieflief. Die ganze Sache wäre ja auch nicht richtig tragisch, wenn nicht kurz vor der Katastrophe der rettende Ausweg sich noch aufgetan hätte. Aufgeregte Rufe gellten zwischen den Schüssen durch die Luft, aber sie nützten nichts mehr. Ein übereifriger junger Schnösel aus dem Verbandsnachwuchs, der gerade acht Wochen seinen Jagdschein hatte – mit Bravour bestanden! – und in der Mittagspause schon ein paar Jägermeister gekippt hatte, hielt ihn wohl für einen besonders listigen Fuchs, der sich hinter die Reihen der Jäger davonschleichen wollte, und verpasste ihm einen satten Kopfschuss. Volltreffer! Kein Fuchs hätte das überlebt. Aber was da mausetot mit einem Riesenloch im Kopf am Boden lag, war kein Fuchs, sondern mein Daddy. Selbst der blindeste Jäger konnte den Unterschied sehen. Übrigens ein wahrer Glücksfall für die vorgesehenen Opfer, den flinken Hasen und ein paar aufgeschreckte Eichelhäher. Die nutzten die allgemeine Verwirrung und waren auf und davon. Waidmannsheil!« Charlotte hielt inne und wandte ihren Kopf ab. Tim war bestürzt, nicht nur über ihren Bericht, sondern mehr noch über ihren Sarkasmus. Dann aber sah er, dass ihr Tränen über beide Wangen liefen, was ihn erst recht betroffen und außerdem schrecklich hilflos machte. »Dem jungen Schnösel ... tat das natürlich alles furchtbar leid«, schluchzte Charlotte. »So ein selten blöder Hund!« Sie fing sich wieder, zwang sich zu einem Lächeln und konnte schließlich ihren Bericht zu Ende führen. »Am Ende gab's dann ein höchst feierliches Jägerbegräbnis mit allen Ehren im Stile der Hubertusmesse, und mein Vater wurde von der Jagdhornbläserkapelle höchst traditionsgemäß ›verblasen‹ wie'n totes Karnickel. ›Has is dod‹, ›Fuchs is dod‹, ›Jäger is dod‹. Ich hätte sie alle umbringen können mit ihren verdammten Flinten. Die ganze Zeit auf dem Weg zum Grab mussten Regina und ich Mama stützen. Sie wäre sonst unweigerlich zusammengebrochen. Dann, am Grab, als der Prediger und der Jägerhäuptling vor dem versammelten, fast komplett aufmarschierten Dorf ihren Sermon abgelassen hatten und Mama mit dieser komischen Schaufelattrappe Erde auf den hinabgelassenen Sarg schaufeln sollte, war es so weit. Da konnte sie nicht mehr. Und wir konnten sie nicht mehr halten. Ich werde das nie vergessen. Dieser Schmerz. Sie stolperte, taumelte und sank mit den Knien in den aufgeworfenen Erdhaufen ein. Als sie unter Tränen und aus voller Kehle über den Friedhof schrie: ›Martin! Ich werde dich immer lieben‹, da musste jeder erst mal schlucken, da gefror einem das Blut in den Adern. Es kam einem vor, als würde ihr Schrei durch das ganze Weltall hallen, durch das ganze Weltall!« Tim nickte und schwieg. »Das war 1984. Weißt du noch, das Jahr, wo alle von diesem Orwell-Buch redeten. Drei Jahre später verschwand Regina. Das hat meiner Mutter den Rest gegeben. Sie traf der Schlag – buchstäblich. Zuerst war sie nur eine verzweifelte Frau. Jetzt ist sie ein seelisches Wrack. Und ihr Körper hat diesen Verfall, wie zur sichtbaren Bekräftigung, mitgemacht.« Wieder herrschte Schweigen im Wohnzimmer der Wilhelmsens. »Tut mir leid, ich tische dir hier Geschichten auf, die dich eigentlich gar nicht –«
»Nein, nein, ist o.k., ist schon o.k.«, wehrte Tim ab. »Gab es denn überhaupt keine Hinweise auf Reginas Verbleib?«
Charlotte musste tief durchatmen. »Sie war mit Freundinnen in einer Disco in Kiel. Später sah sie ein Besoffener in irgendein Auto steigen. Eine tolle Spur ...«
»Hm«, machte Tim. »Konnte man denn den Abend nicht irgendwie rekonstruieren?«
»Was willst du da rekonstruieren? Der eine hat dies gesehen, der andere das. Die Polizei hatte am Ende so viele verschiedene Aussagen, wie es Fischsorten im Indischen Ozean gibt. In dem Schuppen herrschte ein Riesengewusel, und die drei Mädels haben sich ziemlich schnell aus den Augen verloren.«
»Der Schuppen, das war das Dream, oder? Warst du schon –?«
»Traum«, fiel Charlotte ihm ins Wort. »Weißt du, manchmal träum' ich nachts davon, wie es früher war, wir, eine glückliche Familie in einem gemütlichen Landhaus mit allem, was man zum Leben braucht, Frühstück zu viert auf der Terrasse an einem herrlichen Sommermorgen, die freie Natur um uns herum, zwitschernde Vögel ... Und wenn ich aufwache, dann braucht es eine ganze Weile, bis ich kapiere, wie die Realität aussieht, wie trostlos sie ist und in welchem eklatanten Gegensatz sie steht zu diesem Traum- oder Wunschbild. Man fragt sich, wie sich Dinge so ändern können, so grundlegend. Manchmal stell' ich mir vor, Papa und Regina kommen zur Tür herein, als wäre nichts gewesen. Regina bringt irgendeinen ironischen Spruch, und Papa gibt Mama einen Kuss und sagt: ›Tut mir leid, Schatz, es ist etwas später geworden!‹ Komisch, nicht?« Tim verspürte wieder diesen Drang, Charlotte an sich zu ziehen. Aber solchen spontanen Impulsen nachzugeben war seine Stärke nicht. Er sah sie stattdessen lange an und sagte schließlich: »Ich muss gehen.«
»Was willst du denn jetzt tun? Zur Polizei?«
»Ja, muss ich wohl.«
»Bitte geh nicht zur Polizei.«
»Warum nicht?«
»Wegen Mama. Die werden kommen und die ganze Geschichte wieder aufwühlen. Ich weiß nicht, ob Mama das verkraften würde.«
»Naja, ich habe die Polizei bis jetzt nicht informiert, weil die Sache ja wohl keine Eile hat. Aber irgendwann, denke ich, wird sich das nicht mehr umgehen lassen.«
»Ich habe noch eine Bitte«, sagte Charlotte. »Ich möchte gern die Knochen haben.«
»Die liegen noch in der Uniklinik. Aber ja, du ... kannst sie haben. Ich, ähm, werde sie dir besorgen.«
»Und noch was«, bat sie.
»Ja?«
»Ich möchte, dass du mich über alles auf dem Laufenden hältst, was du über Regina herausfindest. Wirst du das tun?«
»Ich verspreche es«, sagte Tim.
Als Tim das Haus der Familie Wilhelmsen hinter sich gelassen hatte, überkam ihn ein regelrechter Schüttelfrostanfall. Da verbringt man also ein paar Jahrzehnte seines Lebens in Freude und Unbekümmertheit, und auf einmal überfällt einen das Schicksal mit solcher Wucht, dass selbst Hamlet seines dagegen nicht hätte tauschen mögen. Man kann derartige Dinge so wenig aufhalten wie den Sonnenuntergang am Ende eines jeden Tages. Tim fiel dieser Vergleich ein, weil er der Abendsonne genau entgegenfuhr. Ihre Strahlen fielen durch die Windschutzscheibe in seinen Wagen und hatten wegen ihrer Blendwirkung etwas entschieden Feindliches. »Du lässt Nacht werden und du bringst an den Tag«, sagte Tim. »Sollte ich mich stören an deinem Licht?«