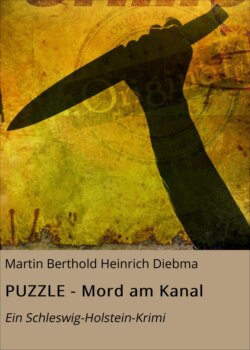Читать книгу PUZZLE - Mord am Kanal - Martin Berthold Heinrich Diebma - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Bürger X
ОглавлениеAbgeschieden war fast noch geschmeichelt. Das alte Bauernhaus, das Tim sein Eigen nennen durfte, wirkte von einem erhöhten Standpunkt aus betrachtet wie eine einsame Schaluppe in den Weiten des Ozeans. Das Grundstück war einen halben Hektar groß. Zum Hof, der vor vielen Jahrzehnten nach damaliger Sitte mit Kopfstein gepflastert worden war, gehörte auch eine gewaltige Scheune. Das Kopfsteinpflaster machte sich vor allem in Form von ein paar riesigen Schlaglöchern bemerkbar, wenn Tim im Auto saß.
Er fuhr seinen blauen Escort, Baujahr 1985, vor die Hofeinfahrt, die durch eine lange Kette abgeriegelt und so breit war, dass früher ein Mähdrescher durchgepasst hatte. Dann stieg er aus, um die Kette zu lösen, die am linken und rechten Rand der Einfahrt an kleinen Metallpfeilern befestigt war. Von denen steckte einer nur lose in der Erde. Er konnte mühelos herausgezogen werden, wodurch sich die Kette sofort der Länge nach senkte. Das war der ganze Trick – kein Schloss, kein magisches »Sesam, öffne dich«. Im Grunde war diese alte, rostige Kette vollkommen unnötig. Wer sollte in diesem entlegenen Winkel schon daherkommen und Tims Hof als Parkplatz zweckentfremden? Noch weniger stellte die Kette ein besonders aufsehenerregendes Hindernis für Eindringlinge anderer Art dar. Aber Tim liebte es nun mal, sich von der Außenwelt abzuschotten, und sei es nur symbolisch. Sein Wagen befand sich nach einigen Metern mitten auf dem Hof, genau zwischen dem großen Wirtschaftsgebäude und einer recht baufällig wirkenden alten Scheune. Das Haus hatte zwei Eingänge: die Haustür auf der Frontseite und den Zugang über die Diele, markiert von einem mehrere Meter breiten und hohen, an der Oberseite gewölbten, von Holzwürmern zerstochenen Tor, das vor etlichen Jahren einmal rostbraun gestrichen worden war. Die Scheune gegenüber war wie das Bauernhaus von einem nicht mehr ganz wasserundurchlässigen Blechdach bedeckt, das den Großteil seiner rostbraunen Farbe zwar dem vor allem in Form von Regen unaufhörlich nagenden Zahn der Zeit hatte opfern müssen. Aber das wäre selbst den Vögeln in der Luft, die gelegentlich dort Zwischenstation machten, nicht aufgefallen (wenn es sie interessiert hätte). Denn wo die Farbe abgeblättert und das nackte Metall zum Vorschein gekommen war, hatten alltägliche chemische Prozesse die Lücke im Nu mit einem natürlichen Rostbraun geschlossen. Diese alte Scheune, in deren hinterem Teil noch gammelige Heu- und Strohballen aus längst vergangenen Tagen lagerten, diente Tim als Garage, und er hatte eine Methode entwickelt, seinen Wagen, und zwar rückwärts, so darin zu parken, dass er nie von einem einzigen Tropfen Wasser behelligt wurde, das sonst an erstaunlich vielen Stellen durch das Dach eindrang. Tim liebte das Alte, das Ursprüngliche, Unveränderte und Unverwüstliche, und so hatte er seit seinem Einzug mit achtzehn Jahren den Hof im Wesentlichen so belassen, wie er ihn nach dem Tod des Großvaters vorgefunden hatte, soweit es sich nicht um renovierungsbedürftigen Wohnraum handelte. Sogar eine alte, verrostete Egge lag noch in einer Ecke der Scheune. Tim hatte den Versuch, das rostige alte Ding zu veräußern, von vornherein als aussichtslos eingestuft. Der eigentliche Clou aber war ein alter Pferdepflug, natürlich ohne Pferd, dafür aber mit antikem Charme. Tim störten die alten Geräte nicht. Für sein Auto blieb ja genug Platz in der geräumigen Scheune, die übrigens fast so hoch war wie das Wohnhaus gegenüber, das unter dem Dach noch über einen alten Heuboden verfügte. Nachdem Tim den Wagen gewohnheitsgemäß abgestellt und das Scheunentor verriegelt hatte, stand er im Hof dem rustikalen Dielenportal des Bauernhauses gegenüber. Doch das Tor blieb, obwohl die lange Diele dahinter an den ehemaligen Kuhställen vorbei zu Tims Küche führte, immer verschlossen. So ziemlich alles an ihm klemmte nämlich, sowohl das Portal an sich als auch die kleine darin eingeschnittene Tür normaler Größe. Nichts ließ sich hier ohne übermenschliche Kraftanstrengung und ohrenbetäubendes Knarren oder Quietschen öffnen, und als es zum letzten Mal dennoch jemand gewagt hatte, hatte man sich des beunruhigenden Gefühls, durch diesen Gewaltakt das ganze Haus zum Wackeln gebracht zu haben, nur mühsam erwehren können. Es schien sich zu empören wie ein Greis, den man in den Krieg schicken wollte, oder noch eher wie ein Geist, den man zur Unzeit aus seiner wohlverdienten Totenruhe aufgeschreckt hatte. Also ließ Tim lieber die Finger davon. Es blieb verschlossen, und man brauchte es auch nicht weiter zu sichern. Jeder Einbrecher hätte sich, da sich der Gebrauch von Motorsägen bei Einbrüchen in bewohnte Häuser aus verschiedenen Gründen verbietet, an dem Tor vermutlich die Zähne ausgebissen. Abgesehen davon konnte es auch keinen Einbrecher geben, der schlecht genug informiert war, um in Tims Haus etwas so Wertvolles zu vermuten, dass er die Strapazen und Risiken eines Einbruchs auf sich nehmen würde. Zu schlicht, zu bescheiden und zu unauffällig war Tims Lebensstil. Ein Blick in Tims Kleiderschrank genügte, um das festzustellen: Viereinhalb Hosen, eine dazu passende Anzahl an aus der Mode gekommenen Pullovern, ein paar schlichte und ein paar karierte Hemden, ein paar farblose T-Shirts sowie Socken und Unterwäsche für ein bis zwei Wochen, sofern man sie spätestens jeden zweiten Tag wechselte, ließen seinen Kleiderschrank nicht gerade überborden. Hinzu kamen ein zeitloser schwarz-brauner Anzug, ein Erbstück seines Großvaters (alle anderen hatte er dem Roten Kreuz vermacht), den er gleichermaßen zu Hochzeiten und Beerdigungen oder vergleichbaren feierlichen Anlässen zu tragen pflegte, nebst passender dunkelbrauner Krawatte sowie – für die Arbeit – zwei völlig identische graubraune Jacketts. Drei Paar Schuhe – für alltags eins, für feiertags eins und für den Sport (früher mal) eins – und ein Paar Stiefel – für den Winter – machten sein Schuharsenal aus. Tim war ein Pragmatiker. »Ich hab' alles, was ich brauch'«, konterte er despektierliche Anfragen. »Mehr kann ich gar nicht auftragen.« Bis ein Kleidungsstück »aufgetragen« war, das konnte in der Tat Jahre dauern. Bei den ersten Verschleißerscheinungen wurden erst mal Flicken bemüht und jede Möglichkeit zur Instandsetzung ausgeschöpft – wie gesagt, er hing am Alten und hätte am liebsten alles erhalten –, ehe endlich eine Neuanschaffung ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. »Für das Geld kann man lieber Hundefutter kaufen.« Das war zweifelsohne auch Canos Ansicht. Und wen hätte Tim sonst nach seiner Meinung fragen sollen? Tim Schlüter war ein rationeller Mensch, im komplettesten Sinn des Wortes. Moden, Trends und ungeschriebene Gesetze kümmerten ihn nicht. Selbst die der Höflichkeit beachtete er nicht immer. Er glaubte, kurz gesagt, nicht an Relatives. Tim Schlüter befand sich in einer beneidenswerten Freiheit. So fasste er es jedenfalls auf. Und diese Freiheit erfüllte sein Inneres an manchen Tagen mit ausgesprochen guter Laune.
In eben dieser Laune betrat Tim schließlich durch die Haustür an der Frontseite seines Anwesens, die in ihrer ganzen Breite zur Straße hin zeigte, sein Heim. Von der Straße aus betrachtet, wirkte das Haus jünger, als es der Wahrheit entsprach – war der Wohntrakt des Hofes doch vor fünf Jahren komplett erneuert worden. Die Fassade sah aus wie die eines zu lang geratenen Einfamilienhauses mit den für diese Gegend Deutschlands so typischen dunkelroten Backsteinen. Die Haustür war aus massiver Eiche; gleichmäßig traten große Quadrate ein paar Zentimeter aus ihr hervor, an den Rändern leicht verziert; vor ihr ein einfacher Tritt aus Beton und Fliesen und ein etwa zehn Meter langer Gehweg, der zur Pforte im eisernen Gartenzaun führte, der das Grundstück von der Straße abschloss. Dieser Gehweg aus demselben alten Kopfsteinpflaster wie der Hof durchschnitt eine große, grüne Fläche Wildwuchs: Tims Garten. Er mähte den Rasen nur zwei bis drei Mal im Jahr mit einer Sense. Und so glich er mehr einer Wiese als dem, was man gemeinhin unter einem Rasen versteht. Aber Cano liebte ihn so. Und wen sonst ging der Rasen etwas an? An allen Rändern des Gartens und des Hofes wuchsen außerdem noch jede Menge wilder Sträucher. Mächtige Nadelbäume sowie ein paar Obstbäume umrahmten das ganze Grundstück. Zum Glück ließen die hohen Lärchen hinter dem Haus genügend Lücken, um den Blick auf die hinter ihnen liegenden endlosen Äcker zu erlauben, auf das leicht gewellte weite Land, das zwar zum Teil auch noch zu Tims Erbschaft gehörte, aber sinnvollerweise an Landwirte aus der Nachbarschaft verpachtet war und erst bei dem Fichtengehölz am Horizont endete. Aus Tims Schlafzimmerfenster im Obergeschoss hatte man einen fabelhaften Ausblick auf dieses Land, das vor allem im Morgengrauen wunderschön anzuschauen war, wenn wie jetzt im Oktober über die riesigen, halbtransparenten, über die Felder gespannten Laken von herbstlichen Dunstschwaden langsam die Sonne ihr strahlendes Angesicht erhob und alles in ein gleißendes Orangerot tauchte. Dann hielt es Tim auch an freien Tagen manchmal nicht länger im Bett, von Cano ganz zu schweigen, und gemeinsam stürzten sie aus dem Haus, über den Hof, unter Fichten- oder Lärchenzweigen hindurch auf die feuchten Wiesen oder tiefschwarzen, vom Pflug aufgerissenen Äcker, in deren aufgeweichtem Boden sie tiefe Spuren hinterließen, dem Sonnenlicht im Osten entgegen. Wie konnte man in einem solchen Augenblick nicht glücklich sein?
Doch andere, finsterere und weniger heitere Gedanken beschäftigten Tim, der mit Cano in seinem großen Wohnzimmer Platz genommen hatte, dessen einziger nennenswerter Reichtum eine schier unermessliche Anzahl von Büchern in endlosen Regalen war. Wenn Freyas Hypothese, die ja im Prinzip auch die seine war, stimmte, dann ging es um einen brutalen, mit unerbittlicher Konsequenz und menschenverachtender Grausamkeit erfolgreich vertuschten Mord. Bei diesem Gedanken musste Tim in seinem tiefen Ledersessel erst mal tief durchatmen. Nach einer Weile stand er auf, um den goldenen Anhänger noch einmal genau zu betrachten, den er auf seinem Schreibtisch verwahrte. Damit musste doch was anzufangen sein. Irgendjemand musste dieses Ding kennen. Was bedeutete »Regina«? War es einfach nur »Königin« auf Lateinisch? Vielleicht nur ein Firmenname? Oder war Regina die Leiche? Oder lebte Regina noch und konnte einen Hinweis auf den Toten oder den Täter oder beides geben? Auf jeden Fall war dieses goldene Schmuckstück eine wertvolle Spur, vielleicht die wichtigste in diesem Fall. Tim war entschlossen, sie mit äußerster Verbissenheit zu verfolgen.
Gegen acht Uhr abends öffnete Tim eine Dose Ravioli und gab Cano knapp die Hälfte davon ab. Er entspannte sich ein paar Stunden vorm Fernseher und ging schließlich, mit Cano im Gefolge, zu Bett. Nachts träumte er von Freya, die, natürlich ganz in Weiß, mit einem Totenschädel Fußball spielte und einen Treffer nach dem anderen erzielte. Im Tor stand nämlich er, Tim, und sie rügte ihn mit ironisch erhobenem Zeigefinger: »Timmi, Timmi, Timmi! Was machst du bloß für Sachen? Du musst aufpassen. Du musst besser auf den Ball aufpassen!«, während der einzige Zuschauer, Cano, nicht aufhörte zu bellen. Solche Dinge passieren, wenn man tagsüber mit einem Beutel Menschenknochen ins Krankenhaus fährt und abends Das aktuelle Sportstudio guckt.
◊
In ungeduldiger Erwartung verbrachte Tim die nächsten Tage. Abgelenkt ging er seiner Arbeit nach. Am Montag und Donnerstag fuhr er in den Verlag und hinterließ dort bei den Kollegen einen noch verschlosseneren Eindruck als ohnedies schon. Sie kannten und schätzten ihn als zügigen, zuverlässigen Arbeiter mit einer angemessenen Portion trockenen Humors. Ansonsten gab er sich ihnen gegenüber norddeutsch kühl und reserviert, mitunter geradezu unnahbar. Außerberuflichen Aktivitäten, geselligen Abenden oder der alljährlichen Weihnachtsfeier, blieb er konsequent fern. Er sagte dann für gewöhnlich, er wohne zu weit weg und wolle seinen Hund nicht so lange allein lassen. Und das stimmte ja auch.
An diesem Donnerstag verblüffte er ein paar von ihnen allerdings mit der Frage, auf wie alt sie einen Kochen schätzen würden, den sein Hund im Wald aufgestöbert habe. Dabei hielt er ihnen einen kleinen Fingerknochen aus seinem Fund unter die Nase, den er in seiner Hosentasche stecken hatte. »Keine Ahnung«, war der Tenor, »wozu willst 'n das wissen?« »Das hängt davon ab, wo er die ganze Zeit gelegen hat.« »Und davon, wie viele Hunde ihn vorher im Maul hatten.« Einer meinte: »Sieht aus wie von einem menschlichen Finger. Du solltest das mal von einem Experten begutachten lassen.«
»Quatsch!«, sagte Tim. Nicht von einem Experten, sondern von einer Expertin. Das sagte Tim nicht.
Die Expertin rief endlich am Freitag an. »Timmi?«, begann sie. »Aller Wahrscheinlichkeit nach stammt der Arm von einer jungen Frau, vielleicht zwanzig, vielleicht jünger, kaum älter. Etliche Jahre vor ihrem Tod hat sie sich, wie ich schon sagte, einen Bruch zugezogen, der Mittelhandknochen des Mittelfingers muss dabei ziemlich heftig zersplittert sein, und sie hat mindestens einen Monat lang einen Gipsverband tragen müssen. Daran wird sich ja vielleicht noch jemand erinnern. Wie stehen denn die Ermittlungen?«
»Hm«, antwortete Tim. »Und wie lange hat der Arm da gelegen? Lässt sich dazu nichts sagen?«
»Also, da kann man vorläufig nur schätzen. Wenn man davon ausgeht, dass der Arm die ganze Zeit unter der Erde gelegen hat –«
»Geh mal davon aus.«
»O.k., dann höchstens fünfzehn, mindestens zehn Jahre, würde ich sagen.«
»Sehr vage«, murmelte Tim in den Hörer.
»Tut mir furchtbar leid, dir nicht besser zu Diensten sein zu können«, empörte sich Freya. »Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie einige Leute mich hier angeguckt haben, als ich mit deinen komischen Knochen ankam? Glaubst du vielleicht, man kann hier mal schnell einen Radio-Karbontest durchführen und keiner runzelt die Stirn?«
»Naja, ich dachte, an einer Uni-Klinik« – Tim sprach das Wort Uni aus, als wäre es ein Nobelpreisträger – »wird doch sowieso ständig gelehrt und geforscht. Und Studenten müssen Tests –«
»Ich hab' irgendwelche Krimi-Märchen erfunden«, unterbrach Freya ihn, »über einen mit besonderen Befugnissen ausgestatteten Zivilermittler. Ich musste für dich lügen!«
»Wieso? Das stimmt doch. Ich ermittle und benehm' mich stets zivilisiert.«
»Sehr lustig. Hast du wenigstens schon die Polizei informiert?«
»Was denn, sind die noch nicht bei dir gewesen? Da sieht man mal, wie die arbeiten. Also, ich bin dir was schuldig.«
»Was denn?«
»Na, Dank, 'ne Menge Dank. Ich komme irgendwann und befreie dich auch wieder von der Last der Knochen.«
»Die kriegt dann wohl dein Hund?«
»Für meinen Hund? Nein, wo denkst du hin? Nur für mein persönliches anatomisches Gruselkabinett.«
Tim setzte sich wieder in seinen Lieblingssessel und dachte nach. Manchmal dachte er auch laut, und Cano spitzte andächtig die Ohren, als folge er irgendwelchen nur für ihn bestimmten, wichtigen Instruktionen. »Wir müssen zunächst mal herausfinden, wem der Arm gehört. Gehört hat. Angenommen, die Person ist tot, was ja mehr als wahrscheinlich ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Umstände ihres Todes für Aufsehen gesorgt haben. Angenommen, sie ist entführt worden, plötzlich verschwunden, dann ist sie sicher irgendwann als vermisst gemeldet worden. Und wenn der Rest der Leiche genauso wenig aufgetaucht ist wie dieser Arm, dann heißt das, sie ist immer noch als vermisst gemeldet. Aber das polizeiliche Verfahren wurde natürlich längst eingestellt. Oder es ruht. Denn es gibt ja schon längst keine neuen Hinweise mehr. Es hilft alles nichts, wir müssen rausfinden, von wem dieser Arm stammt. Vielleicht wurde irgendwann mal jemand mit dem Namen Regina vermisst gemeldet. Verdammt, Tim, streng dich an, so ein Fall, der geht doch durch die Presse. War da denn nichts? Vor mindestens zehn Jahren ... Ich war Student oder Schüler ... Regina ... Regina ... Aber wir wissen ja nicht, dass der Name der Person wirklich Regina ist. Nennen wir sie einfach X. Wir nehmen mal an, Cano, X stammt aus Schleswig-Holstein. Wenn X in Schleswig-Holstein vermisst gemeldet und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nach X gesucht wurde, dann lässt sich darüber mit Sicherheit auch heute noch was finden. Zum Beispiel ... in der Zeitung!«
◊
Am Montag fuhr Tim nicht nach Hamburg zum Verlag, sondern nach Kiel in die Universitäts- und Landesbibliothek. Er ließ sich ins Magazin führen und suchte angestrengt in den auf Mikrofiche kopierten Seiten der Kieler Nachrichten nach einer Spur. Die KN war die größte Zeitung des Landes, und wenn in Schleswig-Holstein vor zehn bis fünfzehn Jahren ein Mädchen verschwunden war, so fand sich dazu bestimmt ein Hinweis. Tim ging systematisch-logisch vor. Er begann am 1. Januar 1985, das heißt vierzehn Jahre und zehn Monate in der Vergangenheit und damit ziemlich genau am Anfang des Zeitraums, der laut Freya in Betracht kam. Zunächst einmal interessierte ihn nur die Titelseite jeder archivierten Ausgabe. Sorgfältig las er alle Schlagzeilen, auch die kleineren, am Rande versteckten. Fiche um Fiche zückte er aus dem Kästchen in der breiten Schublade neben ihm, legte es zwischen die beiden Glasscheiben und schob es in das Lesegerät ein. Stunde um Stunde verbrachte er so in einer fieberhaften Anspannung und bemerkte kaum, wie die Zeit verrann. Er war versunken in eine Welt, in der die Raum- und Zeitgesetze andere waren, als die ihn umgebenden gegenwärtigen, ein Universum komprimierter Geschehnisse und Geschichten. Und er nahm nichts um sich herum mehr wahr. Seine ganze Konzentration galt den Ereignissen längst vergangener Tage, in denen Menschen wie Helmut Kohl, Ronald Reagan, Michail Gorbatschow, Khomeini, Ghadhafi, Rudi Völler, Steffi Graf oder Boris Becker für die größten Schlagzeilen sorgten und der Schock von Tschernobyl noch sehr tief saß.
Hungergefühle machten sich erst auf dem Heimweg im Wagen bemerkbar, nachdem Tim sein selbstauferlegtes Tagespensum bewältigt hatte. Verwundert fragte er sich, wie er den ganzen Tag lang ohne Essen hatte auskommen können. Als er am Abend zu Hause die Nachrichten einschaltete, stutzte er einen Augenblick, dass keine der schlagzeilenträchtigen Vorkommnisse und Verwicklungen, Geschichten und Gestalten, mit denen er den Tag verbracht hatte, hier auch nur mit einer Silbe erwähnt wurden. Sie hatten so kontinuierlich auf seine Wahrnehmung eingewirkt, dass sie noch jetzt als lebende Bilder vor seinem geistigen Auge standen. Es war alles längst historischer Ballast geworden. Einiges war es wert, Eingang in die Geschichtsbücher zu finden, das meiste aber war in den Sumpf des Vergessens gewandert. Vergänglich und vergesslich war die Welt. Und auch X war wohl von den meisten vergessen worden.
Nachts träumte Tim wieder schlecht. Diesmal verfolgte ihn ein unheimliches Wesen, das er niemals zu Gesicht bekam, und doch war es da, unsichtbar, unberührbar zwar, aber trotzdem erschreckend real. Und er wurde das Biest nicht los. Tim hatte sich für seelisch etwas robuster gehalten und war überrascht davon, wie leicht sich seine Psyche offenbar aus dem Gleichgewicht bringen ließ. Mit acht oder neun Jahren, vor der Scheidung seiner Eltern, hatte er heimlich Psycho, Die toten Augen von London und sogar Gruselfilme mit Dracula oder Frankenstein gesehen, aber von irgendwelchen Alpträumen deswegen keine Spur. Zumindest konnte er sich an keine erinnern, nie. An die Alpträume, die er seit Canos Fund im Wald hatte, erinnerte er sich dagegen unerfreulich gut. Hier war die Wirkung auf sein Unterbewusstsein von ganz anderer Qualität. Es fehlte nicht viel und er würde noch seinen Freud aus dem Regal ziehen. Vielleicht zeigte sich darin aber auch nur der sehr erhebliche Unterschied zwischen Film und Wirklichkeit.
◊
Wo steckt Regina? Als Tim am dritten Tag seiner langwierigen und ermüdenden Tätigkeit im Zeitungsarchiv auf diese fett gedruckte Textzeile über einem Foto stieß, das eine vermisste und übrigens bildschöne Schülerin zeigte, fuhr ihm ein Blitz in die Glieder, der den inneren Jubelruf des Erfolges sofort verdrängte. Fast jeder kennt es, dieses seltsame Gefühl, etwas schon mal erlebt oder gesehen zu haben, ganz so oder zumindest ganz ähnlich, wie es sich jetzt – zum vermeintlich wiederholten Male – zuträgt oder zeigt. Psychologen bezeichnen diesen Effekt als Déjà-vu-Erlebnis. »Schon mal gesehen«, wenn man, verdammt noch mal, nur wüsste, wo; bekannt, wenn man, verdammt noch mal, nur wüsste, woher! Aus dem Fernsehen, einem Traum oder sogar aus einem früheren Leben? Jedenfalls hatte Tim genau so ein Gefühl beim Anblick des hinreißenden Mädchengesichts von Regina Wilhelmsen, die auf dem Foto vielleicht fünfzehn, sechzehn Jahre alt sein mochte. Das Bild befand sich in der Mitte der unteren Hälfte einer KN-Titelseite. Kaum dass er es erblickt und ohne dass er ein Wort gelesen hatte, überkam ihn eine instinktive Gewissheit, dass das eine heiße Spur war. Hastig las er den kurzen Text durch, der zu dem Foto gehörte.
Kiel. Seit vergangenem Samstag wird die achtzehnjährige Regina Wilhelmsen vermisst. Die Schülerin hatte sich Ermittlungen der Kripo Kiel zufolge gegen Mitternacht von der Diskothek »Dream« allein auf den Weg zurück zum elterlichen Haus bei Felixdorf gemacht, ist dort aber bis heute nicht angekommen. Regina trug eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe der Marke Puma und einen schwarzen Wollpullover mit großen lila und grünen Karos, darüber eine beigefarbene Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise über Reginas möglichen Verbleib. Bitte wenden Sie sich an die für ihren Bezirk zuständige Dienststelle, oder wählen Sie die Rufnummer ...
Im Regionalteil fand Tim eine genauere Beschreibung der Umstände von Reginas rätselhaftem Verschwinden, den Namen des Inhabers der Diskothek, ein Foto des Hauses der Familie Wilhelmsen und weitere Hintergrundinformationen. So erfuhr er, dass Reginas Vater bereits tot war, als sie verschwand, dass sie eine Schwester namens Charlotte hatte und dass ihre Mutter Vera hieß. Letztere wurde mit einigen Aussagen über das Wesen ihrer älteren Tochter zitiert. Voller Lebenslust und Energie sei sie gewesen. Intensiv studierte Tim die nachfolgenden Ausgaben der Zeitung, aber es fanden sich nur noch drei kurze Meldungen, die wenig Neues brachten. Die erste, vom 2. Dezember 1987, trug den Titel: Noch keine Spur im Fall Wilhelmsen, die zweite, vom 5. Dezember, berichtete über Erste Hinweise im Fall Wilhelmsen und handelte von einem jungen Mann, der gesehen haben wollte, wie Regina in einen Wagen eingestiegen sei, sich aber weder an Farbe noch Fabrikat, noch Fahrer, noch an sonst irgendetwas von Belang erinnern konnte. Schließlich teilte die Zeitung am 10. Dezember unter der Überschrift Suche eingestellt mit, dass die Polizei – na, man kann sich ja denken, was. Ein Polizeisprecher wurde mit der Äußerung zitiert, es gebe einfach zu wenig Anhaltspunkte für eine zielorientierte Suche. Man könne schließlich nicht das ganze Land durchkämmen. Auch sei es ja durchaus möglich, dass Regina noch am Leben sei und sich einfach irgendwohin abgesetzt habe, was gerade bei jungen Menschen unerklärlicherweise immer wieder vorkomme. So oder so hoffe man aber nach wie vor auf Hinweise aus der Bevölkerung, die auch nach Jahren noch wertvolle Erkenntnisse bringen könnten.
Der meint wohl mich, dachte Tim. Ansonsten schienen die wertvollen Erkenntnisse weitgehend ausgeblieben zu sein, wie Tim feststellte, als er weitere Mikrofiches einschob. Er konnte förmlich spüren, wie angesichts der schlechten Hinweislage Presse und Öffentlichkeit rasch das Interesse an dem Fall Wilhelmsen verloren, und alles sprach dafür, dass er ergebnislos zu den Akten gelegt worden war.
Trotz alledem, so wusste Tim, war es bisher nicht mehr als eine Annahme mit gewissem Wahrscheinlichkeitsgrad, dass es sich bei seinem rätselhaften Fund tatsächlich um Knochen der vermissten Regina Wilhelmsen handelte. Er schrieb sich ein paar wichtige Daten und Informationen ab, dann verließ er im Laufschritt die Bibliothek. Im Auto kramte er seine alte Schleswig-Holstein-Karte aus dem Handschuhfach hervor und suchte sie ganze zehn Minuten lang Planquadrat für Planquadrat, Millimeter für Millimeter nach einem bestimmten Namen ab. »Da«, rief er schließlich in der Lautstärke eines Jubelschreis und so überraschend aus, dass Cano, der sich gerade wieder auf der Rückbank hingelegt hatte, zusammenzuckte, »da ist es!« Sein Finger zeigte auf einen kleinen Punkt, daneben stand in winzigen Buchstaben: Felixdorf.
◊
Felixdorf lag nordwestlich von Kiel und war in der Tat so winzig, wie es die Buchstaben auf Tims detaillierter Schleswig-Holstein-Karte vermuten ließen. Kaum mehr als hundert Häuser, fast allesamt an einer einzigen, miserabel gepflasterten Straße gelegen, die sich durch den Ort zog, machten ihn aus. Tim fuhr selbige im vorsichtigen Schritttempo entlang, seinen Kopf abwechselnd nach links und nach rechts wendend, auf der Suche nach jenem Haus, dessen Bild er in der KN vom 30. November gesehen und sich aus dem Original fotokopiert hatte. Aber er kam zu jenem gelben Schild mit dem dicken, roten Strich, das überall in Deutschland das Ende einer geschlossenen Ortschaft markiert, ohne fündig geworden zu sein. Missmutig fuhr er weiter. Hinter einer scharfen Kurve, in der die Fichten eines beidseitig angrenzenden Waldstücks sich so weit über die Straße krümmten, dass ihr beinahe jegliches Tageslicht genommen wurde (weshalb auch ein Tempolimit 30 zur Vorsicht aufforderte), hinter dieser Kurve kam eine lange, geradlinige Allee ins Blickfeld, die zu dieser Jahreszeit mit den sich nussbraun, goldgelb und rötlich verfärbenden Blättern besonders malerisch wirkte. Eingehüllt in diese Farbenpracht, fuhr Tim weiter. Nach weniger als zwei Kilometern kam er an einer Einmündung auf der rechten Seite vorbei, die, wie er sich durch einen raschen Blick vergewisserte, zu einem ebenfalls alleenartigen – von Pappeln und Birken gesäumten – Privatweg gehörte, an dessen Ende ein kleines Landhaus sich erhob, dessen Weiß sich mit beigen und grauen Flecken herumschlagen musste und dessen Reetdach von grünen Moosflächen überwuchert war, die man sogar aus der Ferne wahrnehmen konnte. Und trotzdem sah dieses bescheidene Anwesen stolz, geradezu kühn aus, als wolle es der Einsamkeit der ansonsten weit und breit unbesiedelten und in schwermütiger Herbsttrübe daliegenden Landschaft ein wenig heiteres Leben abtrotzen – ein zum Scheitern verurteilter Versuch, wenn man die Stimmung im Innern des Hauses kannte. Denn die war um ein Vielfaches trüber, als ein Herbsttag in Norddeutschland jemals sein kann. Seit Jahren führten Schmerz und Trauer hier ein unbarmherziges Regiment und ließen sich nicht aus dem Amt jagen.
Tim hatte sein Auto in der Nähe der Zufahrt zwischen Asphalt und Straßengraben abgestellt. Über ihm wehte der Wind aus der Krone einer gewaltigen Buche bunte Blätter. Er ging ein paar Meter und stand jetzt mitten auf dem schmalen Weg, einer asphaltlosen Sandpiste, die vor allem in der Mitte, wo keine Autoreifen hinkamen, von Unkraut bewachsen und nicht gerade arm an Löchern und Unebenheiten war. Von hier aus blickte er geradewegs auf den dunklen Haupteingang in der Mitte des hellen Hauses am Ende der Zufahrt. Er war noch etwa hundert Meter von ihm entfernt und sah es sich genau an. Dann sagte er zu seinem besten Freund, der neugierig schnuppernd neben ihm im Wind stand: »Wollen wir da wirklich hin, Cano?«
In der Gewissheit eines Erfolges, den einem keiner mehr nehmen kann, ergreift manche Menschen kurz vor der Ziellinie eine unerwartete Gelassenheit und Geduld. Fast fertige Prüfungen werden in verlangsamtem Tempo zu Ende gebracht, die letzten Seiten eines Buches gelesen wie in Zeitlupe oder nach einer langen Reise im eigenen Auto die Geschwindigkeitsbeschränkung nach dem Passieren des heimatlichen Ortsschilds penibler beachtet als jemals zuvor. Vielleicht wurden aus diesem oder vergleichbarem Grunde schon Weltrekorde verpasst, Matchbälle verschlagen, Siege aus der Hand gegeben. Denn wenn etwa ein Sprinter bei einem internationalen Vergleich seiner Konkurrenz allzu überlegen ist und seine Gegner weit abgeschlagen hinterherhängen, während er sich siegessicher und souverän der Ziellinie und seiner Siegeskrone nähert, dann ist es schwer, noch das Äußerste aus sich herauszuholen. Vielleicht lässt man nach, um das Gefühl des Triumphs zu verlängern, um den Sieg auszukosten, vielleicht ist es Überheblichkeit, die den Sprinter denken lässt, er könne nun auch mit halber Kraft gewinnen, oder es ist Nervosität angesichts der Größe des Ereignisses, über die er plötzlich Zeit hat nachzudenken, vielleicht ist es auch nur das instinktive Bedürfnis, Kräfte zu sparen, sich ein wenig zu schonen, da der Sieg einem nicht mehr genommen werden kann. Aber die gleiche Höchstleistung wie bei einem Kopf-an-Kopf-Duell wird es nicht geben. Etwas in der Art muss, wenn es nicht einfach Angst war, in Tim vorgegangen sein, nachdem er das Haus der Wilhelmsens gefunden hatte. Es hatte auf dem Foto in der Zeitung natürlich anders ausgesehen, nicht so abgelegen gewirkt, und von einem so feudalen Grundstück war gar nichts zu sehen gewesen, aber es war eindeutig zu identifizieren. Tim wusste sich am Ziel, an einem ersten Ziel. Er hatte einen Etappensieg errungen, nahm er an, den ihm keiner mehr nehmen konnte. Aber es drängte ihn keineswegs, seine Hypothesen an realen Gegebenheiten, sicheren Fakten, lebenden Personen zu verifizieren. Vielmehr hatte er das Gefühl, sich jetzt erst mal bequem zurücklehnen oder mit Cano in aller Ruhe einen Spaziergang machen zu können. Warum sofort mit den Leuten sprechen? Das hatte Zeit. Das Haus konnte ja nicht weglaufen. Tim war, wie schon erwähnt, ein rationeller Typ, und er wusste, es machte wenig Sinn, bei den Wilhelmsens mit der Tür ins Haus zu fallen. Was er fragen und was er seinerseits von seinem Wissen preiszugeben gedachte, das wollte vorher wohl überlegt sein.
Natürlich war auch eine gehörige Portion Unbehagen im Spiel. Denn jetzt wurde es ernst. Tim, an sich schon nicht als Menschenfreund verschrien, musste mit Leuten reden, die er nie zuvor gesehen hatte, und ihnen, wenn es dazu kommen sollte, auch noch eine vielleicht nicht unerwartete, aber dadurch doch nicht minder erschütternde Mitteilung machen. Die Wahrheit kann furchtbar weh tun, denn im Gegensatz zur Lüge biedert sie sich niemals auf Grund irgendwelcher Umstände bei den Menschen an. War er sich im Klaren darüber, worauf er sich eingelassen hatte und welche Verantwortung er trug als Selfmade-Ermittler, mehr noch: als Bote des Todes? Bei solchen Aussichten rückten andere Dinge, die erledigt werden wollten, auf einmal ganz schnell wieder ins Blickfeld.