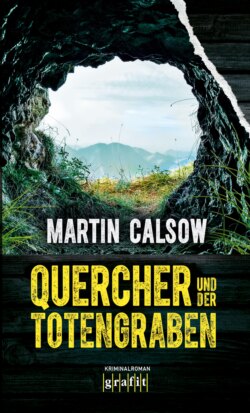Читать книгу Quercher und der Totengraben - Martin Calsow - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBei Kreuth, vier Jahre zuvor
Der Berg wollte ihn fressen, mit einem Reißzahn aus Kalkstein ein Stück aus seinem Leib trennen. Der Mann atmete so flach wie möglich. Es schien ihm, als könnte er dieses Wesen aus Felsen so beschwichtigen. Doch kannte es Gnade? Er hatte die Ruhe gestört.
Noch in der Nacht war der junge Mann von seiner Hütte aufgebrochen, die weit oberhalb der Königsalm, aber noch auf der deutschen Seite lag.
Am Ende des Tegernseer Tals erhebt sich ein Bergzug, der die Grenze zu Österreich bildet, markant sind die Blauberge, die schon vom Taleingang in ihrer majestätischen Schönheit zu sehen sind und die Pforte in die südlich von ihnen gelegene hochalpine Region darstellen. Westlich, zwischen der Blaubergalm und dem Achenpass, befindet sich das letzte wilde Waldgebiet der Region. Nie ist hier von Menschenhand ein Baum gefällt, eine Hütte gebaut oder eine Almwiese angelegt worden. Die Nordseite der Berge ist zu steil, zu viele Bäche und Rinnen schlängeln sich den Abhang hinunter nach Bayerwald. Es lohnt sich nicht, das Holz für die Salinen in Rosenheim zu schlagen, für die Arbeiter ist es auch zu gefährlich.
Die Jäger und Forstangestellten, die sich hier an wenigen Tagen des Jahres aufhalten, meiden besonders eine Stelle, die sie als ›Totengraben‹ kennen. Es ist eine Gesteinsrinne, die einst eine mächtige Gletscherzunge ausgewaschen hat und die, zwar zugewachsen, eine Herausforderung für Kletterer darstellt. An vielen Tagen ist das Gestein rutschig und da und dort porös. Manchmal liegen umgestürzte Bäume, meist riesige Fichten, quer zu ihr, rutschen, wenn das Wasser bei Starkregen von oben gegen sie drückt.
Diese Umstände hatten die wenigen Hektar zu einem echten Urwald werden lassen, in dem sich der Mann dennoch gut auskannte. Das galt jedoch nur für alles oberhalb der Erde. Er war jetzt unter ihr gefangen.
Seile, Karabiner und all das, was er für den Gang in die Unterwelt brauchte, hatte er im Schein seiner Stirnlampe geschultert, war über den Kirchwandgraben hinabgestiegen, hatte sich mehrfach mit einem GPS-Gerät seiner Position versichert und wäre um Haaresbreite dennoch an seinem selbst hinterlassenen Zeichen vorbeigelaufen. Er legte sich in aller Ruhe seine Ausrüstung, den Helm, den Gurt, die LED-Lampe und den Overall bereit, ehe er die Grassoden wegräumte, die er Tage zuvor auf dem Spalt platziert hatte. Er würde in den nächsten Tagen weitere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen, um ungebetene Schnüffler, ob tierischer oder menschlicher Art, fernzuhalten.
Mit großer Vorsicht drückte er sich hindurch, stieß in einen Bereich vor, den er über Minuten im Entengang passieren konnte, bevor er zu einer weiteren Engstelle gelangte. Die Höhle lag auf der Nordseite des Bergs, Wasser drang bis hierher, seine Kleidung wurde schnell nass und verschlammte. Er musste durch diesen Spalt erst nach oben und dann wieder, einer Schlange gleich, nach unten gleiten. Dann erreichte er es.
Er leuchtete mit seiner Stirnlampe, die er auf dem Helm trug, die gesamte Kathedrale aus, bestaunte ungläubig und ehrfürchtig die Figuren, die Menschen vor Jahrtausenden in den Felsen geritzt hatten. Je länger er sich umsah, desto stärker veränderten sich seine Gedanken. Seine eigene Vergangenheit kam über ihn, machte sich in seinem Kopf breit, zwang ihn zum Hinsetzen.
Menschen vor ihm hatten Löcher in den Fels gehauen und notdürftig mit Steinplatten bedeckt. Er kroch über den Boden, der mit Knochen übersät war, und nahm immer intensiver einen Geruch wahr, der auf sein Bewusstsein Einfluss zu nehmen schien. Nicht unangenehm, es ließ ihn fast euphorisch werden. Er hatte aus seinem Rucksack eine fluoreszierende Lampe gezogen und aktiviert. Im matten Licht studierte er die kunstvollen Hinterlassenschaften an den Wänden und der Höhlendecke, fast vier Meter über dem Boden, bis er die Felslöcher erreichte. Er schob eine Platte beiseite und starrte in den kleinen Lichtkegel, den seine Stirnlampe in das Loch warf. Für einen Moment kam es ihm so vor, als würde er in etwas Lebendiges starren, etwas Atmendes sehen. Und dass es ihn anstarrte. Was war das? Flechten, kam es ihm in den Sinn. Das Licht der Lampe wirkte auf den Organismus, er zog sich zusammen, wie ein aufgeschrecktes Tier, das sich in Deckung flüchten wollte.
Er griff danach, erwartete instinktiv, dass es zwischen seinen Fingern zerbröselte. Stattdessen umschloss es seine Hand wie ein Netz. Er hatte für kleine Funde eine Tupperdose in den Rucksack gepackt und konnte nur mit Mühe das Fundstück darin deponieren. Das kostete viel Kraft. Er wollte sich auf den Boden legen, sich den Erinnerungen hingeben, die seine Gedanken bestimmten. Er fiel nach hinten, blickte nach oben.
Mit letzter Willenskraft erhob er sich nach über einer Stunde und kletterte aus der Kathedrale hinaus. Seine Sinne waren jetzt schärfer, er roch intensiver die alte Luft, die hier seit Äonen eingeschlossen war. Auch sein Gehör war besser geworden, denn das Schaben seiner Schuhe über den Felsen empfand er als laut.
Er war einer anderen Öffnung gefolgt, schien bereits sehr weit an die Oberfläche herangekommen zu sein, bis dieser Spalt ihn mit Macht aufgehalten hatte. Er war mit dem Kopf zuerst nach oben gerutscht, hatte gespürt, dass ein spitzer Felsvorsprung ihn an der Brust fixierte. Jetzt bog er sich, so gut er konnte, hievte sich einige Zentimeter höher, um sich ein wenig zu drehen. Nichts half. Der Fels hatte sich förmlich in seinem Körper festgebissen, ließ nur eine Bewegung seines linken Arms zu. Sein Messer steckte unerreichbar in der anderen Hosentasche. Er atmete ein und aus. Dachte nach. Versuchte, die aufkommende Panik mit Meditationsübungen zu unterdrücken, bis ihm klar wurde, dass er nur eine Chance hatte. Er musste den Arm aus dem Schultergelenk kugeln, nur so hätte er die Flexibilität, um an das Messer zu kommen und damit den Felszahn zu zerhacken, der ihn am Rückweg hinderte. Technisch gesehen war das einfach. Er stand auf einem schmalen Plateau, musste also nur die Füße abrutschen lassen und mit seinem Körpergewicht gegen den Arm arbeiten. Aber würde er den Schmerz ohne Bewusstseinsverlust überstehen? Und wenn ja, wie lange machte sein Kreislauf das mit?
Paul Trankl zählte von zehn herunter, atmete dabei immer schneller, biss auf seine Zähne und ließ sich fallen – in ein Meer aus Schmerz.
***
München, vier Jahre später
»Als ich Kind war, sind meine Eltern häufig umgezogen«, sagte sie in die Stille des stickigen Raums hinein.
»Ach? Das ist sicher nicht schön gewesen für Sie«, erwiderte die polnische Pflegerin, während sie die Betten frisch bezog.
»Ich habe sie immer wiedergefunden.« Sie schaute aus dem Fenster. »Zuletzt in einem versifften Loch in Indien.«
Die Pflegerin hatte offenkundig den Witz nicht verstanden, schweigend verrichtete sie ihre Arbeit, ging zum Schluss zu den Eltern, die dort auf dem Sofa saßen, lächelnd und schweigend, und stellte eine Tube mit billiger Handcreme auf den Beistelltisch.
Es war eine stumme Aufforderung, keine Bitte. Sie sollte ihrem Vater und ihrer Mutter die rissigen, von Flecken übersäten Hände einreiben.
Eine Klimaanlage gab es nicht.
»Stoßlüften hilft«, hatte sie sich von der Geschäftsführerin, einer verbitterten Mittfünfzigerin mit Ostberliner Akzent, anhören müssen. Eine mobile Klimaanlage war nicht erlaubt.
»Brandjefahr. Dit is doch klaar. Oda wollnse Ihre Eltern in Flammen aufjehn sehn?«
Sie hätte der Megäre am liebsten ihr Smartphone gegen die Frontzähne geschlagen, sich aber beruhigt. Jetzt saß sie hier in der muffigen Hitze des von Sauerstoff beinahe befreiten Zimmers und starrte auf das alte Paar, das auf dem Sofa saß, lächelte und schwieg.
Er war schon eingeschlafen, sie hielt noch die Augen offen, als schöbe sie Wache, weil sie ihr nicht trauten. Das war nicht unberechtigt.
Während sie die Hände der alten Frau eincremte, dachte sie in einem Anflug von Selbstmitleid, dass diese Finger ihr nie eine Spange ins Haar gesteckt, nie die Bettdecke über ihren Kinderkörper gezogen, nie Butterbrote für sie geschmiert hatten. Sie hatten nur für sich selbst und für ihn gearbeitet.
»Leg die Hände bitte auf das Handtuch. Du machst sonst alles dreckig«, bat sie ihre Mutter, die Wut in der Stimme mühsam unterdrückend.
Statt auf ihre Tochter zu hören, richtete sich die alte Frau auf, stützte sich an der Metallstange ab, an der ihr Infusionsbeutel hing, und wankte langsam an ihr vorbei, kam vor einer Kommode zum Stehen, atmete rasselnd, musste wieder Schleim in der Lunge spüren, hustete, ließ sich davon nicht beirren, zog mit letzter Kraft die Schublade auf, aus der sie zwei Blätter herauszog, und verharrte für einen Moment. Sie beobachtete müde den Gang der Frau, seufzte und versuchte, nicht zu klagen.
Eine Erzählung von Heinrich von Kleist kam ihr in den Sinn. Das Bettelweib von Locarno. Auch dort schlurfte eine alte Frau über den Boden, glitt aus und verschied. Sie musste die Geschichte damals in der Schule fehlerlos mit perfekter Interpunktion schreiben, ein Kunststück.
Die Mutter war zu schwach, um zurückzukommen. Sie suchte nach etwas, kramte in der Lade, erst langsam, dann ungeduldiger.
Ein Charakterzug, den sie zweifellos an mich weitervererbt hat, dachte sie bitter, weil sie sich ertappt fühlte.
Sie erhob sich, um der Mutter zu helfen, und als sie sie so dastehen sah, in den letzten Tagen ihres Lebens, so zerbrechlich, so alt, so vergänglich, da traten ihr Tränen in die Augen, sacht und langsam. Sie fühlte für ihre Mutter so etwas wie Liebe und Zärtlichkeit. Etwas, das sie sich immer erträumt hatte, in all den Jahren, in denen sie allein gewesen war. Sie überlegte, ob sie die Hand ausstrecken und der Mutter über den Rücken streicheln sollte, sie zumindest liebevoll berühren. Sie tat es und die Mutter zuckte zusammen. Die Metallstange mit dem Infusionsbeutel erzitterte förmlich, so schien sie sich erschreckt zu haben ob der zarten Geste der Tochter.
»Komm, setz dich wieder. Das Stehen strengt dich an«, flüsterte sie mit milder Stimme.
Die alte Frau hielt einen Stift in der Hand. Wollte sie zum ersten Mal ihrer Tochter etwas schreiben, etwas erklären? Hatte der Besuch in dieser muffigen, stickigen Höhle des Sterbens doch noch einen Wert?
Sie führte vorsichtig den Arm um die schmalen Schultern der Mutter, hatte das tiefe Bedürfnis, die Nase in die weißen, fedrigen Resthaare, die ungepflegt von ihrem Kopf hingen, zu stecken und tief einzuatmen. Etwas, das sie all die Jahre so vermisst hatte.
Ihr Blick fiel auf die zwei Seiten, die die Mutter herausgezogen hatte und mit zittrigen Fingern mühsam festhielt. Sie las, was in kritzeliger Schrift am oberen Rand stand, verstand es jedoch erst nicht.
Sie entriss der Mutter das Papier. Es dauerte, bis sie begriff. Es war der letzte Wille, das Erbe. Sie hatten noch einmal etwas geschrieben. Bei vollem Bewusstsein hatten sie ihr auch das genommen. Am Ende einer lebenslangen Reihe von Wegstoßen, Alleinsein, Ignoranz und Egozentrik hatten sie ihrer Tochter noch einmal gezeigt, dass sie nichts wert war.
Sie atmete ein. Sie atmete aus. Sah hinaus auf die Bundesstraße, die am Hospiz vorbeizog, wo Menschen in luftiger Kleidung in der prallen Sonne von Schatten zu Schatten liefen, der Hitze entfliehend.
»Ich bringe euch um«, sagte sie leise.