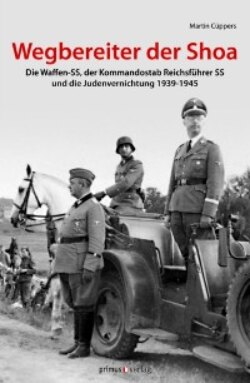Читать книгу Wegbereiter der Shoah - Martin Cüppers - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Alter, Herkunft und sozialer Status
ОглавлениеDie Mehrzahl des analysierten Führungspersonals war 1941 zwischen 31 und 50 Jahre alt. Insgesamt 38,6 Prozent der Männer wurden in der Dekade zwischen 1891 und 1900 geboren, ein ähnlicher Anteil, 36,6 Prozent, zwischen 1901 und 1910. Nur bei 17,8 Prozent der SS-Führer lag das Geburtsjahr in der Zeit zwischen 1911 und 1915, dem jüngsten in der Untersuchung erscheinenden Jahrgang. Den niedrigsten Anteil bilden mit 6,9 Prozent die sechs Offiziere, die in den Jahren zwischen 1884 und 1890 geboren wurden. In dieser ältesten Gruppe befinden sich mit den SS-Gruppenführern Kurt Knoblauch und Karl von Treuenfeld, dem Brigadeführer Gottfried Klingemann und Oberführer Wilhelm Hartenstein der Chef des Kommandostabes sowie drei der zeitweiligen Kommandeure der SS-Brigaden. Das Durchschnittsalter aller untersuchten Offiziere lag bei 40,1 Jahren.
Die ganz überwiegende Mehrzahl der SS-Führer wurde innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches von 1937 geboren. Lediglich zwei der Männer stammten aus Rußland und zwei aus der Tschechoslowakei, sie waren mit ihren Eltern allerdings bereits lange vor 1933 nach Deutschland gekommen. Außerdem wurde je einer der Männer in Österreich, Lothringen und dem Elsaß geboren. Hinsichtlich der regionalen Herkunft der reichsdeutschen SS-Führer lassen sich keine Auffälligkeiten feststellen; bei den Geburtsorten des untersuchten Personals sind sämtliche Regionen des Deutschen Reiches vertreten. Mit 29 Personen stammte jedoch nicht einmal ein Drittel der Männer aus ländlichen Regionen. Dagegen kamen 43 Prozent der Führerdienstgrade aus mittleren Städten oder aus Großstädten. Allein 17 Prozent der Männer wurden in den Metropolen Berlin, Hamburg und München geboren.2
Informationen hinsichtlich der sich aus dem Vaterberuf ergebenden sozialen Schichtzugehörigkeit enthielten 72 Prozent der Personalakten. Die Auswertung ergab, daß eine Herkunft aus der Unterschicht faktisch kaum existent war. Nur zwei der Offiziere gaben in ihrem Lebenslauf als Vaterberuf den eines Arbeiters beziehungsweise eines Facharbeiters an. Sämtliche anderen Offiziere wuchsen in Familien auf, die entweder der Mittel- oder gar der Oberschicht angehörten. Unter den Vätern fanden sich sechs Akademiker, was einem Anteil von immerhin acht Prozent entspricht. Zudem gab es zwei Fabrikbesitzer, drei höhere Beamte und sechs Angestellte in höheren Positionen. Daneben verdienten 11 Familienväter ihren Lebensunterhalt als selbständige Kaufleute im eigenen Geschäft und zehn Männer arbeiteten als selbständige Handwerksmeister. Mit neun selbständigen Landwirten waren zudem 12,5 Prozent der Väter im agrarischen Bereich tätig; allein drei davon besaßen als Gutsbesitzer größere Ländereien. Im Hinblick auf ihren Dienst beim Kommandostab oder den Brigaden erstaunt lediglich, daß mit vier Männern nur 5,5 Prozent der späteren SS-Führer aus Soldatenfamilien kamen; drei der Väter waren selbst Offiziere gewesen. Darüber hinaus waren zwei der Väter bei der Polizei tätig gewesen.
Die überdurchschnittlich hoch vertretene Herkunft aus den qualifizierten Bereichen des Mittelstandes und zu einem geringeren Teil sogar aus der Oberschicht wirkte sich auch auf das Niveau der Schulbildung aus. Mit 46 Prozent ging fast die Hälfte der untersuchten Personengruppe auf ein Gymnasium und schloß die höhere Schulbildung mit dem Abitur ab. Anschließend besuchte mit 21 Männern ein Fünftel der späteren Offiziere auch eine Hochschule. Mit der mittleren Reife schlossen immerhin 36 Prozent ihre Schulbildung ab, und nur 19 Prozent der Gruppe hatten lediglich einen Volksschulabschluß vorzuweisen. Damit lag der Bildungsstand von Offizieren des Kommandostabes und der Brigaden wesentlich höher als der von SS-Führern der Totenkopfstandarten, für die eine frühere Untersuchung für das Jahr 1939 nur einen 28-prozentigen Anteil an Abiturienten festgestellt hatte. Viel eher entsprach die Schulbildung der untersuchten Offiziersgruppe dem Abiturientenanteil unter den Führern der Verfügungstruppe oder des Sicherheitsdienstes der jeweils bei ungefähr 50 Prozent lag. SS-Führerdienstgrade, deren Schulbildung anhand einer Dienstaltersliste vom 1. Juli 1944 untersucht wurde, wiesen einen bedeutend niedrigeren Anteil an Abiturienten und einen entsprechend höheren Prozentsatz an Männern mit Volksschulabschluß auf.3
Bis auf eine Ausnahme ergriffen die 101 untersuchten SS-Führer alle eine Ausbildung; die meisten Männer arbeiteten vor ihrem Dienst in der Waffen-SS noch in ihrem erlernten Beruf. Bei der Berufswahl läßt sich nur teilweise eine Kontinuität zur Tätigkeit des Vaters feststellen. Die meisten Akademikersöhne verfolgten selbst eine Universitätsausbildung; außerdem ergriffen etliche Söhne von höheren Angestellten, selbständigen Kaufleuten oder Handwerksmeistern eine mit dem Berufsbild des Vaters vergleichbare Qualifizierung. Ein großer Teil der angehenden Kaufleute und Handwerker dürfte auch im elterlichen Geschäft ausgebildet worden sein; manche werden anschließend die Tätigkeit des Vaters direkt übernommen haben.4 Daneben sind in einigen Berufsbildern im Vergleich zu den Väterberufen bei den Söhnen auch deutliche Veränderungen festzustellen. Der Anteil der Facharbeiter stieg von 2,7 Prozent bei den Vätern auf immerhin 6 Prozent bei den Söhnen. Noch deutlicher waren die Veränderungen bei den kleineren Angestellten. Hier stieg der Wert von 11 auf 26 Prozent. Bei den Söhnen läßt sich außerdem ein Rückgang von Berufen im landwirtschaftlichen Sektor feststellen; lediglich drei SS-Führer hatten noch als Landwirte gearbeitet, nur einer hatte seine laufende Ausbildung für den Dienst in der Waffen-SS abgebrochen. Schließlich deutet sich bei zahlreichen Männern, die als Soldaten oder Polizeibeamte tätig waren, bereits deren spätere Funktion als SS-Offiziere an. Während bei den Vätern mit acht Personen nur 11 Prozent als Soldaten oder Polizisten beschäftigt waren, stieg der Anteil unter den Söhnen auf immerhin 31 Prozent. Zweifellos wäre der Wert noch bedeutend höher ausgefallen, wenn nicht zahlreiche Weltkriegsteilnehmer nach 1918 in der verkleinerten Reichswehr gezwungen gewesen wären, sich ersatzweise einem Zivilberuf zuzuwenden. Von den 13 erfaßten Polizisten und 18 Soldaten waren mit 17 Männern über die Hälfte der Personengruppe bereits vor ihrem Eintritt in die Waffen-SS Offiziere gewesen.
Die Ergebnisse verdeutlichen trotz aller Unterschiede eine recht große Konstanz zum sozialen Status des Elternhauses. Die überwiegende Mehrzahl der SS-Führer war weiterhin im Mittelstand sozialisiert und hatte sehr wohl ihr Auskommen in der Weimarer Gesellschaft gefunden. Damit entsprachen die späteren Offiziere keineswegs dem Bild perspektivloser Outlaws; vielmehr zeigt sich, daß die Männer sich aus meist gesicherter Existenz bewußt für eine Karriere in der bewaffneten SS entschieden. Die Untersuchung des Sozialstatus, der Schulbildung und der Berufswahl zeigt zudem, daß das Offizierskorps des Kommandostabes und der Brigaden keineswegs dem Ideal der von der SS ursprünglich propagierten klassenlosen Volksgemeinschaft entsprach.5 Während der frühen Jahre des Aufbaus der Waffen-SS wurde verstärkt auf die bestehende Bildungselite zurückgegriffen. Ansätze zur Ausbildung des Führernachwuchses anhand genuin nationalsozialistischer Wertemaßstäbe wurden spätestens im Krieg zugunsten eines schnelleren Ausbaus und der weiteren Professionalisierung der Waffen-SS zurückgestellt. So forderte das SS-Führungshauptamt im November 1940 nach einem desaströs verlaufenen Führerlehrgang an der Junkerschule Tölz, bei dem ein Großteil der Führerbewerber sich als vollkommen ungeeignet erwiesen hatte, die einzelnen Truppenverbände auf, angehende Offiziere sorgfältiger auszuwählen und besonders Abiturienten in die Auswahl mit einzubeziehen.6 Dementsprechend wurden Ende 1940 auch innerhalb der SS-Kavallerie Beurteilungslisten angefertigt, die speziell die Abiturienten in den jeweiligen Schwadronen hinsichtlich ihrer militärischen Qualitäten und Führungseigenschaften bewerteten.7 Die SS unterstrich damit, daß eine Führerlaufbahn bevorzugt Höhergebildeten offenstand, die sich hauptsächlich aus der einstigen Mittel- und Oberschicht der so verhaßten Weimarer Republik rekrutierten.