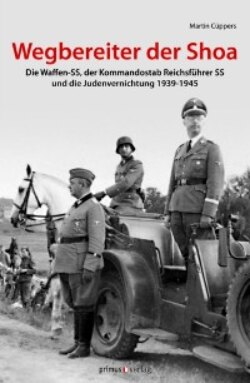Читать книгу Wegbereiter der Shoah - Martin Cüppers - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Mythos Befehlsnotstand und die Möglichkeiten der Verweigerung
ОглавлениеEine klassische, tausendfach benutzte Argumentation von Beschuldigten und Zeugen zur Exkulpation des eigenen Handelns war in sämtlichen NS-Nachkriegsverfahren die Berufung auf den Befehlsnotstand. Damit machten ehemalige Täter unter Bezug auf die Paragraphen 52 und 54 des Strafgesetzbuches geltend, die Verbrechen nur begangen zu haben, weil sonst im Verweigerungsfall eine ernste Gefährdung für das eigene Leben bestanden hätte. Untergeordnete Tatbeteiligte konnten für sich darüber hinaus den sogenannten Putativ-Notstand geltend machen. Damit sind Situationen gemeint, in denen Befehlsausführende fälschlicherweise der Ansicht waren, ihnen drohe bei Nichtbefolgung von verbrecherischen Befehlen eine Gefahr für Leib und Leben. Da die bundesdeutsche Gesetzgebung in derartigen Fällen einen Schuldausschließungsgrund vorsah, wurde gegen einfache Angehörige deutscher Dienststellen oder Mordeinheiten in der Regel gar nicht ermittelt.1
Auch in den Verfahren gegen Angehörige der Brigaden beriefen sich zahlreiche ehemalige SS-Männer ausdrücklich auf den Befehlsnotstand. Peter C., ein früherer Reiter im 2. Kavallerieregiment sagte bei seiner Vernehmung 1962 aus: „Bei uns bei der SS wurde ein strenges Regiment geführt. Befehlsverweigerungen durfte es einfach nicht geben. Wenn sich jemand geweigert hätte, der hätte bestimmt damit rechnen müssen, selbst ‚an die Wand gestellt‘ zu werden.2 Ein Ehemaliger desselben Regiments äußerte sich ganz ähnlich: „Ich glaube fest, daß ich selbst an die Wand gestellt worden wäre, wenn ich aufgemuckt hätte.“3 Während ein früherer SS-Mann der 1. Brigade seine angeblich erzwungene Teilnahme an Massenerschießungen zynischerweise noch dahingehend auslegte, den jüdischen Opfern, wie er es formulierte, „nach Möglichkeit durch gezielte Schüsse weitere Qualen“ erspart zu haben4, drückte ein anderer Zeuge unter dem Deckmantel des Befehlsnotstands recht unverblümt seine innere Übereinstimmung mit den Judenmorden aus. Der frühere SS-Mann Hans A. gab 1966 dazu zu Protokoll: „Wir waren Soldaten und mußten gehorchen. Auch von uns sind viele umgekommen.“ Außerdem bemerkte A. zu den Massakern an der jüdischen Bevölkerung: „Diese Einsätze waren als kriegsnotwendig anzusehen und wurden auf Befehl unserer Vorgesetzten ausgeführt.“5
In drastischer Form berichteten ehemalige Einheitsangehörige außerdem davon, daß man sich gar keine großen Gedanken über die Befehle gemacht habe. So erinnerte sich der einstige Reiter Kurt H. in den 60er Jahren an die Realisierung der Massenerschießungen von Juden im Sommer 1941 folgendermaßen: „Uns war natürlich klar, daß sie erschossen wurden, weil sie Juden waren. Unter uns Kameraden wurden diese Vorgänge nicht groß diskutiert, da wir schon so abgestumpft und stur waren und uns darüber keine großen Gedanken machten, warum man diese jüdischen Männer, Frauen und Kinder bis herab zum Säugling erschießt.“6 Ähnlich drückte sich Wilhelm W., ein anderer Ex-Soldat der SS-Kavallerie aus, als er bei seiner Vernehmung sagte: „Wir waren alles primitive Männer, die nicht weiter nachdachten.“7
Andere Zeugen, die sich auf den Befehlsnotstand beriefen, sprachen dagegen von einer angeblich breiten Ablehnung der Judenerschießungen durch zahlreiche Männer. Unglücklicherweise habe jedoch keine Möglichkeit bestanden, sich den Befehlen zu widersetzen, „weil man“, wie der ehemalige SS-Reiter Hans M. 1962 angab, „in diesem Falle um sein eigenes Leben fürchten mußte. Eine Begeisterung bei den Männern war nicht festzustellen. Den Abscheu durfte man nicht einmal nach außen hin zeigen.“8 Nach der Aufdeckung und weltweiten Ächtung der deutschen Massenverbrechen erschien eine Abwehr der eigenen Verantwortung gegenüber der deutschen Justiz mit dem Verweis auf die zu befolgenden Befehle, verbunden mit einer persönlichen Verurteilung der Taten, für die eigene Schuldabwehr am aussichtsreichsten. Etliche Angehörige der Brigaden drückten dementsprechend ihre wohl oft nur vorgeschobene innere Ablehnung gegenüber den zahlreichen Judenmorden aus. Die Zeugen gaben an, zurückkehrende SS-Soldaten hätten nach den Erschießungen „infolge der vorangegangenen Erregung gebrochen wie die Reiher“, andere seien „nervlich völlig fertig“ zurückgekehrt, nicht selten sei es vorgekommen, daß „ältere Kameraden von uns weinten“.9 Abgesehen von derartigen zweifelhaften Aussagen sind keinerlei ernsthafte Hinweise auf Gruppenproteste von Brigadeangehörigen gegen eine Verwendung bei Judenerschießungen bekannt geworden. Andererseits erscheint es durchaus glaubhaft, daß gerade der Beginn der massenhaften Tötung von jüdischen Männern und besonders von Frauen und Kindern die eingesetzten SS-Männer im Sommer 1941 nicht völlig unbeeindruckt gelassen haben kann. Ehemalige Einheitsangehörige berichten in Aussagen von solchen emotionalen Reaktionen der Schützen auch nur während der Anfangsphase des Massenmordes. Im Verlauf der kontinuierlich weiterhin stattfindenden Erschießungen scheint dann ein Gewöhnungseffekt eingetreten zu sein, da gleichlautende Aussagen über spätere Tötungsaktionen nicht mehr vorliegen.
Als schwerwiegende Einwände gegen die Existenz von Situationen, in denen ein Befehlsnotstand bestanden haben soll, existieren zahlreiche Aussagen, die das genaue Gegenteil berichten. Otto H., ein Soldat der 8. Kompanie des SS-Infanterieregiments 10 wurde im Sommer 1941 von seinem Vorgesetzten aufgefordert, an einer Erschießung teilzunehmen. Über seine Reaktion berichtete der Zeuge: „Ich habe dies aber abgelehnt. Mit meiner Ablehnung hatte es sein Bewenden, ich bekam keinen diesbezüglichen Befehl, und man trat auch in Zukunft nicht mehr an mich heran.“10 Ganz ähnlich äußerten sich andere ehemalige Angehörige der Brigaden. Kurt O., ein früherer Soldat im SS-Infanterieregiment 10, sagte über seine Haltung im Herbst 1941 aus: „Ich habe mich geweigert, daran teilzunehmen. Diese Weigerung hatte für mich keine Folgen. In Zukunft trat man aber nie mehr an mich bei Aufstellung eines Erschießungskommandos heran.“11 Fast gleichlautende Angaben machte Johann K. zu den Folgen seiner Weigerung, an einem Massaker teilzunehmen. Er erzählte 1968 bei seiner Vernehmung: „Mir sind durch meine Äußerungen keine Nachteile entstanden, im Gegenteil, ich wurde durch meine Haltung nur selten zur Absperrung und nie einem Erschießungskommando zugeteilt.“12
Tatsächlich hat es bisher im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und der Gerichtsverfahren wegen nationalsozialistischer Verbrechen in der alliierten und bundesdeutschen Rechtsprechung keinen einzigen Fall gegeben, in dem sich der Verweis der Täter auf eine Selbstgefährdung im Falle einer Befehlsverweigerung bewahrheitet hätte. Zwar mag es auch für Angehörige der Brigaden Situationen gegeben haben, in denen Männer für sich einen Putativ-Notstand empfanden, derartige Fälle sind jedoch gerade wegen ihres subjektiven Charakters kaum eindeutig aufzuklären.13 Viel entscheidender bleibt demgegenüber festzustellen, daß ein Verweis auf Befehlsnotstand von NS-Verbrechern, wie den Tätern der Waffen-SS, immer wieder als aussichtsreiche Verteidigungslinie benutzt wurde, um einer Verurteilung zu entgehen. Derartige Aussagen orientierten sich also kaum an der historischen Faktizität des Geschehens, sondern entsprangen vielmehr dem lange nach den Verbrechen entstandenen Interesse der Täter, die Versuche justitieller Ahndung möglichst unbeschadet zu überstehen.
Dagegen besitzen die Aussagen der Zeugen, die eine Verweigerung ihres Einsatzes bei den Judenerschießungen schilderten, eine weit höhere Glaubwürdigkeit. Von Bedeutung dürfte dabei auch die Überlegung sein, daß die Einheitsführer generell ein vorrangiges Interesse am möglichst effizienten Ablauf der Mordeinsätze gehabt haben mußten. Aus diesem Grund werden SS-Offiziere lieber auf diejenigen verzichtet haben, die eine persönliche Teilnahme an solchen Exekutionen ablehnten, um während der Erschießungen keine potentiell kontraproduktiven Einflüsse zu riskieren. Ein nach Effizienzkriterien gesteuertes Tötungsverfahren bestätigten etliche der vernommenen Zeugen unwissentlich, indem sie Aussagen über den hohen Grad an Freiwilligkeit bei der Realisierung des Massenmords an den Juden machten.14 Ein früherer Angehöriger der 14. Kompanie des SS-Infanterieregiments 8 sagte dazu: „Die Exekutionen wurden jeweils von Freiwilligen durchgeführt, die sich dazu gemeldet hatten. Es brauchte nie jemand zu solch einem Kommando abgestellt werden, der einen ausdrücklichen Befehl bekommen hatte. Freiwillige gab es immer genug.“15
Einen ähnlichen Umgang mit dem zu realisierenden Mordauftrag schilderte der Zeuge Wolfgang von A. für die 2. Kompanie des SS-Infanterieregiments 10. Dort habe der Kompanieführer eines Morgens vor dem angetretenen Zug mitgeteilt, daß Freiwillige für eine Erschießung benötigt würden. Mit Ausnahme des Zeugen sei darauf der gesamte Zug geschlossen einen Schritt vorgetreten und bald darauf zu der Erschießung abgerückt. Ernste Konsequenzen hatte die Weigerung für den SS-Mann nicht. In der Folge sei er lediglich von einigen wenigen ‚Kameraden‘ gemieden worden, die ihm offenbar die Weigerung übel nahmen. Außerdem habe ihn ein Vorgesetzter im Zug einmal als „alten Schlips“ bezeichnet.16 Derartige Aussagen existieren für so viele Kompanien der 1. SS-Brigade, daß der Schluß nahe liegt, ein solches Vorgehen sei keine Ausnahme, sondern vielmehr eine weit verbreitete Praxis innerhalb des Verbandes gewesen.17 Auch für die Kavalleriebrigade gibt es ähnliche Belege. Der ehemalige SS-Reiter Josef K. berichtete, nach den Zusammentreibungen von Juden im Sommers 1941 hätten gar keine Einheitsangehörigen zur Ausführung der anschließenden Erschießungen befohlen werden müssen: „Nach meiner Ansicht war dies auch nicht notwendig, da wir genug Leute dabei hatten, die so etwas gerne machten.“18
Vereinzelt scheint die hohe Zahl von Freiwilligen bei Einheitsführern sogar zu Skrupeln über deren Verwendung geführt zu haben. Zu Überlegungen Paul Liebermanns, des Chefs der 2. Kompanie im SS-Infanterieregiment 8, sagte der Zeuge Kurt D. aus: „Während des Ablaufes der vorgeschilderten Aktion hatte ich mit Liebermann ein, man kann sagen, persönliches Gespräch. Er äußerte sinngemäß, er mache sich Gedanken, wie und in welcher Weise er die Exekution durchführen könne. Er gab weiter von sich, ob er Freiwillige dazu einsetzen solle oder, falls sich keine Freiwilligen melden sollten, er nun gezwungen sei, Leute zu der Erschießung abzukommandieren. Als das Zusammenholen der Männer beendet war, ließ Liebermann die Kp. antreten und befragen, wer sich für die Erschießung freiwillig melden wolle. Ich habe jetzt selbst gesehen, daß sich insbesondere die noch jugendlichen Jahrgänge freiwillig zur Exekution meldeten. Innerhalb unserer Kp. gab es nämlich zwei Gruppen. Dies waren die Jahrgänge um 1920 bis 1923 und wir älteren Reservisten, Jahrgänge um 1910. Liebermann war über dieses Verhalten erschüttert, ich selbst habe ihm zugeredet, daß es doch unmöglich sei, diese jungen Burschen bei dieser Aktion zu verwenden. Die jungen Kerle würden durch dieses Erlebnis schwer geschädigt. Liebermann hat auch meine Meinung akzeptiert, und es wurden tatsächlich ältere Jahrgänge zum Erschießungskommando eingeteilt. Aber auch diese hatten sich freiwillig gemeldet.“19
Eine derartige Schilderung erscheint durchaus plausibel. Kompanieführer wie Liebermann mußten sich Gedanken über die Einsatzfähigkeit ihrer Männer und den Erhalt der Disziplin innerhalb der Truppe machen. Besonders durch die Teilnahme von jungen Männern an den Mordeinsätzen konnte beides in Frage gestellt werden. Entsprechende Sorgen von Kommandeuren bis hin zu Himmler über das geistige Wohl der SS-Männer beim Massenmord gab es schon früher. Erinnert sei an Befehle im Zusammenhang mit Erschießungsaktionen der SS in Polen, die genau den gleichen Sachverhalt dokumentieren.20 Ein anderer Angehöriger der 2. Kompanie des 8. SS-Regiments berichtete – möglicherweise handelte es sich sogar um die gleiche Situation – wie Liebermann den Soldaten bei der Weitergabe eines Mordbefehls die Teilnahme an der Erschießung der Juden freistellte. Dabei erinnerte sich der frühere SS-Mann Erich K. 1965 an folgendes: „Liebermann hat bei der Einteilung der Kp. zur Aktionsdurchführung bekanntgegeben, daß sich an der Erschießung nur Freiwillige beteiligen brauchen. Sinngemäß sagte er, daß, wer glaube nicht durchhalten zu können oder wer sich der Sache nicht gewachsen fühle, von der Erschießung zurücktreten könne. Ich erinnere mich auch, daß er äußerte, der Befehl käme von oben und er müsse ihn als Soldat ausführen.“21
Zu der Zahl derjenigen, die das Angebot des Kompaniechefs annahmen, gab der Zeuge an, daß sich mitunter fast die Hälfte der Kompanie von der Erschießung freistellen ließen. Keiner der Männer hätte deswegen Nachteile gehabt.22 Von anderen Teileinheiten der Brigaden existieren allerdings auch Hinweise, daß bei Erschießungen keineswegs nur Freiwillige verwendet wurden. Ein Angehöriger der 14. Kompanie des 8. Regiments sagte in dem Zusammenhang aus: „Die Teilnahme an einem Exekutionskommando war zwar in der Hauptsache, wie ich bereits erwähnte, freiwillig, doch kam es vor, daß bei nicht genügender Meldung auch andere abkommandiert wurden.“23 Johann K., ein anderer Ehemaliger der Brigade, gab an, daß Freiwilligenmeldungen mit der Zeit abnahmen, worauf Einheitsangehörige zu den Judenerschießungen verpflichtet werden mußten. Wie K. weiter berichtete, verweigerten einzelne Männer in solchen Fällen den Einsatz, was für die Betreffenden jedoch keine schwerwiegenden Konsequenzen gehabt hätte.24
Die bisher dargestellten Beispiele waren nicht die einzigen Fälle, die darauf hindeuten, daß es Formen der Verweigerung bei Massenerschießungen gab. Unter der Vielzahl der Vernehmungen gibt es einzelne Aussagen, in denen SS-Männer einigermaßen glaubhaft davon berichteten, die Teilnahme am Judenmord aus persönlichen Motiven umgangen zu haben. Einer erklärte, er habe den Einsatz bei einer Erschießung aufgrund seines christlichen Gewissens verweigert.25 Wilhelm G., ein Truppführer im SS-Infanterieregiment 10, will sich sofort krank gemeldet haben, als er von einem bevorstehenden Massaker an der jüdischen Bevölkerung einer ukrainischen Ortschaft erfuhr. Der Zeuge sagte dazu aus: „Ich kann heute nicht mehr angeben, wie ich diese Krankmeldung bewerkstelligt habe. Von dem Vorhaben war ich jedenfalls so entsetzt, daß mir praktisch die Nerven durchgegangen sind. Ich war selbst Familienvater und hatte damals zwei kleine Kinder zu Hause. Aus diesem Grunde wollte ich mich vor der Sache rundheraus gesagt drücken.“26
Andere Einheitsangehörige ließen sich scheinbar statt einer offenen Verweigerung oder einer Krankmeldung andere Mechanismen zur Umgehung einer Beteiligung an Exekutionen einfallen. Beispielsweise will sich ein SS-Reiter, nachdem er von bevorstehenden Judenerschießungen erfahren hatte, mit besonderer Sorgfalt der Pferdepflege gewidmet haben. Dadurch hoffte er, dem Einsatz entgehen zu können. Als er jedoch von seinem Truppführer in rüdem Ton zum Abmarsch aufgefordert wurde, kam der Einheitsangehörige der Aufforderung nach und beteiligte sich an der Mordaktion.27 Hans W., ein Angehöriger des 2. Regiments der SS-Kavallerie schilderte, wie er ebenfalls zu einer Erschießung eingeteilt wurde. Um selbst keinen der an der Grube aufgestellten Juden töten zu müssen, habe er kurz vor dem Massenmord heimlich den Schlagbolzen aus dem Schießmechanismus seines Karabiners abgebrochen. Nach dem nicht erfolgten Schuß wurde er unter Beschimpfungen aus dem Erschießungskommando entfernt, kam danach aber nicht mehr zum Einsatz und hatte keine weiteren Konsequenzen zu tragen.28
Die geschilderten Beispiele zeigen, daß es den Angehörigen der SS-Brigaden durchaus möglich war, sich den geplanten Mordeinsätzen zu entziehen. Oft brauchten sich die Männer einfach nicht als Freiwillige zu melden. Bestanden derartige Möglichkeiten der Freistellung, nutzte nach den Aussagen der ehemaligen SS-Männer eine Minderheit, in einzelnen Fällen mitunter sogar bis zur Hälfte der Soldaten, das Angebot, sich nicht beteiligen zu müssen. In den meisten Fällen meldete sich dagegen eine deutliche Mehrheit freiwillig zu den Exekutionen. Wurde die Teilnahme an der Erschießung befohlen, kam die ganz überwiegende Mehrheit der Männer der Aufforderung ohne erkennbaren Widerstand nach. In solchen Fällen bestand zwar immer noch die Möglichkeit, sich von den Einsätzen freistellen zu lassen, allerdings wurde das nur von ganz wenigen Einheitsangehörigen genutzt. Schwerwiegende Konsequenzen über etwaige kleinere Schikanen hinaus hatten die SS-Männer dabei nach eigenen Angaben nicht zu befürchten. Zudem existierten im Dienstalltag der SS-Verbände vielfältige Möglichkeiten, sich vor den Einsätzen in irgendeiner Weise zu ‚drücken‘. Aussagen ehemaliger Einheitsangehöriger über ein individuelles Verweigern sind allerdings so selten, daß sie im Vergleich zur großen Zahl der Schützen nicht ins Gewicht fallen. Da für die als Zeugen vernommenen Personen kein Motiv existierte, ein derartiges Verhalten zu verschweigen, ist davon auszugehen, daß nur eine verschwindend geringe Minderheit der SS-Männer die Teilnahme an den Judenerschießungen aus persönlichen Beweggründen offensiv verweigerte.