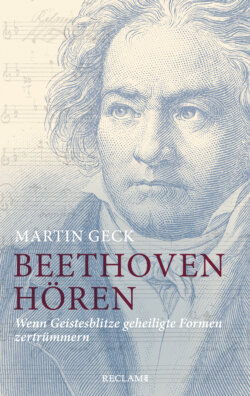Читать книгу Beethoven hören - Martin Geck - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеTönend bewegte Formen sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik.
EDUARD HANSLICK, Vom Musikalisch-Schönen, 1854
Glaubt Er, daß ich an eine elende Geige denke, wenn der Geist zu mir spricht und ich es aufschreibe?
BEETHOVEN zum Geiger Ignaz Schuppanzigh (Notat seines Biographen Adolf Bernhard Marx)
Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort, Doch der freie wandelt im Sturme fort.
SCHILLER, Die Worte des Wahns
Stürmischer Geist trifft auf kühle Profession – so lautet das Kernthema dieses Büchleins. Es stammt von einem Beethoven-Hörer, der zugleich Musikwissenschaftler ist. Und der es bedauert, dass etliche seiner Kollegen auftreten, als wären sie keine Beethoven-Hörer. Natürlich hören sie Beethoven, und gewiss lieben sie ihn. Gleichwohl liest sich manche staubtrockene Analyse Beethoven’scher Musik so, als wäre das ›Ereignis Beethoven‹ zu einem Konstrukt geschrumpft, dessen Baupläne man nur gehörig aus- und nachmessen müsse, um es ›erfasst‹ zu haben. Botschaft an die Leser: ›Schwer zu knacken, diese Stelle. Dazu braucht es Fachwissen!‹
Fachwissen ist jedoch nicht alles. Zudem bedeutet es mehr als gründliche Kenntnis der Musiktheorie – nämlich tiefere Einsicht in einen Beethoven-Diskurs, der über intelligente formale Analysen hinausreicht. Ohne darüber nachzudenken, sind schwärmerische ›Laien‹ diesem umfassenden Beethoven-Diskurs gelegentlich näher als manche Gelehrte. Ich möchte eine Brücke schlagen zwischen ›Wissenschaftlern‹ und ›Liebhabern‹: Beide dürfen schwärmen, beide dürfen nachdenken.
Ist es Schnee von gestern, dafür streiten zu wollen? Schert sich unsere Eventkultur überhaupt noch um Fragen der traditionellen Musikanalyse? Spricht überhaupt noch jemand über die ›tönend bewegten Formen‹ eines Eduard Hanslick? Und umgekehrt gefragt: Ist nicht die heutige Musicology vor allem mit anderen Themen beschäftigt: Deconstructivism, Narrative turn, Cultural turn, Linguistic turn, Gender, Race, Minorities?
Doch gerade das ist mein Punkt: So sinnvoll es ist, diese vor allem in den USA generierten Themen in den Diskurs ›Klassische Musik‹ aufzunehmen, so wichtig ist es, dem traditionellen »Kunst«-Handwerk der Analyse die Treue zu halten, auch wenn dieses Handwerk von Fall zu Fall um entsprechende Kompetenzen zu erweitern wäre.
Ich setze auf »Kunstkritik« im Sinne der Romantik und bediene mich dieser Kategorie gemäß Walter Benjamins Studie Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Romantische Kunstkritik will das Kunstwerk reflektieren und weiterdenken. Die Reflexion soll allerdings nicht wahllos ausfallen, vielmehr einen dem Werk »immanenten Keim […] zur Entfaltung bringen«.1 Das gilt nicht nur für Literatur, sondern auch für Musik: Seit der klassisch-romantischen Epoche ist diese auf Reflexion nicht nur angewiesen, sondern geradezu auf sie angelegt.
Nun kann »Reflexion« vieles bedeuten – etwa auch das Nachdenken über Beethovens Äußerung zur Sturm-Sonate op. 31,2: »Lesen Sie nur Shakespeare’s Sturm!« Man muss diese Worte ja nicht als spöttisches, womöglich genervtes Bonmot abtun; sie verweisen vielmehr – wie vage auch immer – auf einen kunstkritischen Diskurs, der das Werk aufschließt.
Dass sich Komponisten, Philosophen und Dichter – teils selbstbezogen, teils kundig, teils naiv – zur Musik geäußert haben und weiterhin äußern, ist alles in allem ein Geschenk an den Musikdiskurs, macht jedoch Musikanalyse nicht überflüssig: Will man über Musik reden, anstatt sie nur zu hören, so bedarf es eines Korrektivs zum Ausdruck bloßen Fühlens, Erlebens, Assoziierens, Fantasierens. Dieses Korrektiv zeichnet sich immer noch am deutlichsten vor dem Vorstellungshorizont ab, man habe es in der ›klassischen‹ Musik mit Werken zu tun.
Werke sind Organismen eigenen Rechts; sie bilden Strukturen, die als solche gewürdigt werden möchten und in der Tat – vielleicht unbewusst – von jedem Hörer gewürdigt werden, der sich nicht nur einem Klangrausch hingibt, sondern das musikalische Geschehen verfolgt. Nicht um eine Demontage des Werkbegriffs geht es mir, sondern – zugespitzt gesagt – um Kritik an der Auffassung, man könne das Werk auf einen Fetisch mit Namen »Partitur« oder »Struktur« schrumpfen.2
Doch selbst mit dem Terminus »Struktur« könnte ich gut leben, wenn man ihn aus dem Korsett befreite, in das ihn die strikte Musikanalyse zwängt. Vorab genügt vielleicht der vage Hinweis, dass musikalische Verläufe Strukturen abbilden, die sich auch in unserer Lebenswelt finden und in unserem Hirn verallgemeinert werden. Zum Beispiel dürfte es einsichtig sein, dass metaphorisch »hoch« oder »tief« genannte musikalische Konfigurationen in allgemeinen Strukturen unseres Welterlebens gründen: Wir vollziehen beim Musizieren und beim Hören von Musik Bewegungen nach, die wir aus unserer Lebenswelt kennen. Und der Reiz dieses Nachvollzugs besteht darin, dass wir die Situation steuern und beherrschen, ohne deshalb aus dem großen Ganzen herauszufallen.
Das Beispiel »hoch – tief« ist das einfachste, das sich denken lässt. In klassischer Musik sind die Konstrukte komplizierter und deshalb schwerer auf ihren Weltbezug hin zu entschlüsseln; doch gerade darin liegt der Reiz. Hörer erleben: ›Ich nehme nicht an einem allgemeinen Weltvollzug teil, sondern an einem höchst speziellen. Indem ich mich mit diesem identifiziere, erlebe ich mich als Individuum in höchster Entfaltung – und das im Einverständnis mit anderen, die zwar ihre speziellen Eigenerfahrungen einbringen, jedoch via Musik über diese ihre Erfahrungen mit mir kommunizieren.‹
Das Stichwort Kommunikation hebt das Thema auf eine neue Ebene. Die meisten Hörer kommunizieren ja nicht mit der Partitur, sondern mit dem Komponisten und seiner Musik. Was deren ›Struktur‹ betrifft, fragen sie sich bewusst oder unbewusst: ›Wie erreicht ein Komponist diesen oder jenen Effekt; und wie verhält sich die musikalische Struktur zu meiner allgemeinen Erfahrung der strukturierten oder als strukturiert erlebten Welt?‹ Die Reflexion hierüber stellt der emotionalen Bindung an die Musik, die ja gern bleiben darf, ein Stück Freiheit zur Seite. Man muss nicht so weit gehen wie Theodor W. Adorno, der als »gänzlich adäquaten Hörer« nur den akzeptierte, der – »fürs erste«! – die Formteile des zweiten Satzes aus Anton Weberns Streichtrio op. 20 nennen, also mit einem unter allerlei Komplikationen zwölftönig komponierten Sonatensatz umgehen konnte.3 Man darf jedoch vermuten, dass Einsichten in das heikle Gefüge von Form und Gehalt der Musik unser aller ästhetischen Sinne schärfen und dadurch zu unserer Humanisierung beitragen möchten.
Allerdings erfolgen ›Kommunikation‹ oder ›Diskurs‹ nicht nur via Analyse. Sie umfassen alles, was uns beim Musikhören – unbewusst oder bewusst – durch den Kopf geht und worauf wir antworten möchten: durch Mitmachen und Nachschaffen, durch Nachdenken und Erinnern.
Was speziell die Strukturanalyse vor allem deutscher Tradition und ihre hybriden Züge betrifft: Sicherlich gibt es inzwischen die oben genannten ergänzenden oder alternativen Verfahren und vieles andere. Ein Blick in aktuelle Handbücher, auf universitäre Curricula oder auf diverse Abituraufgaben im Fach Musik zeigt jedoch, in welchem Maß traditionelle Musikanalyse weiterhin als ein Königsweg der Musikbetrachtung angesehen wird – wenn nicht gar als Fels in der Brandung angesichts wechselnder Moden.
›Fels in der Brandung‹ könnte die Musikanalyse in meinen Augen gern bleiben, wenn sie ihre Ziele neu reflektierte. Das hieße vor allem, Adornos Idee vom »integralen Kunstwerk« nicht als Aufforderung zu missdeuten, einem trügerischen Ideal – mehr als das ist es ja nicht – hinterher zu hecheln: nämlich der Vorstellung, die Präsenz des »Integralen«, also der in sich perfekten Ganzheit, ließe sich analytisch nachweisen, wenn die Musik nur »groß« und man selbst intelligent und sachkundig genug sei. Solches hieße, boshaft formuliert: Wir sollen nicht über die Musik staunen, sondern über die zauberischen Künste des oder der Analysierenden. Sowohl die poetischen als auch die körpersprachlichen Momente der Musik schrumpfen in entsprechenden Analysen gegen Null; das Ekstatische und Diskontinuierliche – überhaupt alles formanalytisch schwer zu Fassende – wird geflissentlich überhört oder eingemeindet.
Was das im einzelnen bedeutet, sollen die nachfolgenden Kapitel zeigen.
Dass sich meine Argumentation auf die Musik Beethovens konzentriert, ist zwar auch methodisch begründet, jedoch vor allem dieser Musik selbst geschuldet: In für mich unfassbarer Weise gelingt es Beethoven, ›Struktur‹ zu bilden und dieser Struktur – je länger um so entschiedener – ein ebenso verletzliches wie kämpferisches Ich gegenüberzustellen. Ich kenne keinen Komponisten, der sein Werk strikter dem Anspruch unterworfen hätte, sich als Subjekt in ›den Verhältnissen‹ zu behaupten, anstatt in ihnen mitzuschwimmen oder in und mit ihnen unterzugehen.