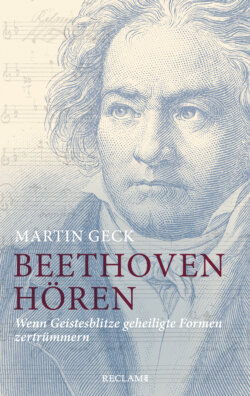Читать книгу Beethoven hören - Martin Geck - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Entzauberung und Illusionsbrechung: die Achte
ОглавлениеIst die gelegentlich stiefmütterlich behandelte Achte ein Schlüsselwerk? Sie ist es insofern, als in ihr ein desillusionierter Beethoven das Wort ergreift, nämlich ein Komponist, der an der Wirkungsmacht seiner idealistischen Botschaft entschieden zweifelt und künftig andere Wege gehen wird. Diese fallen jedoch höchst unterschiedlich aus. Außer dem Weg der Achten, von dem nunmehr die Rede sein soll, gibt es den Weg des wilden Sich-Aufbäumens – exemplarisch in der Hammerklaviersonate op. 106, im 1. Satz der Neunten und mittelbar auch in deren Finale sowie in der Großen Fuge op. 133. Oder den Weg der »Ergebung« (ein Lieblingswort des späten Beethoven), den der Liedzyklus An die ferne Geliebte op. 89 und die späten Klaviersonaten op. 109 bis op. 111 markieren. Die letzten Quartette spiegeln schließlich den Versuch, ein heikles Gleichgewicht zwischen diesen beiden konträren Gemütslagen herzustellen.
Keine Ankündigung ohne Vorankündigung: Bereits das Finale der Siebten, das zwischen orgiastischem Taumel und militärischer Straffheit schwankt, verdeutlicht, dass die idealistischen Lösungsvorschläge der Fünften und Sechsten nicht mehr taugen – also weder die ungebrochene ›Befreiungstheologie‹ der Fünften noch die Naturfrömmigkeit der Pastorale.
In der Achten ist es dann endgültig so weit: Kunst spiegelt nicht länger die Suche nach Sinnhaftigkeit, sondern drückt vielmehr deren Verlust aus. Der Sinfoniker Beethoven demonstriert seinen Hörern, was es heißt, ins Leere zu laufen. Vor allem das Allegretto der Achten verdeutlicht solchen Leerlauf auf das Drastischste. Die neuere biographische Beethoven-Forschung hat zwar keine sichere Antwort auf die Frage, ob und wie der Komponist in diesem Allegretto das Abschnurren eines Musikautomaten oder die Mechanik des Mälzelschen Metronoms auf Korn nehme. Doch das ist zum Verständnis des Satzes auch zweitrangig. Denn auch ohne programmatische Deutung fällt eine Satzanlage auf, die Peter Gülke mit Begriffen wie »addierende Montage«, »dialogische Aufsplitterung«, »Verstörung«, »untergründige Bosheit«, »Primitivität«, »Zerstäubung des Themas«, »jähes Aussetzen der musikalischen Pulsation« zu fassen versucht39 – sämtlich Phänomene, die Beethoven sehr kunstvoll ›ins Spiel‹ bringt.
Doch welches Spiel ist das? Dazu wollten die fünf gestandenen Beethoven-Kenner, die sich dem Allegretto in einem Round table aus Anlass des Berliner Beethoven-Kongresses von 1977 in Referaten und anschließenden Diskussionen äußerten, kaum Stellung nehmen. Ihr Round table war ja auch ausdrücklich der »Werkanalyse« gewidmet. Deren Ergebnisse wurden dann auch auf 79 eng bedruckten Seiten in einer so elaborierten Fachsprache dokumentiert, dass selbst mir als Fachmann beim Lesen angst und bange wurde, zugleich aber die Frage aufstieß: »Und nun?«
Gülke verstand sich zwar zu der einleitenden Feststellung, »daß von vornherein mehr gemeint war als nur die neue, von Beethoven als Möglichkeit zur genaueren Fixierung seiner Absichten begrüßte Erfindung« [des Metronoms].40 Doch auch er enthielt sich der an sich »lohnenden Aufgabe, vom Allegretto ausgehend die Merkmale, Möglichkeiten und Grenzen einer Gesamtkonzeption der 8. Sinfonie zu diskutieren«.41 Dabei liegt zumindest die Tendenz einer solchen Gesamtkonzeption offen zutage; und sie gewinnt an Trennschärfe, wenn man sie mit der Gesamtkonzeption der annähernd parallel komponierten Siebten vergleicht. Diese verfügt über einen dithyrambisch ausschwingenden Kopfsatz im hohen Ton, ein zur Einkehr einladendes Allegretto, ein spritziges Scherzo und – wie erwähnt – ein über weite Strecken orgiastisch anmutendes Finale. Ich wage diese arg pauschalisierende, an Konzertführertraditionen erinnernde Charakterisierung freilich nur als Gegenbild zur Achten vorzutragen: Dort gibt es vice versa einen gedrungenen Kopfsatz, ein geradezu auf Dekonstruktion abzielendes Allegretto, einen fast boshaft distanzierend wirkenden Satz im »Tempo di menuetto« und ein durch seinen Gestus geradezu verstörendes Finale.
Beethovens »Geistesblitze« fungieren im Fall der Achten nicht aufbauend, sondern destruierend. Nunmehr trifft in der Tat zu, was August Halm von der e-Moll-Episode im Kopfsatz der Eroica eher fahrlässig behauptet hatte, dass nämlich der Konstruktion »etwas irgendwie Schadhaftes« eigne. Und selbst das Wörtchen »irgendwie« trifft zu, weil man mit gleichem Recht behaupten kann, dass die Form – zumindest oberflächlich – schon »irgendwie« stimme. Eben diesen Eindruck von Widersprüchlichkeit will Beethoven erzielen: Er sieht sich weiterhin als ein Meister der sinfonischen Gestaltung; und als solcher nimmt er sich heraus, nach den Worten aus Schillers Lied von der Glocke zu handeln: »Der Meister kann die Form zerbrechen«. Während jedoch Schiller fortfährt: »mit weiser Hand zur rechten Zeit«, will der Beethoven der Achten nicht weise sein. Zu solcher ›Weisheit‹ wird er erst in den späten Klaviersonaten und Quartetten finden. Die Achte steht unter einem anderen Vorzeichen: Sie ist die in kunstvollem Sarkasmus geschaffene Ruine einer Sinfonie aus idealistischem Geist. In ein akustisches Bild gefasst: Beethoven bietet ein Protokoll dessen, was beim Schwerhörigen vom hohen Ton dieser »idealistischen Sinfonie« ankommt. Louis Spohr, der allerdings von Beethoven als Sinfoniker generell nicht viel hielt, hatte nicht Unrecht, als er angesichts des Cis, das in Takt 17/18 des Finales in ein dreifaches piano derb hineinfährt, behauptete, da strecke einem der Komponist mitten im Gespräch die Zunge heraus. Es geht hier um die erstmals von Wilhelm von Lenz so genannte »Schreckensnote«. Sie ist jedoch kein einmaliger Affront; vielmehr kommt das Cis – solch »strukturelle Weitsicht« ist sich der Dialektiker Beethoven schuldig – in der bemerkenswert ›falsch‹ angelegten Reprise (ab Takt 379) als Dominante eines fis-Moll zu neuen Ehren, das seinerseits in den F-Dur-Satz regelrecht hineinplatzt. Das insgesamt mit irrwischhaften, ja irrwitzigen Zügen ausgestattete Finale wertet Constantin Floros zu Recht als »das wohl glänzendste Beispiel für die Kunst des Imprévu aus der Zeit vor Berlioz«.42
Mit Imprévu taucht ein weiterer Terminus für die Sache auf, der sich dieses Buch verschrieben hat: Wieder geht es um die Unverfügbarkeit des Augenblicks, der als solcher sein Recht einfordert. Formanalytiker können zwar trefflich darlegen, weshalb die ›irregulären‹ Momente im Kopfsatz der Achten den gehobenen Ansprüchen Beethovens nicht genügen; und deshalb für eine »humoristische Distanzierung Beethovens« von der Gattungstradition sprechen.43 Doch das reicht nicht aus. Weiter nähert sich der Dirigent und ›Praktiker‹ Michael Gielen dem Sachverhalt, wenn er urteilt:
Der Humor ist ein Humor des Rumpelstilzchens, der ist grimmig. Da ist ein Ingrimm und eine zurückgedrängte und öfters ausbrechende Gewaltsamkeit.44
Dem entspricht Spohrs Bild von der »Schreckensnote« als eines Herausstreckens der Zunge, weil es vermag, das aktionistische und körpersprachliche Moment der Situation festzuhalten. Zwar eignen auch den Klangballungen im ersten Satz der Eroica körpersprachliche Momente; diese wollen jedoch in einen kompositorischen Gesamtprozess eingeordnet werden, während aus dem Finale der Achten die Einzelaktion hervorstechen soll.45 Das bedeutet jedoch nicht, dass Beethoven allein auf diese Einzelaktion setzte. Merkmal des Imprévu ist ja, dass er aus dem Zeitkontinuum heraussticht. Demgemäß nimmt der besonnene Künstler Beethoven die Gestaltung des Umfelds ebenso wichtig wie den Einfall des Imprévu selbst. Und er organisiert dieses Umfeld so geschickt, dass das Zeitkontinuum und der Einbruch des Unvermuteten gleichermaßen erfahrbar sind, und sogar das Eine das Andere stimuliert.
Wie groß die entsprechende Kunst Beethovens ist, zeigt der Vergleich mit einer frühen Komposition von Felix Mendelssohn Bartholdy, der generell – das soll nicht unerwähnt bleiben – schon als junger Musiker eine enorme Empathie für die Musik des späten Beethoven aufbrachte. Es geht um die »I-ah«-Stelle in der Ouvertüre zum Sommernachtstraum: Die vom Orchester nachgeahmten Rufe des aus einem Eselskopf herausschreienden Webers Zettel lassen sich wegen ihrer Derbheit zwar vordergründig mit Beethovens »Schreckensnote« Cis vergleichen; jedoch hat Mendelssohn Bartholdy den zweifachen Nonsprung dis-cis so elegant in das H-Dur des Tonsatzes integriert, dass die Hörer bestenfalls eine gelinde Provokation verspüren, diese jedoch zu Recht als liebenswürdigen Humor werten können.
Das Cis im Finale der Achten ist nicht einmal mit dem leiterfremden Cis vergleichbar, mit dem das Eingangs-»Thema« der in Es-Dur stehenden Eroica gleichsam vor die Wand gefahren wird. Dieses Cis ist nämlich strukturell von enormer Wichtigkeit, indem es schon früh die »Laufwege zustellt«: Pathetisch gesprochen, besteht der Sinn des weiteren Verlaufs der Eroica in der Anstrengung, den Weg ins Freie zu finden. In der Achten sucht Beethoven gar nicht mehr nach einem solchen Weg, demonstriert vielmehr – bis auf Weiteres – Ausweglosigkeit: ›So ist die Welt!‹