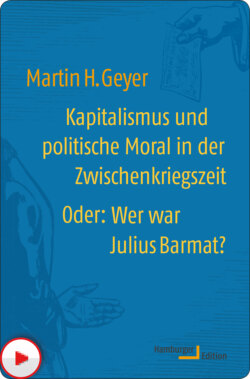Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 47
ОглавлениеZu Kutiskers früherem Leben liegen nur spärliche Informationen vor. Im ersten Urteil des Gerichts vom Juni 1926 heißt es leicht abschätzig, dass er den »Klein- und Zwischenhandel und zuletzt die Fabrikation von Öl und Fässern« betrieben habe. Im sehr viel längeren, von Kutisker angestrebten Revisionsurteil aus dem folgenden Jahr (Kutisker starb kurz vor dessen Verkündung) war dagegen schon positiver von einem »Kaufmann« die Rede.96 Kutisker hatte zu den wohlhabenden Bürgern der lettischen Stadt Libau (Liepāja) gehört. Er soll das erste Automobil der Stadt besessen haben, und sein Faible für schwere Fahrzeuge schien zu seinem Image als »Kriegsgewinnler« zu passen. Lukrative Aufträge für die russische Armee, die er in Sankt Petersburg abwickelte, ließen ihn wirtschaftlich prosperieren. Nach der russischen Oktoberrevolution schlug er sich nach seiner Rückkehr nach Libau auf die Seite der deutschen Okkupationsmacht und betätigte sich als Waffenhändler. Ein gewagtes Geschäft war der kommerzielle Erwerb des riesigen Pionierparks der 8. Armee, der nach Ausbruch der Revolution in Deutschland und der Räumung des bis dahin besetzten Gebiets nicht nach Deutschland zurückgeführt werden konnte. Es kam nicht zum erhofften großen Geschäft, da zunächst die Bolschewiki, dann die litauische Staatsregierung die Gerätschaften konfiszierten, sodass Kutisker nur kleinere Teile kommerziell verwerten konnte. Die Kontakte nach Litauen brachen aber nicht ab, was auch darin zum Ausdruck kam, dass ihm offenbar die litauische Gesandtschaft im Gebäude ihrer Residenz in der Budapesterstraße eine Wohnung zur Verfügung stellte.97
Dank seiner Kontakte zu Mitarbeitern deutscher Kriegsamtsstellen verfolgte Kutisker dieses risikoreiche Militärgeschäft nach seiner Übersiedlung nach Berlin weiter. Er bewegte sich in der Welt von mehr oder weniger dubiosen in- und ausländischen Händlern, die mit Waffen und altem Kriegsmaterial handelten. Alte Heeresbestände gab es in Europa im Überfluss und einen Markt dafür ebenfalls. Kutisker erwarb solche Heeresbestände, darunter große Posten von Militärstiefeln (aus den Beständen der sogenannten Altleder-Verwertungsstelle des Reiches), die er unter anderem nach Litauen exportierte.98 Anlässlich des Kaufs von 50000 Militärtornistern lernte er den – später ebenfalls angeklagten – früheren Bauunternehmer Gustav Blau kennen, der sich als Kriegslieferant von Segeltüchern und Lederwaren betätigt hatte und nach dem Krieg unter anderem mit Geräten der früheren amerikanischen Fernsprechabteilung in Koblenz handelte. Kutisker und Blau gründeten während der Inflationszeit die mit Heeresartikeln handelnde Blau G.m.b.H.99
Wie viele andere engagierte sich auch Kutisker im lukrativen Bankgeschäft. So erwarb er Ende 1921 die Aktienmehrheit des Bankhauses E. von Stein in Breslau, einer alteingesessenen Bank, die 1920 reorganisiert worden war, und zwar mit dem Ziel, für ein neu gegründetes, größeres Bankunternehmen das Depotrecht zu erlangen.100 Kutisker zahlte dafür 2,7 Mio. Papiermark, aber ein beträchtlicher Teil des Aktienpakets verblieb in den Händen des ursprünglichen Besitzers Dietrich von Stein. Der Sitz der Bank wurde von Breslau nach Berlin-Mitte in das Haus in der Jägerstraße, Ecke Friedrichstraße verlagert, das im Besitz der Firma Blau G.m.b.H. war. Die Geschäftsverbindungen der Steinbank beschränkten sich zunächst auf kommerzielle Bankinstitute, wie die bedeutende Disconto-Gesellschaft. Erst am 5. Oktober 1923 nahm sie Verbindungen zur Preußischen Staatsbank auf, wobei umstritten blieb, ob die Disconto-Gesellschaft den Geschäftsverkehr unterbrach, weil die Geschäfte Kutiskers nicht seriös waren.101 Da die Banken nach der Währungsstabilisierung den Kredithahn zudrehten, wurden für Iwan Kutisker die Geschäftskontakte zur Staatsbank umso wichtiger.
Die allerletzte Phase der Inflationszeit, von Oktober bis November 1923, stand für Kutisker ganz unter dem Stern erfolgreicher Geschäfte, in der Diktion der Zeitgenossen: kruder Spekulationen. Das verkehrte sich nach der Währungsstabilisierung ins Gegenteil, weil er (ähnlich wie Barmat), typisch für die Inflationsmentalität, »Sachwerte« mit Krediten erwarb, ohne diese nun mit entwertetem Geld zurückbezahlen zu können; er selber sagte explizit, nicht an die Währungsstabilisierung geglaubt zu haben.102 In Verbindung mit anderen wirtschaftlichen Fehlentscheidungen, darunter der Kauf einer weiteren Bank (mit einem Wohnhaus und teuren Automobilen, die ihn mindestens ebenso interessierten) im Dezember 1924, trieb ihn das schnell in den Ruin. Einmal mehr spielte die Preußische Staatsbank eine unrühmliche Rolle, da sie Kutisker weitere Kredite gab und dafür sorgte, dass er sich mit seinen Gläubigern – darunter Jakob Michael, den er des »Wuchers« beschuldigte – einigen konnte.103
Bis Mitte Oktober 1924 liefen Kredite von über 14,2 Mio. RM auf.104 Alles deutet darauf hin, dass es sich um Betrugsfälle in Form von Wechselfälschungen handelte. Spektakulär war der Fall Kutisker aber aus einem anderen Grund. Denn diese für die Zeit nicht gerade sensationellen Betrügereien verblassten gegenüber den Geschäften rund um das sogenannte Hanauer Lager. In diesem Fall tummelten sich vermeintlich naive, auf jeden Fall aber gelackmeierte Beamte der Staatsbank, Militärs, Agenten und zwielichtige Geschäftemacher des In- und Auslands mit richtigen und falschen Namen, darunter auch ein offenbar bestochener rumänischer Handelsattaché. Wer wen betrügen wollte, ließ sich am Ende kaum mehr entwirren, was der Sache einen fast schon tragisch-komischen Charakter gab. Als Opfer stilisierte sich nicht zuletzt auch ein Mittäter und wichtiger, wenn auch unseriöser Gewährsmann für die Ereignisse, nämlich der Waffenhändler, Hochstapler und Betrüger Michael Holzmann, ein Russe, der dann auch Kutisker übel erpresste, was Ende 1924 den ganzen Skandal schließlich ins Rollen bringen sollte. Holzmann prägte ganz entscheidend das Bild Kutiskers als rücksichtsloser, geldgieriger, jüdischer Verbrecher, der jederzeit bereit war, über Leichen zu gehen.105