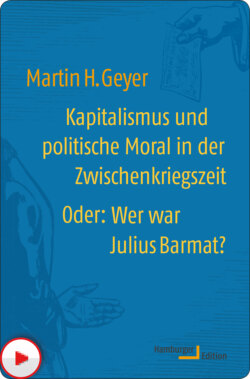Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 43
»Konzern-Genie« und Deflationsgewinnler
ОглавлениеWährend Julius Barmat (wie im Übrigen auch Iwan Kutisker) mit solchen Geschäftspraktiken, die im verbreiteten Sprachgebrauch als Wucher galten, scheiterte, gab es mit dem Unternehmer Jakob Michael einen Profiteur, der die Stabilisierungskrise gestärkt überwand. Auch gegen ihn ermittelte 1925 die Staatsanwaltschaft nicht nur wegen des Verdachts auf Betrug, sonder auch wegen Leistungs-, Provisions- und Preiswucher.82
Damaligen Zeitgenossen war Jakob Michael kein Unbekannter, während er in der neueren Forschungsliteratur oft übergangen wird – und das, obwohl er im Gegensatz zu Julius Barmat in der deutschen Wirtschaft keine marginale Rolle spielte. Der Unternehmer, der sich kaum öffentlich äußerte und sehr diskret agierte, hatte den Ruf, einer der »größte[n] Deflationsgewinnler in Deutschland« zu sein. Das verhalf ihm damals zu einiger Prominenz, da der 1890 in Frankfurt geborene Michael offenbar tatsächlich ein Organisations- und Finanzgenie war.83 Mit der Gewinnung und Vermarktung von Wolframschlacke, die im Erzgebirge als Restbestand früherer Verhüttung vorhanden war, erschloss er im Krieg eine akute Marktlücke und schuf die Grundlage seines späteren Konzerns. Wolframschlacke war kriegswichtig, denn daraus wurde die für die Härtung von Stahl notwendige Wolframsäure gewonnen. Michael verschaffte sich in diesem Wirtschaftszweig eine Monopolstellung.
Die Staatsanwaltschaft interessierte sich später auch in seinem Fall bezeichnenderweise für seine Geschäfte während des Krieges, namentlich die Preisgestaltung und die zeitweise Übernahme des Betriebs durch Kriegsamtsstellen (wofür Michael Entschädigungszahlungen einforderte), aber auch für triviale Dinge wie die Verletzung der Sonntagsarbeit (in der Annahme, dass diese von einem jüdischen Unternehmer veranlasst worden sei). Der andere Zweig des Unternehmens war der Handel mit Chemikalien und pharmazeutischen Produkten. Die 1916 gegründete Firma J. Michael und Co. verwaltete bald eine Reihe von deutschen und ausländischen Firmen. Michael erwies sich als ein großer Meister der Inflationsfinanzierung. Er war ein gut eingeführter Geschäftskunde bei der Preußischen Staatsbank, bei der seine Firma in der zweiten Jahreshälfte 1923 mit Krediten in der Höhe von 20 Trillionen Papiermark in den Büchern stand.84
1924 zählte Michael zu den reichsten Männern Deutschlands. Während andere Firmen infolge der Stabilisierungskrise ins Schleudern kamen, florierte Michael. Wie machte er das? In der Berliner Wirtschaftspresse war man der Meinung, dass sein Erfolg darin bestanden habe, dass er nicht nur an die erfolgreiche Währungsstabilisierung geglaubt, sondern es auch wie wenige andere verstanden habe, sich auf die radikal veränderte wirtschaftliche Situation einzustellen. Konkret heißt das, dass er in der allerletzten Phase der Hyperinflation und im Übergang zur Währungsstabilisierung gegen den Herdentrieb der Spekulanten systematisch (infolge der Inflationspanik überbewertete) Aktien und Konzernteile, also »Sachwerte«, verkauft haben soll. Dazu nahm er – gegen jede Intuition, wie es scheinen mochte – schier astronomische Papiermarkbeträge an, was zur Folge hatte, dass er nach der Währungsstabilisierung und der Festsetzung des neuen fixen Kurses von Rentenmark und Papiermark außerordentlich liquide war.85 Das hieß aber auch: Wäre die Währungsstabilisierung gescheitert, hätte das für ihn fatale Folgen gehabt.
Was an dieser Erfolgsgeschichte einer genialen Spekulation Legende und was Tatsache ist, lässt sich kaum mehr sagen. Sie war auf jeden Fall Stadtgespräch. Der Michael-Konzern transformierte sich zur gleichen Zeit in Richtung einer Holding-Gesellschaft, die sehr umfangreiche Kredite aufnahm und vergab und ähnlich wie Barmat, aber in größerem Umfang, Anteile von Versicherungen und Industrieunternehmungen übernahm. Im November 1923 war er in der Lage, dem Reichseisenbahnamt und auch der Reichspost Millionenkredite u. a. in Form von Dollarschatzanweisungen zu verschaffen; für seine zunächst klammen öffentlichen Schuldner war attraktiv, dass sie die aufgenommenen Kredite mit Papiermark bedienen konnten.
Die Berliner Staatsanwaltschaft sah die Dinge jedoch grundsätzlich anders. Der gegen die liberale Berliner Wirtschaftspresse erhobene Generalverdacht lautete, dass deren Berichte über Michaels clevere »Flucht aus den Sachwerten« im »Interesse der Verschleierung« der Zusammenhänge gezielt lanciert worden seien.86 Nicht dessen Flucht aus den Sachwerten, sondern der Rückgriff auf seine ausländischen Finanzressourcen, dann aber ganz entschieden die Kredite der Preußischen Staatsbank und später auch die der Reichspost (und zwar in einem ähnlichen Verfahren, wie wir es im Falle Barmats sahen) hätten es Michael für kurze Zeit ermöglicht, als größter Kreditgeber Deutschlands aufzutreten und damit wertvolle Teile der deutschen Wirtschaft unter Kontrolle zu bringen. Kredite, für die ihm meist nicht mehr als 2,5 Prozent pro Tag [sic!] berechnet wurden, habe er für einen vielfach höheren Satz weiterverliehen. Genau hierin lag der Vorwurf des »(Zins-)Wuchers« begründet, der ganz prominent gegen ihn, wie aber auch gegen Barmat, erhoben wurde. Demnach habe sein Konzern prosperiert, da er dank dieser hohen Zinsgewinne nun geschickt in Banken und Versicherungen, aber auch ins Textilgeschäft investierte, dabei strategische Aktienanteile erwarb und ins Immobiliengeschäft einstieg, wofür er Kredite bei den von ihm mitkontrollierten großen Banken und Versicherungen erhielt. Das Urteil des amerikanischen Time Magazine, dass er in Banken- und Unternehmerkreisen ein »man feared, hated, despised« sei, war offenbar so falsch nicht.87
Die Staatsanwaltschaft sammelte emsig Zeugenberichte, die in einer ganzen Reihe von Fällen, die auch Großbanken betrafen, den Vorwurf des Wuchers erhärten sollten. Danach war Michael »damals der teuerste Geldgeber«, ja mehr noch, er habe »in der Hauptsache die hohen Zinssätze jener Zeit verschuldet […]. Wer in Geschäftsbeziehungen zu Michael getreten war, konnte schwer von ihm loskommen.« Zeugen wurden zitiert, wonach Michael bei der Rückzahlung der Kredite die Herausgabe der als Sicherheit geleisteten Effekten verzögert habe, sodass sie dem Geldsuchenden für neue, eventuell billigere Kredite bei anderen Stellen nicht rechtzeitig zur Verfügung gestanden hätten und der Schuldner dann gezwungen gewesen sei, erneut Darlehen bei ihm aufzunehmen und die von ihm diktierten hohen Zinssätze annehmen musste.88 In solchen Beschuldigungen kommt nicht nur der klassische Wuchervorwurf zum Vorschein. Alles deutet darauf hin, dass die Berliner Staatsanwaltschaft einen großen »Wucherprozess« plante.
Zu einer Anklage kam es aber nicht. Im Sommer 1924 war Michael zwar der bei Weitem größte Schuldner der Preußischen Staatsbank. Aber im Gegensatz zu Barmat und Kutisker gelang es ihm noch 1924, seine dortigen Schulden (ebenso wie bei der Reichspost) zu reduzieren, und schon im April 1925 zahlte sein Konzern die letzte Rate von 10 Mio. GM zurück.89 Damit bot er wenig Angriffsfläche. Außerdem war es fraglich, ob es sich bei den geforderten Zinsen in der chaotischen wirtschaftlichen Übergangssituation tatsächlich um »Wucher« handelte. Das war in der öffentlichen Debatte ebenso umstritten wie zwischen Juristen, die auf die Gesetze pochten, und Ökonomen, die auf die Folgen für die Wirtschaft verwiesen.90
Sehr zum Leidwesen der Staatsanwaltschaft wurde der Fall Michael dann auch mangels ausreichender Beweise und mit Blick auf die rechtliche Dimension des Falles ganz eingestellt.91 Rückblickend aus dem Jahr 1933 betonte der vormals mit dem Fall betraute frühere Erste Staatsanwalt, dass es das Ziel gewesen sei, die »Vermögenswerte des Michael« als Entschädigung für den von ihm angerichteten Schaden zu beschlagnahmen; die Einstellung des Falls sei auf »höhere Einwirkung«, sprich politische Stellen, hin erfolgt. Aber das war im Mai 1933, zu einem Zeitpunkt, als der staatliche Zugriff auf das Vermögen Jakob Michaels längst begonnen hatte, worauf noch ausführlicher zurückzukommen sein wird.92