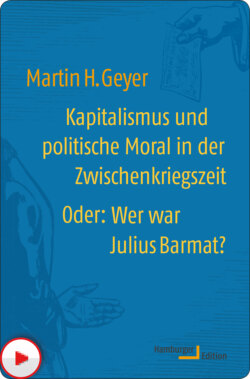Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 26
Im Kreis konservativer Sozialdemokraten:
Gesellige Runden in Berlin und Schwanenwerder
ОглавлениеEin zentraler Grund für die beschriebenen Verdächtigungen war die Tatsache, dass sich Barmat seit seiner Ankunft in Deutschland im sozialdemokratischen Milieu der Stadt Berlin bewegte. Der Sozialdemokrat Wilhelm Keil, der 1920 im Auftrag des württembergischen Ernährungsministers Verhandlungen mit ihm in Berlin führte, berichtete in seinen Erinnerungen über einen Besuch bei dem Unternehmer, dem der Ruf vorauseilte, »gewaltige Mengen Fett«, »Fett, wonach die Bevölkerung lechzte«, aus Holland nach Berlin und Sachsen einzuführen. Er habe sich bei Barmat im Hotel Bristol angemeldet und »eine wunderbar ausgestattete Hotelwohnung« betreten. Barmat sei sofort auf sein Anliegen eingegangen, habe aber die geschäftlichen Bedingungen nicht direkt besprechen wollen. Er habe ihn zunächst zu einem »solennen Abendessen« eingeladen, bei dem führende Parteigenossen um die Tafel versammelt gewesen und edle Weine, Zigarren und Sekt serviert worden seien. Dabei wurde es wohl spät, und der Württemberger verabschiedete sich unter irgendeinem Vorwand »zu einer Stunde, als die Gesellschaft noch nicht daran dachte, sich aufzulösen«. Am folgenden Tag habe er zwar die ihm angebotene Zigarre und den Cognac angenommen, aber die Einladung zum Mittagessen abgelehnt; den Geschäftsabschluss über eineinhalb Millionen Mark überließ er seinem württembergischen Ernährungsminister, ebenfalls einem Sozialdemokraten.86
Diese Essen Barmats mit Parteifreunden wurden später genau unter die Lupe genommen. Stimmte es, dass sich der Amsterdamer Unternehmer privat mit Hausmannskost, gebratenen Heringen und Rindfleisch begnügte, wie sein Freund Ernst Heilmann im preußischen Untersuchungsausschuss den ungläubigen bis belustigten Zuhörern mitteilte? Oder wurde bei Barmat doch »geschlemmt«, wie das auch Keil insinuierte und was in einer Zeit mit »Schlemmereigesetzen« besonders verwerflich war? Das später verhörte Hotelpersonal des »Bristol« konnte das nicht bestätigen: Barmat lebte offenbar tatsächlich eher bescheiden und verhielt sich ansonsten nicht anders als die meisten anderen »Devisenausländer«, was vielen Deutschen in dieser Zeit aber verwerflich genug erschien.87 Von einem kommunistischen Abgeordneten auf die »glänzende Bewirtung« bei Barmat angesprochen, meinte der Gesandte Sachsens in Berlin, Georg Gradnauer (SPD), mit einem Augenzwinkern, dass das wohl stimmen möge – aber dass die Bewirtung »nicht so glänzend« wie etwa in der sowjetischen Vertretung gewesen sei.88
Barmat prahlte zweifellos mit seinen politischen Kontakten zur neuen republikanischen Regierung und versuchte, seine politischen Beziehungen gezielt auszuspielen. Für ihn, den Aufsteiger und Ausländer, der über keine langjährigen Verbindungen zu Politik und Bürokratie verfügte, waren diese Kontakte wichtiges soziales Kapital. Fast alle, die mit ihm in Berührung kamen, zogen solche Schlüsse – spätestens 1925. Einigen dämmerte dabei auch, dass Barmat die vielen Liebesgabenpakete, die er von Holland an Bedürftige sowie alte und neue Bekannte verschicken ließ, die Spenden wie die für ein Kinderheim im sächsischen Pirna, das er auf Bitte des sächsischen Ministerpräsidenten Schwarz unterstützte, oder die bescheidenen finanziellen Zuwendungen für das sozialdemokratische Köpenicker Tageblatt, gezielt als Werbekosten für seine eigene Sache einsetzte (was dann dem Vorwurf der Bestechung und Korruption Auftrieb gab). Barmat verstand solche Anschuldigungen nicht: Er, der über Geld verfügte, lud selbstverständlich seine Freunde und Geschäftskollegen ein, aus welchen Parteien auch immer sie stammten, egal ob bürgerlich oder von der Zweiten oder Dritten (kommunistischen) Internationale.89
Mehr als alles andere beflügelte Barmats wohnräumliche Nähe zu dem früheren Vordenker der russischen Linken, Geschäftsmann, Spekulanten und 1916 eingebürgerten »Ostjuden« Israil Lasare-witsch Helphand, genannt Alexander Parvus-Helphand, Verschwörungstheorien. Beide wohnten 1923 in Schwanenwerder, wohin Barmat Anfang des Jahres gezogen war. Wilhelm Keil kannte Helphand noch als Hungerleider aus den 1890er Jahren, als sich der aus Preußen ausgewiesene Sozialdemokrat zeitweise in Stuttgart niedergelassen hatte. Der russische Revolutionär und linke Theoretiker, der mit seinen Moralvorstellungen seit jeher seine deutschen Genossen zu schockieren vermocht hatte und vor dem Krieg aus der Partei ausgeschlossen worden war, hatte sich als Handeltreibender neu erfunden. Ab 1910 lebte er dank seiner Kontakte zu Jungtürken und türkischen sowie armenischen Sozialisten im Osmanischen Reich, wo er sich als Autor politischer und ökonomischer Schriften sowie als Unternehmer, genauer: als internationaler Waffenhändler, der mit deutschen und englischen Rüstungsfirmen wie Krupp und Vickers zusammenarbeitete, betätigte. Die Balkankriege und dann der Weltkrieg entwickelten sich für ihn zu einem großen Geschäft. Im Kontakt mit dem jungtürkischen Nationalismus wurde Helphand selbst ein glühender Nationalist, der schon vor dem Krieg Kontakte zu deutschen militärischen und diplomatischen Stellen pflegte. Wie bei Barmat saß sein Hass auf das Zarenreich tief. Gleich nach Kriegsausbruch 1914 befasste er sich mit Insurrektionsplänen für Russland, die zur Einschleusung Lenins nach Russland im Jahr 1917 führten. Die Revolution in Russland sollte den Weg nicht für die Bolschewiki, sondern für ein neues sozialdemokratisches Zeitalter ebnen. In diesem Zusammenhang hatte der Ex-Revolutionär große Pressepläne, ganz ähnlich denjenigen, die offenbar auch Barmat 1919 ventilierte.
1920 war Helphand wieder in Berlin, nachdem die Schweizer Behörden den politisch verdächtigen Revolutionär aus seinem noblen Domizil am Zürichsee und dem Land verwiesen hatten.90 Wilhelm Keil war auf jeden Fall erstaunt, als er Helphand, den er noch mit zerfransten Hosen in Erinnerung hatte, nun nach dem Krieg in Schwanenwerder »wohlgepflegt im eleganten Anzug« und mit einer jüngeren Frau an der Seite wiederbegegnete. Weitere Einladungen Barmats schlug Keil aus, und zwar nicht nur, weil er, wie er vermerkte, von den delikaten Speisen nicht satt wurde: »Die ganze Atmosphäre sagte mir nicht zu. Ich mochte nicht Stipendiat eines Kriegsgewinnlers sein. Wenn Parteifreunde von Rang sich hier wohl fühlten, so fand ich damit das Wort bestätigt: Über den Geschmack läßt sich streiten.«91 Leider enthält Keil in seinen Erinnerungen dem Leser vor, wer die »führenden Parteigenossen« waren, die er beim Essen mit Barmat wie dann auch bei Helphand antraf. Beide hatten offenbar denselben Bekanntenkreis, auch wenn es keine Hinweise darauf gibt, dass Julius Barmat und Helphand miteinander in geschäftlichen Verbindungen standen, ja nicht einmal, dass sie persönliche Kontakte pflegten. Zum gemeinsamen Bekanntenkreis zählten neben dem Ex-Reichskanzler Philipp Scheidemann der SPD-Parteivorsitzende Otto Wels, dessen Sohn Sekretär von Helphand war, der preußische Kultusminister Konrad Haensch, der zeitweilige sächsische Ministerpräsident (1919), Reichsinnenminister (1921) und sächsische Gesandte in Berlin Georg Gradnauer und neben Ulrich Rauscher und Victor Neumann wahrscheinlich auch der spätere Reichskanzler Hermann Müller sowie der Politiker Ernst Heilmann und der Journalist Erich Kuttner.92 Wie der Berliner Polizeipräsident Richter (SPD) später aussagte, verabredete man sich meist »zwang- und formlos« im Reichstag oder Landtag und begab sich dann oft ins Hotel Bristol, wo Barmat logierte: »Wenn wir zu Herrn Barmat hinkamen, lud er in der Regel zum Abendessen ein«, das in den Zimmern eingenommen wurde. Der »Hauptzweck« für die Besuche war, so Richter, »daß ich dort in der Regel politische Freunde traf, mit denen ich meine Meinungen über politische Fragen austauschen konnte«.93
Der aus der Partei ausgeschlossene Helphand war in der SPD zwar umstritten, aber nicht ohne Einfluss. Im Gegenteil: Seit dem Krieg sammelte sich um ihn, besser gesagt um Helphands Presseorgane, eine Gruppe von stark nationalistisch orientierten Sozialdemokraten, die den Kriegskurs des Deutschen Reiches vorbehaltlos unterstützten, sei es aus Patriotismus, sei es, weil sie mit Krieg und Kriegssozialismus eine neue sozialdemokratische Ära heraufziehen sahen. Diese Gruppe verband die 1915 von Helphand zunächst als Halbmonats-, dann als Wochenschrift ins Leben gerufene und finanzierte Zeitschrift Die Glocke. Sie erschien im Verlag für Sozialwissenschaft, in den 1917 auch die erworbene Internationale Korrespondenz über Arbeiterbewegung, Sozialismus und ausländische Politik sowie die Sozialdemokratische Feldpost integriert wurden.94 Der Verlag für Sozialwissenschaft war insofern von – heute weithin unterschätzter – Bedeutung, als darin bis 1925/26 zahlreiche republikanisch-staatstragende Publikationen, darunter auch Schriften, die Barmat verteidigten, erschienen.
Viele Autoren, darunter bekannte Parteiführer der Republik, die seit dem Krieg zum Teil von anderen Zeitschriften wie den Sozialistischen Monatsheften abgeworben worden waren, kamen dank Helphand in Lohn und Brot. Ein Linker wie Karl Radek hatte denn auch nur Spott und Verachtung für diese Gruppe von Sozialdemokraten übrig, die sich auf die Seite Ludendorffs und der »Reaktion« stellten. Mit diesem Urteil unterschied er sich wenig von dem aus dem Eulenburg-Skandal der Vorkriegszeit bekannten Enthüller homosexueller Beziehungen der Entourage um den Kaiser, dem Publizisten Maximilian Harden. Höhnend zitierte Radek den von Parvus-Helphand schon im Krieg »gemietheten Redakteur« der Glocke, Conrad Haenisch, dass es das Ziel sein müsse, »die deutsche Arbeiterschaft zum deutschen Staatsgedanken zu erziehen«. Die Zukunft des deutschen Kapitalismus und damit die Zukunft der deutschen Arbeiterbewegung zu gefährden, hieße auch die Zukunft des internationalen Sozialismus zu gefährden, hatte der 1918 zum preußischen Kultusminister ernannte Haenisch zu Beginn des Krieges geschrieben. Andere, wie die Sozialdemokraten Paul Lensch und Heinrich Cunow, in deren Umfeld sich auch Barmats Freund, der Vorsitzende der preußischen SPD Ernst Heilmann bewegte, hatten sich, wie andere Autoren im Umfeld der Glocke, vehement auf die Seite der Verfechter eines Siegfriedens Deutschlands geschlagen und sich zudem auch für Annexionen ausgesprochen.95
Es war allgemein bekannt, dass die Publikationen des Verlags für Sozialwissenschaft nicht nur auf hohe Zuschüsse des »Kriegsgewinnlers« Helphand angewiesen waren, sondern dass er auch außergewöhnlich gute Honorare bezahlte. Über die politischen Einflüsse im Hintergrund mochte man spekulieren: Der Herausgeber der Feldpost, der preußische Sozialdemokrat Erich Kuttner, der im Skandal 1925 als Verteidiger Barmats eine zentrale Rolle spielen sollte, hatte die Zeitung auf einem strammen Kriegskurs gehalten, wobei die Heeresleitung einzelne Artikel Kuttners offenbar als Flugblätter in Massenauflage verbreitet hatte. Wie etwa Ernst Heilmann war auch er ein rabiater Antibolschewist.96
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich um Barmat wie Helphand konservative Sozialdemokraten gruppierten. Ein – seriöser – Insider wusste zu berichten, dass eine mit dem Verlag für Sozialwissenschaft räumlich verbundene Wohnung in der in der Nähe des Reichstags gelegenen Regentenstraße SPD-Führern während des Kriegs und während der Revolutionsphase als »neutraler Boden für Besprechungen« gedient hatte. Andere, von den Gesprächen Ausgeschlossene, sahen das anders: Es kam der Verdacht auf, dass an diesem Ort konspirative Pläne der Partei-Rechten der SPD gegen die Linke geschmiedet worden waren.97