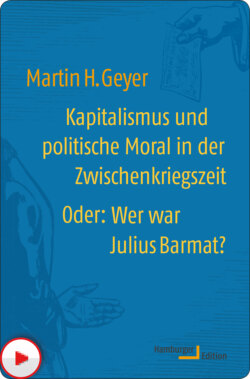Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 27
Der Fall Sklarz
ОглавлениеPersonen aus dem informellen politischen Kreis, die sich gelegentlich in Schwanenwerder um Helphand versammelten, standen erstmals 1919/20 im Mittelpunkt scharfer Angriffe und von Skan-dalisierungsversuchen – also zur gleichen Zeit, als auch die Lebensmittelgeschäfte Barmats erstmals Gegenstand öffentlicher Empörung wurden.98 Im Zentrum befand sich mehr noch als Helphand sein Kompagnon, der in Breslau geborene Georg Sklarz, der ebenfalls jüdischer Konfession war.
Anfang 1920 erschien in der deutsch-völkischen Buchhandlung Fr. Warthemann in Berlin die Broschüre Der Rattenkönig. Revolutions-Schieber und ihre Helfer. Die Wahrheit über den Fall Sklarz. Der anonyme Autor publizierte unter dem Pseudonym Sincton Upclair, dem verballhornten Namen des bekannten sozialkritischen Schriftstellers Upton Sinclair, mit dem Zeitgenossen das »muckraking«, das Aufwirbeln von Mist und Dreck, d. h. die Anprangerung von sozialen und politischen Missständen verbanden. Dem Verfasser des Rattenkönigs ging es um die »Reptilien aus dem roten Sumpf«, die Korruption der Republik und der Sozialdemokraten.99 Die auf dem Titelblatt abgedruckte Lexikonnotiz evoziert darüber hinaus ein anderes, nicht minder drastisches Bild, nämlich das einer Verschwörung: »Der Rattenkönig ist eine Gesellschaft von Ratten, die im Nest durch eigenen Schmutz und Unrat derart verknüpft und verfilzt sind, daß sie nicht mehr auseinander können.«
Im Mittelpunkt des Rattenkönigs standen dubiose Import- und Exportgeschäfte Helphands und Georg Sklarz’, die allesamt auf deren Involvierung in die Russische Revolution, und zwar in Verbindung mit dem Auswärtigen Amt, verwiesen. In Berlin pfiffen die Vögel von den Dächern, dass Helphand und Georg Sklarz im Zusammenhang mit den Plänen zur Revolutionierung Russlands Handelsprivilegien erhalten hatten und zahlreiche Geschäfte nach der Revolution weiterführen konnten; einige wussten zweifellos auch, dass Georg Sklarz für den militärischen Geheimdienst gearbeitet hatte. Im Mittelpunkt des Pamphlets standen aber vor allem Sklarz’ Aktivitäten während der deutschen Revolution, bei denen sich Politik und Geschäft tatsächlich auf eklatante Weise verquickt hatten. Sklarz hatte nicht nur Export- und Importgenehmigungen, sondern auch Vollmachten zum Aufkauf von Lebensmitteln erhalten, und zwar im Zusammenhang mit der Marketenderei für die Versorgung von republikanischen Truppen mit Lebensmitteln in Berlin (wie dann auch für das Freikorps Lüttwitz im Frühjahr 1919). Diese Lebensmittellieferungen wurden im Nachhinein aus der Reichskasse bezahlt. Im Rattenkönig war die Rede von »Koffern«, ja »ganze[n] Droschken voll« Nahrungsmitteln und »Fässern von Margarine«, die Sklarz zur Bestechung republikanischer Politiker gedient hätten, um an diese öffentlichen Aufträge zu gelangen.100 Neben dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert wurde vor allem der Reichskanzler Philipp Scheidemann (SPD), dessen Schwiegersohn Fritz Henk für Sklarz arbeitete, unflätig beschimpft, und Scheidemanns Ruf sollte im Zuge der Kampagne nachhaltig beschädigt werden.
Von den Russlandgeschäften abgesehen, waren die erhobenen Vorwürfe ziemlich absurd. Mit Blick auf unsere weitere Geschichte sind aber verschiedene Punkte von Bedeutung, und das nicht nur, weil in der Folgezeit im Zusammenhang mit Barmat immer auch auf den Fall Sklarz Bezug genommen werden sollte.
1. Mehr noch als in der bisherigen Geschichte Barmats taucht im Fall Sklarz der Topos von »den Juden« auf, die Helfershelferdienste für die Sozialdemokratie leisteten. Das hatte bei Sklarz einen realen Hintergrund, denn er war maßgeblich an der Gründung der privaten Berliner Wachdienst G.m.b.H beteiligt, aus der noch im Dezember 1918 der sogenannte Helferdienst der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hervorging. Im Zusammenhang mit dem »Spartakusaufstand« und den nachfolgenden Unruhen in Berlin im Januar 1919 wurde diese Truppe zur Besetzung und Sicherung des Reichstags abkommandiert, wobei sich einmal mehr der Name änderte: Die Bezeichnung lautete nun Republikanische Schutztruppe, die aus zwei Regimentern namens »Reichstag« und »Liebe« bestand. Georg Sklarz spielte dabei die eigentümliche Rolle nicht nur eines privaten Unternehmers und Kriegsfinanziers, sondern auch eines Marketenders (was nun alles ganz der Weber’schen Definition des »vormodernen«, »politischen Kapitalismus« entspricht). Als der Wache der Reichskanzlei und den übrigen Truppeneinheiten, darunter das Regiment »Reichstag«, im Zuge des Spartakusaufstands der Proviant ausging, griff die Provisorische Reichsregierung auf die von Sklarz angebotene Hilfe zurück: »[F]ür Überlegen war keine Zeit«, so Friedrich Ebert rückblickend; ohne Sklarz, so Scheidemann, »hätten (wir) totsicher [sic!] die spartakistische Herrschaft bekommen«.101 Sklarz hatte offenbar einen Blankokredit über 750000 Mark vom Berliner Bankhaus S. Bleichröder aufgenommen und will, wie er später – wohl etwas vollmundig – versicherte, zusammen mit eigenen Mitteln über »1,200 000 Millionen [sic!] ausgegeben [haben], ohne Sicherheit oder auch nur ein Versprechen zu haben, dass ich jemals einen Pfennig zurückerhalten würde«.102 Dafür erhielt Sklarz von Ebert und Scheidemann unterschriebene Vollmachten, die ihm und seinen Helfern unter Umgehung der öffentlichen Stellen den Ankauf von Lebensmitteln ermöglichten.
Revolutionäre Profitgier schien über politische Moral und Sauberkeit zu siegen – so sahen es auf jeden Fall die Kritiker. Und nicht nur das: Den einen war es ein Gräuel, wie sich die angeheuerten republikanischen Soldaten im Reichstag aufführten und Inventar zerstörten und entwendeten. Aber das war nur die eine Seite. Andere – nicht unbegründete – Vorwürfe reichten von Misshandlungen bis Mord an in Haft genommenen spartakistischen Soldaten; das betraf auch den später loyalen Barmat-Gefährten Erich Kuttner, der einen Spartakisten in Notwehr erschossen hatte, was ihm noch Jahre später die Kommunisten, aber auch Nationalsozialisten vorwerfen sollten.103 Tatsächlich herrschte in den Reihen der republikanischen Truppen eine ausgeprägte anti-spartakistische Stimmung. Einer seiner früheren Mitstreiter aus dem militärischen Geheimdienst charakterisierte den Anti-Bolschewisten Georg Sklarz folgendermaßen: »Er [Sklarz – MHG] wolle nicht, dass in Deutschland auch die Kinder mit dem Schädel gegen die Wand geschlagen werden und jeder, der mit einem Stehkragen herumlaufe, auf der Straße ermordet wird.«104 Überdies gab es Gerüchte, dass Sklarz eine Kopfprämie für die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ausgelobt habe.105 Kein Wunder, dass die radikale Linke den Verrat der Sozialdemokratie an der Revolution skandalisierte.
2. Die Revolution als »großes Geschäft«, und zwar in Tateinheit mit Korruption, tauchte zunächst in konservativen Polemiken gegen die »A[rbeiter]- und S[oldatenräte]-Wirtschaft« auf. Bald war in der konservativen Presse die Rede von »Revolutionsgewinnlertum«. Von hier war es kein großer Schritt mehr zum Vorwurf der »revolutionären Miß- und Korruptionswirtschaft«, auf welcher die junge Republik angeblich beruhte.106 Hier setzten die Korruptionsdebatten ein, mit denen zunächst insbesondere der erste Finanzminister der Republik Matthias Erzberger (Zentrum), ein scharfzüngiger Kritiker der kaiserlichen Eliten, überzogen wurde.
Den ersten massiven Angriff lancierte im Sommer 1919 der frühere Staatssekretär im Reichsfinanzministerium Karl Helfferich (DNVP) mit seinem Pamphlet Fort mit Erzberger!. Helfferich attackierte den vom anfänglichen Annexionisten zum Mitinitiator der Friedensresolution 1917 mutierten Politiker und Unterzeichner des Waffenstillstandsvertrags als »Reichsverderber«. Neben Meineid und Landesverrat warf er Erzberger auf jedem Schritt seiner Karriere »eine unsaubere Vermischung politischer Tätigkeit und eigner Geldinteressen« vor. Helfferichs Leitmotto »Korruption« als »Schwester von Demokratie und Parlamentarismus« wurde von »Sincton Upclair« im Rattenkönig nicht nur zitiert, sondern auch systematisch, gegen die Sozialdemokratie gerichtet, weitergesponnen.107 In die gleiche Richtung zeigten zwei weitere mit Sincton Upclair gezeichnete Schriften: Die Korruptionszentrale und Erzberger kommt wieder!!!.108 Die ersten öffentlichen Angriffe auf Barmat zur gleichen Zeit sind in diesem Kontext des aufblühenden Korruptionsdiskurses zu sehen.
3. Der Rattenkönig erschien in einem deutsch-völkischen Verlag. Das verweist auf die spätere Skandalisierung Barmats im Umfeld der Völkischen und der Deutschnationalen. Tatsächlich führt die Autorenschaft des Rattenkönigs aber zunächst in die Reihen der Linken, namentlich zu Personen, die aus privaten wie aus grundsätzlichen Gründen ein Interesse an der Skandalisierung von Sklarz und der SPD-Führung hatten. Triviales vermischte sich mit politischen Motivationen: Der ursprüngliche Initiator war der sozialdemokratische Journalist Hermann Sonnenfeld, dessen Sohn nicht nur für Sklarz gearbeitet hatte, sondern samt der Sklarz’schen Sekretärin mit einer beträchtlichen Summe Geld aus der Betriebskasse und entwendeten Geschäftsdokumenten ins Ausland geflohen war, woraus sich ein Fall von Erpressung entwickelte (der auf Betreiben von Sklarz ein gerichtliches Nachspiel haben sollte).
Als Erster griff Maximilian Harden, der Herausgeber der Zeitschrift Die Zukunft, den Fall auf. Dieser über Deutschland hinaus bekannte, bei der politischen Rechten auch wegen seiner jüdischen Konfession verhasste deutsche Publizist und muckraker hatte vor dem Krieg eine wichtige Rolle beim bereits erwähnten Eulenburg-Skandal gespielt. Harden stand in der Causa Sklarz in engem Kontakt mit seinem alten Bekannten Georg Davidsohn, einem promovierten Philosophen und Journalisten, der seit 1912 für die SPD im Reichstag und in der Nationalversammlung saß, wo sich der Vertreter der Anti-Alkoholbewegung und sozialistischen Eugenik auf dem eher trockenen Feld der Geschäftsordnung hervorgetan hatte.109 Davidsohn zählte zu den Zukurzgekommenen der Revolution, die überall die Ausbreitung eines krassen Materialismus sahen und Ressentiments gegen »Kriegsgewinnler« wie Georg Sklarz und Parvus-Helphand hegten, wobei neben politischen Bedenken wahrscheinlich auch seine Abneigung gegen Ostjuden eine Rolle spielte. Das vermischte sich bei Davidsohn mit einer genuinen Kapitalismuskritik, die in der Form einer Korruptionskritik vorgetragen wurde. Die SPD müsse sich von zwielichtigen Gestalten wie Sklarz distanzieren, lautete die Parole.
Enttäuscht von der Ablehnung, auf die sie in der Partei stießen, gingen Sonnenfeld und Davidsohn mit dem Enthüllungsmaterial bei der Berliner Presse hausieren und landeten schließlich bei dem den Deutschnationalen nahestehenden Pressedienst von Vater und Sohn Sochaczewski, die gleichermaßen politisches wie kommerzielles Interesse an der Geschichte hatten. Vater Martin Sochaczewski war als Mitarbeiter und Chefredakteur mehrerer Zeitungen im konservativen Umfeld gut vernetzt; bei der Gründung 1921 trat er dem Verband nationalkonservativer Juden bei. Seit dem 25. November 1919 verteilte sein Pressedienst hektografierte Berichte mit Titeln wie »Revolutionsschieber«, »Geschichte der Glocke« (bei der Glocke handelte es sich um die oben erwähnte, von Parvus-Helphand lancierte Zeitschrift, der vorgeworfen wurde, gegen gute Honorare Politiker zu kaufen), »Gefälschte Dokumente« und »Roßfleisch statt Rindfleisch«.110 Diese journalistischen Handreichungen fanden zusammen mit später erzählten Geschichten den Weg in den Rattenkönig.
Diese Zusammenhänge sind nicht nur von Bedeutung, weil Transferprozesse zwischen linker und rechter Korruptionskritik deutlich werden. Aufmerksamkeit verdient dabei zunächst besonders das Engagement der Linken, die in der Vorkriegszeit Skandale und Korruption als Mittel der Herrschaftskritik eingesetzt hatte. Seit der Revolution wurde diese Kritik nun vom linken Flügel stark zugespitzt und richtete sich nicht zuletzt gegen Personen, die vormals zu scharfen Kritikern des Kaiserreichs gehört hatten. Auch vor diesem Hintergrund erklärt sich das Engagement der Linken im Fall Sklarz, wie später dann auch im Fall Barmat. Die zu dieser Zeit weitverbreitete USPD-Zeitung Die Freiheit und Franz Pfemferts Die Aktion. Zeitschrift für revolutionären Sozialismus schossen sich auf das Thema »Sklarz« ein, und den Widerhall finden wir in den folgenden Jahren bei so unterschiedlichen Personen wie dem KPD-Reichstagsabgeordneten und Historiker Arthur Rosenberg sowie dem Theaterregisseur Erwin Piscator, die beide aus der radikalen Antikriegsbewegung stammten.111 Immer ging es um »Kriegsund Revolutionsgewinnlerei«, um Profitgier, die über politische Moral triumphierte und einen Beigeschmack von Niederträchtigkeit, Gemeinheit und »Brudermord« hatte. Eine gute Illustration ist die private Anklageschrift gegen Sklarz, die Sonnenfels sen. in Form des Gedichts Protest gegen den 9. November formulierte, worin die Revolution als eine Verfallsgeschichte infolge von politischem Schieberund Gaunertum beschrieb wird:
»Ha, wie verachte ich heimliches Verschwören,
Und wie ich hasse, Meuchelmörderhand,
Wenn in des Volkesretters Ruhmgewand,
Schieber und Gauner meinen Groll empören.
Aus der Hefe entstiegen zur Höhe,
Halten sie offen die schmutzige Hand;
Nichts an ihrem äußeren Gewand
Zeigt die Stacheln der saugenden Flöhe.
[…]
Ich werde dem Volk noch viel erzählen,
Was sich begeben seit dem 9. November,
In Steglitz, Regentenstraße und Bendler-,
Wie Minister und Gauner sich vermählen.«112
Diese Auseinandersetzungen in den Reihen der politischen Linken sind im Auge zu behalten, denn sie erklären das spätere Engagement des linken SPD-Flügels sowie der KPD in der Causa Barmat. Auch die der Berliner Demokratischen Partei zuzurechnende Berliner Volks-Zeitung schoss sich Anfang 1920 nicht nur auf Sklarz, sondern einen, wie man mutmaßte, damit zusammenhängenden neuen »Fall« ein, nämlich den des Julius Barmat. Dieser setzte sich aber vehement zur Wehr und verklagte die Urheber erfolgreich; die Verantwortlichen der Berliner Volks-Zeitung und der Deutschen Zeitung mussten eine Ehrenerklärung abgegeben.113
4. Ein wichtiger Nebenstrang der Ereignisse um den Fall Sklarz verweist ebenfalls auf die Zukunft. Denn die Berliner Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Kaufmann Sklarz, sah sich dann aber bald selbst massiven Vorwürfen ausgesetzt, Recht mit politischen Interessen, wenn nicht gar mit antisemitischen Ressentiments zu vermischen. Ein Disziplinarverfahren und dann die Wegberufung des federführenden Berliner Staatsanwalts war das Menetekel, das noch ein langes Nachspiel haben sollte. Denn dieser Staatsanwalt setzte das sich lange haltende Gerücht in den Raum, dass es aus den Reihen der preußischen Regierung im Auftrag von Sklarz einen Bestechungsversuch gegeben habe, womit man ihn, den Staatsanwalt, angeblich zum Schweigen bringen wollte.114 Solche Geschichten erzählte man sich im Umfeld der politischen Rechten, und wie wir sehen werden, ließen sich dabei vielfältige Verbindungen auch zum Fall Barmat herstellen.