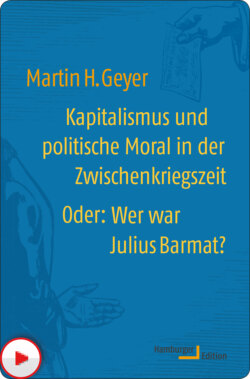Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 28
Antisemitische Verschwörungsfantasien
ОглавлениеFünf Jahre nach der Publikation des Rattenkönigs sprach der rabiate württembergische Antisemit Alfred Roth alias Otto Arnim 1925 vom »Rattenkönig Barmat«.115 Und fünfzehn Jahre später zeigte der nationalsozialistische Hetzfilm Der ewige Jude im Zusammenhang mit der Darstellung der Wanderung und Ankunft der Ostjuden in Deutschland einen Rattenkönig, inmitten eines Knäuels von mit ihren Schwänzen miteinander verflochtenen lebenden Ratten. 1919/20 grassierte in Deutschland ein bis dahin in dieser Form wenig bekannter Antisemitismus, der sich bis weit in die Gesellschaft erstreckte. Fragen wirtschaftlicher und sozialer Not, von Hunger und Teuerung, vermischten sich mit Revolutions- und Korruptionskritik und eindeutig rassistischen Diffamierungen zu einem soziokulturellen Syndrom des Antisemitismus. Selbst der später als Freund Julius Barmats in den Skandal gezogene Berliner Polizeipräsident Wilhelm Richter (SPD) sprach im Sommer 1920 in einem Schreiben an das preußische Innenministerium von einer »Ostjudenplage«, die Berlin »nicht nur lästige, sondern höchst gefährliche Ausländer« beschere. Mit Blick auf den illegalen Handel mit Gold, Brillanten und Banknoten war von »ausländischen Parasiten« die Rede. In der bestehenden Regelung, die eine Duldung und wohlwollende Behandlung vorschrieb, sah er ernste Gefahren für die Zukunft, und zwar wirtschaftlich und gesundheitlich; diese Auffassung werde auch »von einwandfreien deutschen Juden geteilt und habe nichts mit antisemitischen Bestrebungen zu tun«,116 so die nachgerade klassische antisemitische rhetorische Figur. Um die Dringlichkeit seines Arguments zu betonen, fügte er seinem Schreiben einen Bericht seines Amtsvorgängers Eugen Ernst (USPD) bei, der ein noch drastischeres Bild gezeichnet hatte: In Teilen des alten Scheunenviertels (Grenadier-, Dragoner- und anliegende Straßen) habe sich ein wahres Getto entwickelt, das im Berliner Volksmund allgemein die »jüdische Schweiz« genannt werde. Neben den Gefahren für die Volkshygiene und das wirtschaftliche Leben betonte er besonders die politischen Gefahren, nämlich die »bolschewistischen Anschauungen«. Vor diesem Hintergrund plädierte Richter ähnlich wie sein Amtsvorgänger für eine rasche Abschiebung in die Heimat. Bis dahin müssten die Ostjuden in Gefängnislagern untergebracht »oder richtiger gesagt unschädlich« gemacht werden. Verwiesen wurde auf das »aus tausend Wunden« blutende deutsche Vaterland.117 Ähnlich drastische Stimmen ließen sich aus dem preußischen Innenministerium zitieren, das sich, wie wir sahen, zur gleichen Zeit scharfen Anfeindungen wegen seiner Duldung von osteuropäischen jüdischen Flüchtlingen aus humanitären Gründen ausgesetzt sah.118
Die Stellungnahme Richters war mit großer Sicherheit nicht von ihm selbst verfasst worden, sondern stammte aus der labyrinthischen Bürokratie des Berliner Polizeipräsidiums am Alexanderplatz, in diesem Fall wohl der Fremdenpolizei. All das hinderte die radikale Opposition nicht, die Sozialdemokraten scharf anzugreifen. Hatte die preußische Regierung im November 1918 nicht die zuvor erlassene Grenzsperre für Ostjuden aufgehoben? Hatte sie nicht Personen wie Julius Barmat begünstigt? Solche von den Radikalen im politischen Kampf selbst gestellte Fragen beantworteten sie eindeutig: Die Sozialdemokraten schützten die Juden. Diese Politik habe es ermöglicht, dass sich Männer wie Julius Barmat, Iwan Kutisker und »Tausende von minder prominenten galizischen und russischen Juden […] in Berlin breit gemacht, hier im Gegensatz zu einheimischen Bedürftigen zum Teil Paläste bezogen und in kurzer Zeit die finanzielle Sahne der Meuterei von 1918 abgeschöpft« hätten.119 Wohnungsnot, Schieberei und Wucher, illegaler Handel mit Wertmetallen und Kriminalität waren wiederkehrende Themen, die nicht nur die Deutschnationalen in den Wahlkämpfen insbesondere 1924 traktierten, ganz zu schweigen von den Radikalen im Umfeld der Völkischen.120 Alltägliche Fragen von Nahrungs- und Wohnungsnot spielten dabei eine zentrale Rolle.
Die Ausbreitung und Radikalisierung des Antisemitismus in den ersten Jahren unmittelbar nach dem Krieg sind oft beschrieben worden. Es war ein Mikromilieu eigener Art, zunächst vor allem im Umfeld der radikalen Rechten einschließlich der DNVP, von der sich 1922 ein radikaler, dezidiert antisemitischer Flügel, die Deutschvölkische Freiheitspartei, abspaltete. Auf diesem völkischen Flügel tummelten sich viele Organisationen, nach der Revolution zunächst am bedeutsamsten der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund. Die frühen Auseinandersetzungen 1919/20 zeigen aber zugleich, wie diffus die Frontlinien verliefen, wenn es um das Thema »Korruption« ging, bei dem sich Positionen von Völkischen, sozialdemokratischen Renegaten wie Sonnenfeld und Davidsohn sowie von Mitgliedern der Demokratischen Partei überschnitten. 1925 spielte dann die KPD die Klaviaturen populärer Ressentiments, allen voran Karl Radek und mit ihm die sogenannten »Ultraradikalen«, die auch Erinnerungen an den Krieg wachhielten. Sie alle appellierten an Stereotype, in deren Mittelpunkt »Wucherer«, »Schieber«, »Kriegs«- und dann auch »Inflationsgewinnler« standen. Für die Linke waren das die Blüten des Kriegskapitalismus.121 Im Umfeld der Konservativen findet man einen ungezügelten Hass auf Institutionen der Kriegswirtschaft, die mit »den Juden« in Verbindung gebracht wurden: Die Zeitschrift für Nahrungsmittel sprach im Oktober 1919 vom »bolschewistische[n] Reichsmakler Barmat«, dem man unterstellte, »wohl ähnlich Braunstein-Trotzki [gemeint war Leo Trotzki – MHG] seinen Namen umgeschnitten« zu haben; dabei wurden Vergleiche mit der Ballin’schen Z.E.G. (Zentrale Einkaufsgenossenschaft unter Führung des als Juden diffamierten Reeders Albert Ballin) hergestellt, deren »werktätige Meister und Geister in die der neuen Reichseinfuhrstellen verwandelt werden mußten, als die Z.E.G.-Skandale zum Himmel stanken«.122
Wie kein anderer traktierte der weit über Stuttgart hinaus bekannte Alfred Roth das Thema »Kriegswirtschaft und Juden«. Seine 1925 auf Grundlage früherer Publikationen mit heißer Nadel gestrickte Flugschrift Von Rathenau zu Barmat aus dem Jahr 1925 ist dafür ein gutes Beispiel (siehe Abb. 3, S. 83): Der als Jude stigmatisierte Walther Rathenau wird als Begründer der deutschen Kriegswirtschaft, die angeblich jüdischen wirtschaftlichen Interessen diente, dargestellt; Julius Barmat und andere Personen jüdischer Konfession erscheinen als Rathenaus wahre Erben. Roth zog alle Register der antisemitischen Agitation, wie sie im Umfeld des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes Konjunktur hatten. Demnach waren die Juden an allem schuld: dem »feigen« Kriegsende und Friedensschluss, der Teuerung und der Kriegszwangswirtschaft, Hunger, Not und Elend. Das waren die Themen von Flugblättern und Handzetteln, in denen eine »Ostjudenplage« beschworen wurde.123
Dabei spielten auch die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion eine, wenn auch auf den ersten Blick nur periphere Rolle. In dem vermutlich von Alfred Rosenberg verfassten Artikel »Barmat & Co oder der größte Sieg der Demokratie« in der antisemitischen Zeitschrift Der Weltkampf war zu lesen, dass die Ereignisse auch auf Deutschland verwiesen. Aus den Protokollen wurde eine Passage zitiert, die, um eine moderne Diktion zu benutzen, ein vermeintliches Abhängigkeitsverhältnis von Klient und Agent skandalisierte: »Um ganz sicher zu gehen, werden wir [d.h. die »Weisen von Zion« – MHG] die Wahl zum Präsidenten auf solche Personen lenken, deren Vergangenheit einen nur uns bekannten dunklen Punkt, ein ›Panama‹ [eine Anspielung auf den Panama-Skandal der französischen Republik in den 1890er Jahren – MHG] aufweist. Diese werden dann gehorsame Vollstrecker unserer Geschäfte sein, aus Furcht vor Enthüllungen und von dem natürlichen Bestreben geleitet, die mit dem Präsidentenamt verbundenen Vorrechte, Einkünfte und Würden weiterhin zu genießen. Das Haus der Abgeordneten wird den Präsidenten wählen, decken und stützen.« Mit juristischer Spitzfindigkeit wurde in einer Fußnote betont, dass man diese Passage nicht als Motto über den Aufsatz gestellt habe, da er in dem Sinne hätte ausgelegt werden können, »als habe Herr Ebert vor seiner Wahl einen ›dunklen Punkt‹ in seiner Vergangenheit gehabt, und sich deshalb auf Gedeih und Verderb den jüdischen Parasiten verschrieben«. Dennoch, so der anonyme Autor des Artikels, sei »klar: die Kutiskers und Barmats haben es überall versucht, bei allen führenden Persönlichkeiten ein ›Panama‹ zu schaffen, um sie dann in der Hand zu haben«.124 So begann der Artikel, der ausführlich (und trotz aller Verdrehung der Fakten einigermaßen kenntnisreich) von der umstrittenen Ankunft Barmats in Deutschland und von seinen Verbindungen zu den Bolschewiki und zur SPD einschließlich Friedrich Ebert handelte. Es ging hier nicht nur um das »Dreigestirn Ostjudentum, Sozial-Demokratie und Finanzgauner«, wie es mit Blick auf die Roth’sche Flugschrift Von Rathenau zu Barmat hieß.125 Was sich darüber hinaus frühzeitig abzeichnete, nämlich dass sich bei Barmat in Amsterdam 1919 die ganze europäische Sozialdemokratie versammelt habe, wiederholte sich, so die Unterstellung, in Berlin, konkreter: in Schwanenwerder, wo die »Ausplünderung Deutschlands« ausgeheckt worden sei. Die Geschäfte Barmats wurden dabei mit Beschlüssen in Verbindung gebracht, die an diesem Ort gefällt wurden, nämlich dass sich im »Jahre 1919 eine Gruppe führender Sozial-Demokraten bei dem bekannten Ostjuden Parvus-Helphand« zusammengesetzt und beschlossen habe, »die Sozialisierung nicht mehr direkt zu verlangen, sondern die Enteignung aller Vermögen durch die Inflation herbeizuführen«. Dieser Plan sei gelungen und dann 1926 in die Pläne zur Fürstenenteignung gemündet.126
Abb. 3 Das Krokodil als ikonografisches Symbol für Betrug und Täuschung
Titelbild der Flugschrift von Otto Armin [Alfred Roth], Von Rathenau zu Barmat, Stuttgart 1925
Repro: Hauptstaatsarchiv Stuttgart
Solche Geschichten griff später auch der unter dem Pseudonym Gottfried Zarnow publizierende Moritz Ewald in seinem Bestseller Gefesselte Justiz (1931) auf: In Schwanenwerder, am Tisch des »sy-baritischen Nabos«, begann demnach eine große Verschwörung; diesen Ort erkoren sich »Parvus-Helphand und Barmat […], erfolgreichste Nutznießer der demokratischen Politik […], um ihre großmächtigen Gönner zu empfangen und sie vor den zudringlichen Blicken des hungernden Volkes zu verbergen«.127 Dass sich, wie wir noch sehen werden, dieser Radikale den Sozialdemokraten zugerechnet hatte, so wie viele Völkische zuvor (national-)liberalen Parteien, verweist auf die diffuse politische Stimmung nach dem Krieg. Welche politische Richtung genau dieser Radikalismus nehmen würde, war offen; die Grundlagen sind aber deutlich zu erkennen.