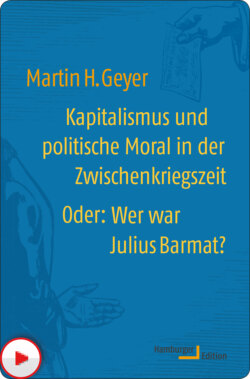Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 21
Wirtschaftliche »Grenzmoral« und Volksernährung
ОглавлениеDer Krieg war vorbei, die Probleme der Kriegswirtschaft hielten an. Der für die Volksernährung zuständige Reichsminister Robert Schmidt (SPD), dessen Ressort 1919/20 kurzzeitig mit dem Reichwirtschaftsministerium zusammengelegt wurde, unterstrich rückblickend, wie kritisch die Ernährungslage das ganze Jahr 1919 über war. Angesichts der akuten Notlage galt es zu improvisieren. Die Gesetze des Marktes waren außer Kraft gesetzt, alle möglichen Stellen, einschließlich des Militärs, versuchten Nahrungsmittel zu beschaffen, auch illegal. So habe man vielfach »ein Auge zugedrückt und auch beide Augen«.56 Es gab Konflikte mit den Niederlanden und Dänemark, die die deutsche Regierung zur Bekämpfung des illegalen Grenzhandels aufforderten, an dem sich Tausende beteiligten und damit die Preise in den Nachbarländern in die Höhe trieben. Viele »faule Geschäftsleute« und »Spekulanten« aus den USA und England boten ihre zweifelhaften Dienste an. Vor allem aber: Eine akute Devisenknappheit des Reiches erschwerte Importe jeder Art.
Die Probleme erschienen so dringlich, dass im Mai 1919 ein interministerieller »Diktatorischer Ausschuss« unter Leitung des früheren Direktors der Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft Eugen Pritschow eingerichtet wurde. Im Streit um die knappen Devisen sollte sich diese Organisation über Partikularinteressen von Behörden, aber auch Wirtschaftsinteressen hinwegsetzen. Markige Rufe nach Diktatoren, insbesondere Wirtschaftsdiktatoren im Bereich der Volksernährung, waren seit dem Krieg sehr populär. Aber es war eine andere Sache, sich diktatorischen Beschlüssen auch unterzuordnen. Denn Diktatur setzt bekanntlich nicht auf komplizierte Verfahren, schon gar nicht auf Transparenz, sondern auf Dezisionismus. So waren Ressentiments und Widerstände nicht nur bei den betroffenen Ressorts des Reiches, der Länder und der Kommunen, welche die auseinanderfallende Lebensmittelzwangswirtschaft organisierten, sondern auch bei Unternehmern im In- und Ausland vorprogrammiert.57 Dass überall »geschoben« wurde, gehörte zu den Gemeinplätzen mit vielen, meist unbewiesenen, ins Kraut schießenden Unterstellungen und Vermutungen, die zweifellos auch einen wahren Kern hatten. Ausgestochene Unternehmer waren schnell dabei, Konkurrenten mit Vorwürfen zu diskreditieren.
Der Lebensmittelhändler Julius Barmat geriet dabei wie kein anderer in die Schusslinie. Wofür es 1919/20 aber nur in Ansätzen eine kritische mediale Öffentlichkeit gab – stattdessen aber viele Gerüchte und Geschichten –, ließ sich wenige Jahre später im Zuge des Barmat-Skandals auf breiter Ebene thematisieren. Viele der früheren Akteure, darunter Handeltreibende und Vertreter großer Lebensmittelimportfirmen wie Alnari oder Schwoon in Hamburg, von denen nicht wenige in den Kriegswirtschaftsbehörden eine maßgebliche Rolle gespielt hatten, traten 1925 in gleich drei parlamentarischen Ausschüssen auf, im Reich, in Preußen und in Sachsen, um sich zu den Lebensmittelgeschäften und Geschäftspraktiken Julius Barmats samt der beteiligten Personen in der unmittelbaren Nachkriegszeit zu äußern. Es ging um die Qualität von Butter und Speck, sophistische Debatten über Brutto- und Nettoinhalte von Milchdosen, »(un)angemessene Preise«, Lieferkonditionen und Finanzierungsfragen, dann aber auch im Zusammenhang mit allen diesen Themen um den Verdacht der Korruption, namentlich die Verbindungen von Julius Barmat zu führenden Sozialdemokraten.
Verhandelt wurden Fragen der wirtschaftlichen »Grenzmoral« als »Wirtschaftsmoral« des Kapitalismus. Diesen Begriff hatte Götz Briefs, ein Ökonom aus dem Umfeld der katholischen Soziallehre, 1921 in die Diskussion eingeführt. Er meinte damit die Verkehrsmoral »der am wenigsten durch moralische Hemmungen im Konkurrenzkampf behinderte[n] Wirtschafter, die auf Grund ihrer Mindestmoral unter im Übrigen gleichen Umständen die stärksten Erfolgsaussichten haben und sohin die übrigen konkurrierenden Gruppen bei Strafe der Ausschaltung vom Wettbewerb zwingen, allmählich in Kauf und Verkauf sich dem jeweilig tiefsten Stand der Wirtschaftsmoral (›der Grenzmoral‹) anzugleichen«. Dieser »submarginale […] Druck« war, wie Briefs in späteren Zusammenhängen formulierte, nach allgemeiner Anschauung auf der einen Seite höchst verwerflich, weil mit dieser Wirtschaftsmoral kein wirtschaftlicher Nutzen erzeugt würde, was in zeittypischen Bezeichnungen wie Schieber, Kettenhändler und Schwindelunternehmer zum Ausdruck komme. Zugleich sah der Ökonom aber sehr wohl, dass sich in diesem Begriff der »Grenzmoral« immer auch Reaktionen auf dynamische Prozesse »schöpferischer Vernichtung« (Josef Schumpeter) widerspiegelten: auf neue Produktionsformen und innovative Unternehmer, die durch ihr wirtschaftliches Handeln etablierte und auch moralische Normen unterliefen.58
Vor allem der in der ersten Reichsregierung für die Volksernährung zuständige Minister Robert Schmidt (SPD) sah sich bei den Ermittlungen heftigen Angriffen ausgesetzt. War er für das »Festsetzen der Spinne Barmat in der gesamten Lebensmittelversorgung Deutschlands 1919/20 verantwortlich«, wie 1925 auch der bayerische Gesandte in seinem Bericht aus der Reichshauptstadt unterstellte? Das Verhör des Ex-Ministers im Reichstagsausschuss wurde dementsprechend mit großer Spannung erwartet, doch kam er »leidlich unlädiert« aus den Befragungen heraus, da selbst »die Rechte geneigt scheint, ihm das beneficium des Ehrenmanns nicht abzustreiten«.59 Ähnliches wiederholte sich bei den Aussagen Schmidts im Preußischen Untersuchungsausschuss.
Schmidt wusste bereits beim ersten Zusammentreffen mit Barmat, dass der Amsterdamer Kaufmann im Krieg auf der deutschen Seite gestanden hatte – die Tatsache, dass er auf der Schwarzen Liste der Briten stand, war für ihn, wie er betonte, »eine Empfehlung«, ebenso wie die Lieferungen nach Deutschland, vor allem als die Niederlande 1919 zeitweise die Exporte stoppten. Mehr als alles andere zählte aber für den einstigen Minister, dass Barmat 1919 zu denjenigen gehörte, die auf dem leer gefegten und blockierten Weltmarkt überhaupt Lebensmittel beschaffen konnten, und das offenbar in großen Mengen. Der Kaufmann machte auf ihn den Eindruck eines »vertrauenswürdigen und tüchtigen Geschäftsmanns«, auch wenn ihm seine etwas »aufdringliche Art« missfiel, was aber nicht nur für Barmat kennzeichnend gewesen sei.60
Schmidt traf Barmat nur zwei Mal. Dieser habe bei ihm weniger vorgesprochen, um sich über Geschäfte zu unterhalten, wofür ganz andere Stellen und Personen zuständig waren. Vielmehr habe er sich darüber beschwert, dass er, der Sozialdemokrat und Jude Barmat, von den alten Beamten benachteiligt werde. Nach Schmidts Eindruck hatte er »mit dieser Beschwerde nicht ganz unrecht«, zumal renommierte Banken, darunter die Diskontogesellschaft oder das Bankhaus Mendelssohn, seine Person ausgesprochen günstig beurteilten.61 Der Vorsitzende des Diktatorischen Ausschusses Pritschow erklärte später, wie er die Anweisung Schmidts, Barmat anzuhören, verstand: Man solle Barmat nicht vor den »Kopf stoßen«, ihn »nicht hinauswerfen« (wie das offenbar bei vielen Kaufleuten, die vorsprachen, der Fall war) und ihn »in den Formen des kaufmännischen Verkehrs anständig behandeln«.
Eine Reihe von damaligen Beamten des Reichswirtschaftsministeriums, darunter zahlreiche Unternehmer aus Industrie und Handel, die hohe Positionen in Kriegswirtschaftsstellen eingenommen hatten, sahen das anders. Ihr Vorwurf lautete, der SPD-Sympathisant Barmat sei systematisch protegiert worden. Zwar sei bei der Vergabe von Aufträgen kein direkter Druck ausgeübt worden; passive oder aktive Bestechung, also Formen von Korruption, ließen sich, wie sie auf Nachfrage zugeben mussten, nicht nachweisen. Sie empfanden Barmat aber als »politischen Faktor«, mit dem man rechnen musste. Man fügte sich, weil man dem Freund der »maßgeblichen Herren«, sprich: Schmidt und der Regierung Gustav Bauer (SPD), eben zu Gefallen sein wollte.62 Solche Aussagen lassen deutlich das Misstrauen gegen »die neuen Männer« erkennen, die nun in der Politik wie in der Wirtschaft ein Wort mitzusprechen hatten. Barmat, ein Konkurrent, schien sich überall breitzumachen.
Barmat war in der Lage zu liefern, und zwar nicht nur an das Reich, sondern auch an staatliche Stellen in Württemberg und Sachsen. In den Niederlanden verfügte der Kaufmann über ein weitverzweigtes Netz von Agenten und konnte im Gegensatz zu anderen deutschen Importeuren nicht nur in Rotterdam, sondern auch im belgischen Antwerpen einkaufen. Außerdem bot er günstige Finanzierungsmodalitäten an. Auf einem anderen Blatt stand, ob seine Preise wirklich so günstig und die Qualität immer einwandfrei waren. Schmidt und andere frühere Beamte der einschlägigen Reichsbehörden wussten zu berichten, dass Barmat mehr versprochen, als er dann geliefert habe, was ihn aber ebenfalls nicht von anderen Auslandslieferanten unterschieden habe.
Der Umfang der Lieferungen nach Deutschland in der Nachkriegszeit war beachtlich, wenn auch bei Weitem nicht so umfangreich, wie gern berichtet wurde.63 Der Vorsitzende des Diktatorischen Ausschusses schätzte, dass sich die mit den Reichsernährungsstellen abgeschlossenen Geschäfte Barmats auf 20 Mio. Gulden beliefen, was 30 Mio. Goldmark entsprach – bei insgesamt 3,7 Milliarden Goldmark für Einfuhren aller Reichsstellen also einem Anteil von gerade einmal einem knappen Prozent.64 Hinzu kamen die Nahrungsmittellieferungen der Amexima an andere Stellen, allein 1919/1920 nach Sachsen in Höhe von 211 Mio. Papiermark (wegen der fortschreitenden Inflation entsprach das etwa 22 Mio. Goldmark). Hinzu kamen Geschäftsbeziehungen nach Österreich, die 1920/21 ausgebaut wurden und bald den Handel mit Deutschland überflügelten. Neben Nahrungsmittelvereinbarungen hatte die Amexima 1919 Kontrakte mit den einschlägigen Stellen des Reiches wie der Länder über große Lieferungen von Textilien aus den Niederlanden, darunter solche für Lumpen, die für die Papierproduktion gebraucht wurden, für die Barmat im Gegenzug Papier für sozialistische Zeitungen nach Holland lieferte (worin manche einen Verstoß gegen die Bewirtschaftungsgesetze und Ausfuhrbestimmungen sahen).65