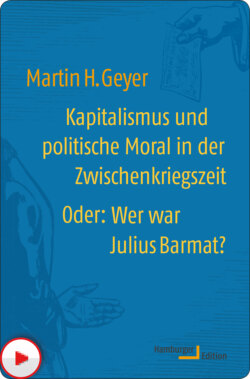Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 15
Grenzsicherung und Ostjuden
ОглавлениеViele konnten es nicht gewesen sein, die in den Niederlanden von der Zusammenarbeit Barmats mit deutschen Diplomaten wussten. Im Amsterdamer Generalkonsulat war man auf jeden Fall einigermaßen konsterniert darüber, dass unter anderem von Maltzan und der Botschafter Alfred von Rosen Barmats Visumanträge befürworteten – auch wenn die beiden intern ein sehr ambivalentes Bild der Person Barmats zeichneten. Von Rosen meinte im Januar 1919, Barmat sei ein »sehr gewandter wortreicher russischer Jude, der nötigenfalls auch die ukrainische Staatsangehörigkeit für sich in Anspruch nimmt und der den persönlichen Ehrgeiz hat, konsularischer und lieber diplomatischer Vertreter der Ukraine oder auch der Sowjet-Regierung im Haag zu werden«. Außerdem verwies er darauf, dass das Amsterdamer Generalkonsulat die »besonders ›glücklichen‹ Geschäfte« Barmats mit »gewisser Skepsis« betrachte, vor allem aber, dass er trotz »gewisser Dienste« für Deutschland offenbar ein »skrupelloser Opportunist« sei.37 Das hinderte von Maltzan jedoch nicht daran, Barmat zwischen Januar und April insgesamt vier befristete Visa, sogenannte Passvisen, auszustellen.38 Schon im Januar wurde dem Staatenlosen ein erster Personalausweis ausgefertigt. Bei manchen seiner Kollegen in Den Haag, vor allem aber beim Generalkonsul Hans Paul von Humboldt und dem Legationsrat Graf Waldbott von Bassenheim in Amsterdam, führte das zu starken Irritationen, und sie opponierten vehement. Die Reise im Januar trat Barmat aber nicht an, wahrscheinlich, weil die vorgesehenen Termine platzten. Auch von Maltzan hatte im Januar das Auswärtige Amt in Berlin vorsorglich instruiert, dass bei dem »jüdischen Ukrainer Barmat«, der demnächst in der Reichskanzlei und dem Auswärtigem Amt auftauchen werde, »wohlwollende Zurückhaltung« geboten sei.39
Grenzübertritte waren nach dem Krieg eine aufwendige Angelegenheit. Bürokratische Hemmnisse erschwerten die vormals relativ freie Bewegung von Menschen und die Zirkulation von Waren und Geld über Grenzen. Es herrschte ein tiefes Misstrauen, dass mit den Migranten auch Spione und revolutionäre bolschewistische Ideen einsickern könnten. Dass die nationalen Grenzen vielfach ungesichert waren, vermittelte ein Gefühl der Verwundbarkeit. Besonders brisant war die Situation im Osten, wo es mit der Gründung des Staates Polen zu konfliktreichen Grenzziehungen kam. Hunderttausende Flüchtlinge, die vor der Gewalt der Russischen Revolution, der Bürgerkriege sowie der blutigen Pogrome flohen, überschritten unkontrolliert die deutsch-polnische Grenze und ließen sich im Reich nieder. Schätzungen gehen von 600000 russischen Staatsbürgern aus, von denen sich 360000 allein in Berlin aufhielten. Umstritten war die Anzahl der jüdischen Migranten. 1924 hieß es, dass bis zu 400000 Ostjuden nach Deutschland gekommen seien. Tatsächlich ließen sich zwischen 1914 und 1921 nur etwa 105000 jüdische Migranten im Reich nieder, viele von ihnen vorübergehend auf ihrem Weg in den Westen. Erste Regelungen noch aus dem Jahr 1918, die jüdische Migration aus dem Osten einzuschränken, wurden unmittelbar nach der deutschen Revolution zunächst einmal aufgehoben. Humanitäre Motive standen im Vordergrund. Antisemiten sprachen bald von einer »Ostjudenplage«, und der Ruf nach effektiven Grenzsperren und Deportation insbesondere der ostjüdischen Flüchtlinge wurde laut.40
Barmats Bemühungen, im Jahr 1919 nach Deutschland einzureisen, hatten mit dieser ostjüdischen Fluchtbewegung wenig zu tun. Tatsächlich hätte die Ausgangssituation nicht konträrer sein können. Hier der wohlhabende Kaufmann mit seinem Geschäftssitz an der noblen Keizersgracht in Amsterdam, der legal die Grenze überschreiten wollte, dort die vielen, überwiegend bettelarmen Flüchtlinge, die vielfach illegal die »grüne Grenze« überquerten. Hier ein Mann, der über »vorzügliche Manieren« verfügte, »als Israelit ein sehr gutes Äußeres« hatte und zudem »angenehm im Umgang war, sodass man allgemein geradezu von ihm eingenommen ist und ihm Vertrauen schenkt«,41 dort die vielen Jiddisch sprechenden, teils in einen Kaftan gekleideten Juden, die auch ihren deutschen Glaubensgenossen vielfach als exotisch und fremd, ja als Vertreter einer anderen, rückständigen Welt des Ostens galten. Julius Barmat teilte nicht das Schicksal dieser vielen ostjüdischen Migranten, die auf den infolge der Demobilisierung des Heeres übervollen deutschen Arbeits- und Wohnungsmarkt drängten, auf öffentliche und konfessionelle Fürsorgeleistungen angewiesen waren und sich aus purer Not in wirtschaftlich marginalen Nischen zu etablieren versuchten. Während er bald in den teuersten Berliner Hotels logierte, die seinem sozialen Status entsprachen, zwängten sich die meisten Flüchtlinge in die ärmeren Stadtquartiere wie das Berliner Scheunenviertel oder in improvisierte Notunterkünfte, wenn sie nicht gar in auf Militärgelände gelegenen Übergangslagern »konzentriert«, isoliert und drangsaliert wurden – mit der unverhohlenen Absicht, die Neuankömmlinge möglichst schnell wieder abzuschieben.
Und doch: Ob aus dem Westen oder Osten kommend, wohlhabend oder arm – allen, auch Julius Barmat, haftete das Stigma des Ostjuden an. Dass sich hinter seinen geschliffenen Manieren ein russischer oder polnischer, sprich: jüdischer Kriegsgewinnler verberge, insinuierte bezeichnenderweise auch der in der kommunistischen Roten Fahne abgebildete Cartoon aus der Hochphase des Skandals (siehe Abb. 1, S. 48): Er zeigt Barmat als »Schieber«, der nach Kriegsende – in Polen – mit Sack und Pack darauf wartet, in das sozialdemokratische »Schieberparadies« Deutschland aus »humanitären Gründen« eingelassen zu werden. Ganz ähnlich sahen das viele Konservative, allemal aber die Völkischen, für die mit der Republikgründung das »Ostjudenproblem« begann. Konkret hieß das: Verschärfung der Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit, Kosten für die Wohlfahrt, (Wirtschafts-)Kriminalität und nicht zuletzt un-überwindbare kulturelle Fremdheit.42 Dahinter standen – idealisierte – Vorstellungen einer »wertvollen« Migration, wie die der Hugenotten (siehe auch Abb. 2, S. 51).
Der Familiennachzug war ein anderes Thema. In den Jahren zwischen 1919 und 1924 verließen auch die Barmat-Geschwister Herschel, David, Isaak, Salomon sowie Rosa und Dora Barmat Russland bzw. die Ukraine, und die Brüder stiegen in das verzweigte Geschäft zwischen Amsterdam, Berlin und Wien ein. An erster Stelle zu erwähnen ist der 1893 geborene Herschel oder Henri bzw. Henry (Letzteres seine eigene Schreibweise). Henry hatte die Mittelschule besucht und dann das Abitur gemacht, aber keine »Lust zum Studium«. Der Vater schickte ihn und seinen jüngeren Bruder Isaak ebenfalls in die Niederlande, damit sie nach dem Tode einer geliebten älteren Schwester »auf andere Gedanken« kämen. Der Zufall wollte es, dass sich Henry just bei Kriegsausbruch 1914 auf einer Geschäftsreise in Russland aufhielt, sodass ihm die Rückkehr nach Holland versperrt war. Nach seiner Rückkehr 1919 trat er als Angestellter in das Geschäft von Julius ein, zunächst in Amsterdam und Wien, dann in Berlin, wo er den Lebensmittelhandel organisierte.43 Er war Julius’ linke Hand, eine Verbindung, die auch dadurch gestärkt wurde, dass Henry 1920 die Schwester von Barmats Frau, Helena de Winter, heiratete.