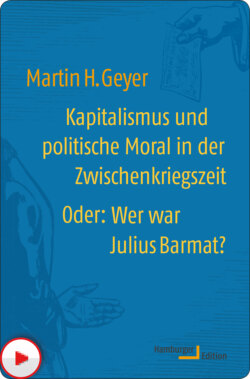Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 35
Kredit im Strudel von Inflation und Deflation
ОглавлениеTatsächlich änderte sich die Geschäftsausrichtung der Bank in der Nachkriegszeit, insbesondere während der Hyperinflation und der Währungsstabilisierung. Der neue Fokus auf die Privatwirtschaft hatte verschiedene Gründe: Erstens brachte die Hyperinflation einen Bedeutungsschwund der Staatsbank als Kreditinstitut für die Staatsregierung mit sich, sodass man auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern war. Wichtiger war jedoch ein zweiter Antrieb: Die Inflation hatte tiefe Spuren in der Geschäftsbilanz hinterlassen. Denn im Gegensatz zu Privatbanken waren der Preußischen Staatsbank risikoreiche und damit eher spekulative Geschäfte verboten gewesen. Die Rücksichtnahme auf hohe Liquidität in Verbindung mit der Unmöglichkeit, über Devisengeschäfte Währungsverluste auszugleichen, hatte die Bank ausbluten lassen. Die rückwirkend zum 1. Januar 1924 erstellte Goldmarkeröffnungsbilanz wies gerade noch ein Eigenkapital von 10 Mio. GM und Reserven in Höhe von 3 Mio. GM auf. Das waren knapp 8 Prozent des Eigenkapitals der Vorkriegszeit.28 Solche Verluste galt es auszugleichen. Dazu musste man, wie der für die Kreditvergabe an Barmat mitzuständige Oberfinanzrat Hans Hellwig in seiner Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der Bank vollmundig formulierte, neue Wege beschreiten: Das altehrwürdige Institut wollte sich von einem fiskalischen Staatsunternehmen zu einer modernen Geschäftsbank mausern. Dieses neue Geschäftsmodell provozierte später manchen bitter-spöttischen Kommentar, und Hellwig musste sich seine früheren Formulierungen vorhalten lassen. Denn die Strategie, wagemutig neue Wege zu beschreiten, mündete in ein Desaster.29
Überall wurden nach der Hyperinflation Forderungen erhoben, dass die öffentlichen Finanzinstitutionen angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Lage eine aktive Rolle spielen sollten, ja mussten, auch indem sie der Privatwirtschaft öffentliche Gelder zur Verfügung stellten. Das war angesichts der wirtschaftlichen und finanzpolitischen Verhältnisse leichter gefordert als getan. Der Preußischen Staatsbank flossen Steuern und sonstige Einnahmen des Staates sowie von Teilen der öffentlichen Wirtschaft einschließlich der Reichspost zu; außerdem parkten Privatbanken angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit ihr Geld bei dem Institut. Diese Praxis war ein Symptom der Wirtschaftskrise und des infolge der Hyperinflation zerrütteten Bankensystems: »Das Geld wird lieber Tag für Tag der Seehandlung anvertraut und das selbst zu niedrigen Zinsen. Auf diese Weise wurden beträchtliche Summen der Wirtschaft brach gelegt und das zu einer Zeit, als Kreditmangel herrschte.«30 Das war insofern eine unbefriedigende Konstellation, als seitens der »Realwirtschaft« allenthalben Klagen über unerträgliche »Kreditknappheit« und exorbitante Zinsen zu hören waren, und zwar häufig mit der Unterstellung, das Geld werde »Schieberkonzernen« günstig zur Verfügung gestellt.31
Vor diesem Hintergrund – den Bemühungen um eine Rekapitalisierung der Staatsbank, der Bekämpfung der Kreditnot und dem stillen Wettbewerb der Banken untereinander – sind die Kreditbewilligungen nicht nur an Barmat und seinen Konzern, sondern auch an Iwan Kutisker und Jakob Michael zu sehen. Die damit verbundenen Risiken waren immens. Denn wenn Banken angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage es scheuten, Kredite an die Wirtschaft zu vermitteln, warum sollten andere mit weniger Erfahrung auf diesem Gebiet besser in der Lage sein, solche Risiken richtig einzuschätzen? Diese Frage richtete sich nicht zuletzt an die Beamten der Staatsbank mit ihrem, wie die Ermittlungen zeigten, fast grenzenlosen Vertrauen darin, dass man mit solventen Personen wie Barmat nichts falsch machen könne. In seiner beißenden Kritik geißelte der bekannte, der Demokratischen Partei nahestehende Journalist Georg Bernhard die konservative Bankleitung: Seiner Meinung nach »spielten die Beamten Bankdirektoren, die nicht wußten, daß die Begabung eines Bankdirektors sich viel weniger darin zeigt, Geschäfte zu machen, als Geschäfte zu unterlassen«.32
Wie bereits dargestellt wurde, begannen die Geschäftsbeziehungen zwischen der Amexima und der Staatsbank im Mai 1923, und bis zur Währungsstabilisierung erhielten Barmat’sche Unternehmen sieben große Kredite, die im Strudel der Hyperinflation untergingen.33 Nach der Markstabilisierung wuchsen die Kredite der Amexima bis zum Jahresende 1923 auf umgerechnet 1,6 Mio. GM; Ende Januar 1924 waren es schon 3,1 Mio. GM. Bis Ende März stieg die bewilligte Summe auf 8,1 Mio., bis zum 19. Mai auf 9,5 Mio. und zum 13. Juni auf 10,5 Mio. GM. Rückzahlungen im August verminderten die Summe, während sich gleichzeitig Zinsen ansammelten, sodass die Amexima am Ende des Jahres mit 9,5 Mio. Schulden in den Büchern der Preußischen Staatsbank stand. Dazu addierten sich die Kredite einzelner Betriebe des Konzerns, darunter der Deutschen Merkurbank, der Berliner Burger Eisenwerke und der Roth A. G. Die Gesamtschulden des Barmat-Konzerns bei der Preußischen Staatsbank beliefen sich zum Jahresende auf 14,5 Mio. RM. Das war ungefähr ein Sechstel aller von der Bank an die Privatwirtschaft ausgegebenen Kredite – eine in der Tat ungewöhnlich und unverantwortlich hohe Summe. Das Bild wird noch dramatischer, wenn man bedenkt, dass die drei privaten Großkunden Barmat, Iwan Kutisker und Jakob Michael zeitweise mit insgesamt 35 Mio. GM an Krediten in den Büchern der Staatsbank standen.34
Das Ganze gibt auf den ersten Blick Rätsel auf, erklärt sich aber damit, dass beide Seiten, Kreditgeber wie Kreditnehmer, noch ganz dem Inflationsdenken verhaftet waren. Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass Barmat nicht an das »Wunder der Rentenmark« glaubte. Auf jeden Fall setzte er sich auch nach deren Einführung mit einigem Erfolg dafür ein, dass der größte Teil seiner Kredite ohne Sicherungsklauseln (für den Fall einer Geldentwertung) vergeben wurden; d.h. konkret: Wäre die Inflation erneut aufgeflammt, hätten Kreditnehmer wie Barmat enorm profitiert. Die Staatsanwaltschaft sah darin (im Gegensatz zum Gericht, das diese Fragen gar nicht weiter verfolgte) nicht nur ein Versäumnis, sondern eine Pflichtverletzung der Leitung der Staatsbank. Denn ohne solche Entwertungsklauseln hätten angesichts des ungewissen Erfolgs der Währungsstabilisierung und damit der Gefahr einer erneuten Inflation erst gar keine festen Vertragslaufzeiten über drei oder gar sechs Monate abgeschlossen werden dürfen.35
Entscheidend ist, dass die zuständigen Beamten der Staatsbank das unternehmerische Vabanquespiel zunächst mitspielten, ja mehr noch, dass sie offenbar ebenfalls dem Geist vergangener Tage verhaftet waren: Nach dem Desaster der vergangenen Inflation wollten sie dieses Mal auf die richtigen Pferde setzen, zum Vorteil der Bank und, das war die Frage, die das Gericht zu beantworten hatte, möglicherweise zu ihrem eigenen Vorteil, indem sie Barmat zu Diensten waren. Barmat erschien als der geniale Finanzier und Organisator, von dem man profitieren konnte.