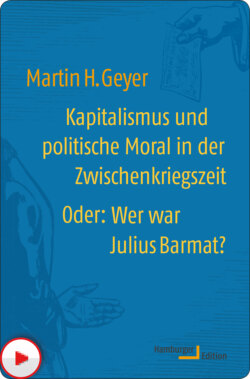Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 38
Effizienz und Wirtschaftlichkeit – das neue Mantra der Reichspost
ОглавлениеÜber die Art und die Motive der Verstrickungen Höfles in die Geschäfte Barmats mochten die Meinungen auseinandergehen. Bei der Einschätzung seiner Person war man sich dagegen einig. Für den Vorwärts-Redakteur Anton Schiff, der mit der Schrift Die Höfle-Tragödie eine Apologie des Postministers lieferte, war er ein »Pfälzer von leichtlebigem, gutmütigem Wesen […]; ein guter Familienvater, fromm, naiv und ohne Argwohn«.44 »Naiv« war eine der wiederkehrenden Charakterisierungen und traf offenbar die Sache. Nach Ansicht seines prominenten, nicht nur im Wirtschaftsrecht bewanderten Berliner Anwalts Max Alsberg war Höfle in geschäftlichen Angelegenheiten »absolut nicht bewandert« und dachte in diesen Dingen »ganz primitiv« – ein bemerkenswertes Urteil, bedenkt man, dass Höfle eine Promotion in Volkswirtschaft vorweisen konnte und zeitweise – höchst dilettantisch – die Kassen seiner Partei, des Zentrums, verwaltete.45
Ähnlich wie die Preußische Staatsbank spielte auch die Reichspost auf dem deutschen Geldmarkt eine neue Rolle. Das am 1. April 1924 in Kraft getretene Reichspostgesetz sah vor, dass die Reichspost und der Telegrafenbetrieb als selbstständiges Unternehmen unter der Bezeichnung Deutsche Reichspost vom Reichspostminister unter Mitwirkung eines Verwaltungsrates nach Maßgabe des Gesetzes verwaltet werden sollte. Dazu zählte auch die Trennung des Vermögens und des Haushalts der Reichspost – darin eingeschlossen waren die Guthaben der Postscheckkunden – vom Reichshaushalt. Im Hinblick auf die Verwaltung der Gelder kam es im Frühjahr zu einer Vereinbarung mit der Reichsbank, wonach liquide Mittel, sofern sie nicht dem Reich zur Verfügung gestellt wurden, an die Reichsbank oder, bei Zustimmung der Reichsbank, an andere große Geldinstitute auszuleihen waren. Dazu zählten die Staatsbanken Preußens, Bayerns und Württembergs, die Deutsche Girozentrale, die für den agrarischen Kredit wichtige Preußenkasse sowie die großen D-Banken und die Commerz- und Privat-Bank. Tatsächlich entstanden jedoch auch vielfach Beziehungen direkt zu einzelnen Kreditnehmern, an welche die zugelassenen Banken das Geld weitergeben konnten. Dazu vermittelte die Post die Kreditsuchenden, darunter die Kommunen in den besetzten Gebieten, zunächst an eine der zugelassenen Banken und stellte dieser dann die erforderlichen Mittel zur Verfügung.46
Das neue Mantra war Kundenfreundlichkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Post und Eisenbahnen sollten »kaufmännisch wirtschaften« und sich von den »Schlacken bürokratischer Schwerfälligkeit« freimachen; Maßstab war der Erfolg der viel bewunderten, expandierenden Großunternehmungen in der Privatwirtschaft. Zudem galt es, dem Staatshaushalt kräftige Einnahmen zu verschaffen. Wie die Vossische Zeitung rückblickend kommentierte, machte sich Höfle an diese Aufgabe »mit dem Temperament, aber auch mit der Unbesonnenheit eines Menschen, der bisher in den Schranken bürokratischer Buchführung gehalten war und nun plötzlich plein pouvoir« erhielt und zudem keiner parlamentarischen Kontrolle ausgesetzt war.47 Auf jeden Fall vertraute der Reichspostminister Julius Barmat, in dem er einen innovativen und aufstrebenden Unternehmer erblickte: »Ich kenn ihn auch als einen sehr tüchtigen Bankier, der des öfteren neue und gute Ideen in das Bankwesen hineingebracht hat«, schrieb der Postminister im Zusammenhang mit Vorbereitungen von Clearingverhandlungen im internationalen Postverkehr, wozu Barmat Kontakte nach Großbritannien und zur Regierung MacDonald aufnahm, den er 1919 auf dem Sozialistenkongress in Amsterdam kennengelernt hatte.48
In der Praxis sah sich das Postministerium nicht an die Reichsbank gebunden, sondern entschied vielfach nach eigenem Gutdünken – zum Wohle der Wirtschaft, wie es hieß.49 So beantragte Lange-Hegermann im Namen der Not leidenden Industrien des besetzten Gebietes und der Rheinpfalz einen Kredit über 2 Mio. GM, der auf Veranlassung Höfles von der zuständigen Abteilung der Reichspost in München ausgezahlt wurde und für den die Preußische Staatsbank und die Merkurbank die Ausfallbürgschaft übernahmen. Im Zuge der Ermittlungen gegen Barmat kam die Staatsanwaltschaft diesem und anderen – dubiosen – Geschäften auf die Spur, die immer wieder zu Lange-Hegermann und anderen Zentrumspolitikern in Sachsen und im Rheinland führten. Aus diesen ersten Anfängen entwickelten sich verzweigte Kreditgeschäfte, in die zunächst die Deutsche Girozentrale und über dieses Institut dann auch andere öffentliche Kassen, darunter die Kur- und Neumärkische Ritterschaftliche Darlehenskasse, die Brandenburgische Girozentrale und die Oldenburgische Staatsbank, involviert waren. Immer garantierte Postminister Höfle die Kredite, die sich auf über 16 Mio. GM beliefen. Das mit Fristen von bis zu drei Monaten vergebene Geld floss über die Barmat’sche Merkurbank an Konzernteile, und ein kleiner Teil diente zur Abdeckung von fälligen Schulden bei der Preußischen Staatsbank. Alles deutet darauf hin, dass sämtliche Beteiligten ihre Kreditrisiken auf die breiten Schultern der Reichspost abzuwälzen versuchten.50
War der Barmat-Konzern schon im Sommer 1924 zahlungsunfähig? Und wer konnte das wissen? Das war justizrelevant, denn dann hätte es sich bei den Krediten möglicherweise um eine Straftat gehandelt (wie auch die Staatsanwaltschaft meinte). In der Staatsbank führte man die finanziellen Schwierigkeiten primär auf strukturelle Ursachen, nämlich die vorherrschende Illiquidität in der deutschen Wirtschaft nach der Währungsstabilisierung, zurück. De facto befand sich ein großer Teil der Wirtschaft zumindest bilanztechnisch in einer Schieflage; Deckungen für Bankkredite waren ins Bodenlose gefallen.51 Aber auch in der Deutschen Girozentrale machte man sich bald Gedanken, die aber in eine andere Richtung zielten. Wie es im Protokoll heißt, wurde von »mehreren Herren betont, daß die Hergabe derartiger umfangreicher Kredite zu verhältnismäßig niedrigem Zinssatz an ausländische Gesellschaften von national-politischem Bedenken aus bedenklich sei«.52 In einem Gespräch, das der Präsident der Deutschen Girozentrale zehn Tage später am 18. August 1924 auftragsgemäß mit Höfle führte, will er diese Bedenken konkreter angesprochen haben: Bei der Amexima handle es sich, wie es in einem Aktenvermerk hieß, »um einen in der Presse viel besprochenen ausländischen Konzern, der, die Not der deutschen Industrie ausnutzend, deutsche Unternehmungen für billiges Geld aufkaufe. Der Aufsichtsrat steht auf dem Standpunkt, daß in der Öffentlichkeit eines Tages festgestellt werden könnte, daß diesem ausländischen Konzern die Überfremdung deutscher Unternehmungen mit deutschem öffentlichem Kapital erst ermöglicht worden sei und daß die Hineinziehung der Deutschen Girozentrale in diese Erörterungen die schwersten Bedenken hervorrufen müsse.«53 Wie in dem Vermerk ebenfalls zu lesen war, erklärte Höfle, dass er »solchen etwaigen Erörterungen in aller Ruhe entgegensehe«: Die Regierung fürchte sie nicht, da Barmat ihr außerordentliche Dienste erwiesen habe, etwa mit der Finanzierung der deutschen Lebensmittelversorgung unmittelbar nach dem Krieg. Außerdem müssten die Aufkäufe des Konzerns auch noch von einem anderen Gesichtspunkt betrachtet werden: Barmat habe dadurch einer großen Zahl von Fabriken, die andernfalls hätten stillgelegt werden müssen, durch die Kapitalzufuhr neues Leben gegeben, sie der Volkswirtschaft erhalten und einer großen Zahl von Arbeitern ihr Brot gesichert. Es sei auch zu berücksichtigen, »daß diese Erhaltung deutscher Industrien nicht nur mit deutschem, sondern auch mit ausländischem Kapital erfolgt sei«. Höfle wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Barmat außerdem Geschäftsverbindungen mit der Preußischen Staatsbank pflegte.54