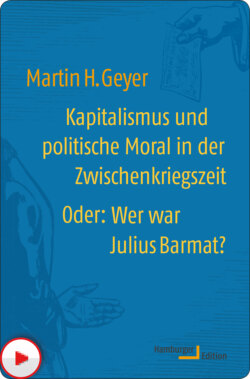Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 31
Solvenz und Solidität: Arbeit am Image
ОглавлениеBis 1922 hatte sich Barmat auf sein seit dem Krieg systematisch erschlossenes Geschäftsfeld konzentriert: den Lebensmittel-, Textil- und Warenhandel. Dieser Geschäftszweig trat nun zunehmend in den Hintergrund und wurde ausgegliedert, und zwar in die im Februar 1922 als selbstständige Gesellschaften eingerichtete Hamburger, Berliner und die im Oktober des Jahres gegründete Wiener Amexima. Sie gingen im März 1923 zunächst in die Amsterdamer Firma Gebroeders Barmat über, wurden dann aber im Januar 1924 an die La Novita mit Sitz in Amsterdam übertragen. Diese schon vor dem Krieg gegründete Grundstücksgesellschaft entwickelte sich zu einer Art Finanzholding. Alle diese Firmen und Firmenanteile waren im Privatbesitz von Julius Barmat, der eng mit seinen Brüdern und seinem Schwager Leo de Winter zusammenarbeitete und diese in den Filialen in leitenden Positionen installierte.
Seit Beginn der deutschen Hyperinflation im Sommer 1923 erschloss Barmat in Deutschland neue, jetzt industrielle Geschäftsbereiche und zog sich aus dem operativen Handelsgeschäft in Amsterdam weitgehend zurück.5 Die Berliner Amexima wurde das neue Standbein. Sie entwickelte sich immer stärker in Richtung einer Finanzierungsgesellschaft, wobei Zukäufe von Firmen und dann zweier Banken sowie einer großen Versicherung wegweisend waren. Konsequent war, dass sich Barmat in Berlin niederließ, wo die Amexima Berlin für ihren Generaldirektor eine Dienstvilla auf Schwanenwerder kaufte.6
Die Amexima Berlin pflegte Geschäftsverbindungen mit bekannten Banken, in Deutschland unter anderem mit der Disconto-Gesellschaft und in Amsterdam mit Mendelssohn & Co. sowie dem Bankhaus Pröhl Gutmann, das wiederum in enger Verbindung mit der Dresdner Bank stand; die New Yorker Geschäfte liefen über das amerikanische Bankhaus Speyer. Im Gegensatz zu früheren Warnungen hieß es in einem Bericht des deutschen Generalkonsulats in Amsterdam, dass nach den eingezogenen Auskünften das Unternehmen günstig beurteilt werde. Julius Barmat werde als »tüchtiger Geschäftsmann« bezeichnet, der zeige, dass er »den gegenwärtigen Zeitumständen gewachsen ist«; ferner weise sein Geschäft im Vergleich zu vielen anderen »einen geregelten guten Verlauf auf«.7
Das holländische Vermögen Julius Barmats taxierten die Ermittlungsbehörden für Ende 1923 auf etwa 2,2 Mio. Gulden, was etwa 3,8 Mio. GM entsprach. Wie er später aussagte, war sein gesamtes Eigentum in seinen Unternehmen gebunden, sodass er über kein »freies Vermögen« verfügte. Letzteres soll seinen Aussagen zufolge zu Beginn des Jahres 1924 höchstens 400000 GM betragen haben. Wie auch immer man die Zahlen beurteilte, Barmat war vermögend, ja er musste, so später die Konklusion des Gerichts, als ein »für die Begriffe, die hier damals [im Deutschland der Inflationszeit – MHG] herrschten, als außerordentlich reicher Mann gelten«.8 Dieser Ruf eilte ihm voraus, und Barmat bemühte sich sehr darum, dieses für einen Geschäftsmann wichtige Distinktionsmerkmal entsprechend hervorzuheben. In Form einer Werbebroschüre, welche die Amsterdamer Amexima für ihren Chef Anfang 1924 erstellte (aber zweifellos von Barmat selbst in Auftrag gegeben worden war), wurde die Solidität des Unternehmens präsentiert: Darin fanden sich Bilder des nicht übergroßen Geschäftshauses an der Keizersgracht, vor dem ein großes Automobil geparkt war und das im Innenbereich eine funktionale und nicht übertrieben luxuriöse Ausstattung aufwies.9 Dieser Punkt ist nicht nebensächlich: Denn wirtschaftliche Solidität und Seriosität galten gerade in der Inflationszeit als knappe Güter – wie wir noch sehen werden, ein wichtiger Aspekt bei der Vergabe von Krediten durch die Preußische Staatsbank.
Julius Barmat tat alles, um den ihm anhaftenden Ruch des »Kriegs- und Inflationsgewinnlers« abzustreifen. Dazu zählte der Hinweis auf sein solides Vermögen als Grundlage, ferner, dass er kein Börsen- und Devisenspekulant sei, was ihm ja im Zusammenhang mit den Lebensmittelgeschäften 1919/20 vorgeworfen worden war. Ein Unterschied zwischen dem Barmat-Konzern und verschiedenen anderen in dieser Zeit schnell wachsenden Konzernen bestand, wie Ende 1924 zu lesen war, darin, »daß ich nicht börsenmäßig neue Aktienpakete hinzukaufe bzw. in meinem Besitz befindliche veräußere, Transaktionen, die ja immer einen etwas spekulativen Einschlag haben, also [dass ich] nicht ein Bank- bzw. Finanzkonzern bin, der u. a. auch verschiedene Aktienpakete im Besitz hat, sondern in erster Linie bitte ich, mich als Industriekonzern anzusehen«.10 Der Kaufmann wollte damit betonen, dass er einen Beitrag zu »produktiver Arbeit« leistete.