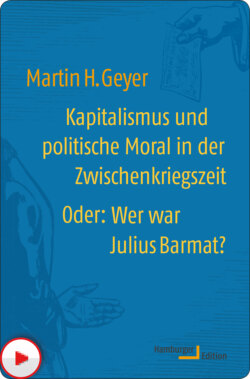Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 51
Ein Abgrund von Täuschung und Korruption
ОглавлениеDie Einschätzung, dass strukturelle Rahmenbedingungen und damit verbundene individuelle Fehlentscheidungen Ursachen für die desaströsen Geschäfte waren, kontrastierten mit solchen Erklärungen, welche die negativen Effekte mit konkreten Person wie den Barmats und mit korrupten Politikern in Verbindung brachten und darin negative Auswüchse des Kapitalismus sahen. Das ist die immer wiederkehrende politische Konfliktlogik.
Persönliche Schuldzuschreibungen sind eingängiger als auf Strukturen abhebende Erklärungen, und juristisch liegen die Dinge noch komplizierter. Die Justiz steht immer vor der Herausforderung, Gesetzesverstöße Einzelner zu bestimmen und konkrete Tatbestände nicht nur zu benennen, sondern auch zu belegen, also Handlungsmotive und Tathergänge zu identifizieren, die auf konkreten juristischen Tatbeständen wie Betrug, Wucher, aktive und passive Bestechung oder Konkursverschleppung beruhen. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass Julius Barmat vielfach mit Blendung und Täuschung arbeitete, was im Gegensatz zu Akten der Bestechung aber nicht strafbar ist. Wie das Zitat Thomas Manns zu Beginn dieses Kapitels illustrierte, lautet die diffizile Frage eher, inwiefern sich Barmat von den vielen anderen »Weinschenks«, darunter insbesondere solchen im Bereich des Handels und des Börsenverkehrs, unterschied.
Barmat war ein besonderer Fall. Anders als Kutisker oder der verschwiegene Michael warb er mit seinen politischen Beziehungen. Dazu zählten die vielen Empfehlungsschreiben, die er geradezu sammelte, gezielt einzusetzen versuchte und mit denen er SPD-Politiker, aber auch Beamte der Staatsbank immer wieder in Verlegenheit brachte. Solche Empfehlungsschreiben, auch von Politikern, waren durchaus üblich. Ernst Heilmann (SPD) meinte unter »großer Heiterkeit« der Parlamentarier, würden diese Schreiben als Kriterium für Korruption gewertet werden, sei seiner Meinung nach das ganze Parlament »von oben bis unten« korrupt. Manche Zeugen sagten später aus, dass ihnen solche Referenzen egal waren, ja dass sie sie eher misstrauisch stimmten. Andere ließen sich davon blenden.127 Alles deutet aber darauf hin, dass Barmat seine politischen Kontakte gezielt ausspielte, im Gegensatz zu anderen Kaufleuten, die das vielleicht schon deshalb nicht nötig hatten, weil ihre soziale Reputation gefestigt war. Viele betrachteten dieses Vorgehen als spezifisch berlinerisch, galt Berlin doch, im Gegensatz zur Kaufmannsstadt Hamburg, als Hauptstadt der Aufsteiger, die diese, darunter solche jüdischer Konfession, sehr wohl auch diskriminierte.
Mit Blick auf das gelegentlich fast schon als naiv zu bezeichnende Vertrauen in den reichen Barmat kann man aber auch die Frage stellen, welche Rolle ausgerechnet das »Vertrauen in Ostjuden« spielte. Diese Frage erscheint angesichts der oft diagnostizierten Ressentiments, die diesen Personen gerade wegen ihrer Konfession entgegenschlugen, auf den ersten Blick merkwürdig, ja geradezu kontraintuitiv. Aber fast alle der bisher genannten Akteure – Barmat, Kutisker, Holzmann, Sklarz und Helphand, und die Liste ließe sich erweitern – hatten, wie ein Mann aus der Bankpraxis meinte, »Deutschland gegen Rußland manchen Dienst erwiesen« und waren »für die Militärverwaltung Ob.-Ost und die deutsche Zivilverwaltung in Polen unentbehrliche Helfershelfer«.128 Auch Barmat eilte der Ruf voraus, im Krieg auf der Seite Deutschlands gestanden zu haben. Es verwundert nicht, dass dieses eher sensible Thema, das Fragen der militärischen Geheimdienststrategien aufwerfen musste, in den öffentlichen wie den parlamentarischen Debatten kaum angesprochen wurde.
Aber Barmat vermochte mit solchen Geschichten und seinen vielfältigen Beziehungen manchen zu bluffen. Der folgende Bericht eines in den Niederlanden lebenden Deutschen von der Geschäftsreise seines Bruders gibt einen recht guten, wenn auch drastischen Eindruck des Barmat’schen Geschäftsgebarens. Auf dem Weg nach Memel machte der Reisende 1919 in Berlin einen Zwischenstopp und wurde Julius Barmat vorgestellt, der, wenn die Schilderung stimmt (wofür einiges spricht), ein großes Geschäftstheater inszenierte: »Mein Bruder erzählte, dass Herr Barmat auf ihn einen sehr vornehmen Eindruck machte und dass er bei seinem Besuch im Central Hotel in Berlin von Herrn Barmat den Eindruck gewonnen habe, es mit einer Persönlichkeit zu tun zu haben. Da in der halben Stunde, in der er dort war, Herr Barmat mit verschiedenen deutschen Ministern telefonierte und ein Paket an den Reichstagspräsidenten [sic!] Ebert expedieren liess [sic!], während der [sic!] er sich im Nebenzimmer mit anderen Persönlichkeiten der deutschen Regierung unterhielt«, habe sein Bruder den Eindruck gewonnen, »dass er mit einem sehr einflussreichen Mann zu tun habe, der in enger Beziehung zur deutschen Regierung steht«. Als der niederländische Geschäftsmann dann selber in Berlin war, sah er sich in diesem Urteil seines Bruders bestätigt, zumal sich die Szenen wiederholten. Trotz der verhaltenen Warnung eines Bankbeamten der Commerz- und Diskontobank kaufte er nicht nur 300 Zentner Blättertabak und mehrere Waggonladungen Zigaretten, die in Memel angeliefert werden sollten, sondern ließ sich offenbar auch eine große Menge Tee aufschwatzen, die er, ebenso wenig wie die Zigaretten, vorher in Proben in Augenschein genommen hatte, und zwar auch deshalb, weil er nichts vom Teegeschäft verstand. Nicht nur das: Barmat habe ihn bei der komplizierten Valutaberechnung und Preisstellung geprellt. Der überforderte Kaufmann, der einigermaßen blauäugig Millionenverträge abgeschlossen hatte, will nun plötzlich gemerkt haben, dass er »einem ganz gefährlichem Menschen in die Hände gefallen war«.129 Wer von den beiden der geschicktere Kaufmann war, steht außer Frage.
Kleider machen Leute. Das Gleiche gilt für den Habitus des weltmännischen Auftretens des reichen Kaufmanns, der fremde Sprachen beherrschte und zwischen Amsterdam und Berlin pendelte. Das beeindruckte, wie die betreffenden Personen zu ihrer Verteidigung regelmäßig betonten. Nicht nur Beamte der Preußischen Staatsbank waren demnach »leichtgläubig[e] und damit auch leicht zu täuschend[e]« Männer, die sich vom Reichtum beindrucken ließen, wie man in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft lesen kann.130 Der promovierte Bankbeamte der Staatsbank Hellwig war davon ausgegangen, dass das Amsterdamer Mutterhaus für eine Schuld von 10 Mio. Goldmark »unbedingt sicher« war. Doch das waren Fantasiezahlen. Barmat hatte es vermieden, Angaben über den Wert seiner Konzernunternehmen zu machen – aber die Beamten hatten auch nie danach gefragt.131 In ähnlicher Weise folgte das Gericht später der Version der Verteidigung der Direktoren Alfred Staub und Julius Rabbinowitz des Roth-Konzerns, denen aber zugute gehalten wurde, dass sie bestrebt waren, »durch ernste Arbeit einen großen Industriekonzern aufzubauen« (und zwar ohne Betrugsabsichten im Zusammenhang mit der Roth-Anleihe, wie die Staatsanwaltschaft meinte). Die Behauptung der beiden Unternehmer erschien plausibel, nämlich »daß sie in dem Glauben an unerschöpfliche Mittel Julius Barmats […] und im Vertrauen auf die unversiegbaren Geldquellen sich zu den kostspieligen Erweiterungen ihres Konzerns bereitgefunden und jedenfalls bei der Auflegung der Obligationsanleihe noch an eine aussichtsreiche Zukunft ihrer Unternehmen geglaubt haben«.132 Ähnliche Rechtfertigungsstrategien findet man bei dem Zentrumsabgeordneten Hermann Lange-Hegermann, bei den in Berlin allseits bekannten Direktoren der Merkurbank, bei den Honoratioren in der Altenburger Sparbank und den SPD-Abgeordneten, die sich, ähnlich wie Höfle, auf die Rettung von Arbeitsplätzen beriefen. Und am Ende dieser Nahrungskette von Hoffnungsträgern finden sich Bettelbriefschreiber, darunter pikanterweise auch ein »Fräulein von Papen«, eine weitläufige Verwandte des konservativen preußischen Landtagsabgeordneten und späteren Reichskanzlers Franz von Papen (Zentrum), die sich 1924 zunächst verzweifelt an den Reichspostminister gewandt hatte, und zwar mit dem Hinweis, dass, falls ein fälliger Wechsel nicht eingelöst werde, »unsere sämtliche Möbel uns herausgetragen [werden]. Wir haben ja sicher entsetzlich viel verloren, unsere schöne Besitzung, Existenz, gute Möbel alles und nun soll uns auch noch unser letztes herausgegeben werden.« Auch in diesem Fall hatte Julius Barmat ein offenes Ohr.133