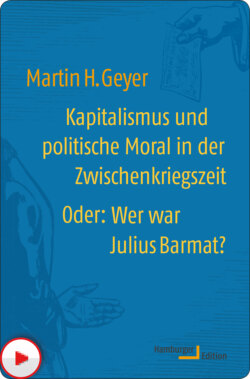Читать книгу Kapitalismus und politische Moral in der Zwischenkriegszeit oder: Wer war Julius Barmat? - Martin H. Geyer - Страница 52
Verlockungen des Geldes: Täter und Opfer
ОглавлениеDie (Selbst-)Blendung durch Reichtum war somit ein wichtiges Argument, mit dem sich Gier verschleiern ließ. Darüber hinaus spielte im juristischen Diskurs, bei dem es auch um die Verantwortung der Beamten der Preußischen Staatsbank ging, der Rekurs auf soziale Ungleichheit und Unterlegenheit eine Rolle. Das zeigt der Fall des promovierten Staatsfinanzrats Fritz Rühe, den die Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen hatte und gegen den sie im Zusammenhang der Kreditvergabe an Barmat wie Kutisker wegen schwerer passiver Bestechung ermittelte. In seinem Fall ging es um die »gastliche Aufnahme« in Barmats Haus, die üblichen Liebesgabenpakete aus Holland, einen Delfter Porzellanteller, an dem die Frau Rühes Gefallen gefunden hatte, was Barmat sofort bemerkt hatte, und die Vermittlung des günstigen Erwerbs von Aktien und Anleihen. Verfahrenstechnisch konzentrierte sich die Staatsanwaltschaft auf Rühes Involvierung in den Fall Kutisker, machte aber davon die Anklage im Falle Barmat abhängig,134 sodass die Namen austauschbar sind:
»Rühe ist ein Opfer Kutisker [sic!] geworden. Mit Menschen von der Art Kutisker ist er vor Oktober 1923 kaum in Berührung gekommen. Vergleicht man Rühe mit Kutisker, so ergibt sich ohne Weiteres, dass Rühe von vornherein dem Kutisker unterlegen war. Aus kleinen Verhältnissen stammend, dienstlich nur mit einwandfreien Großkaufleuten in Berührung gekommen, sah er hinter Kutisker mit seiner Großmannssucht und seiner verschwenderischen Lebensführung nicht den Hochstapler, sondern einen schwerreichen Ausländer, dessen Geschäfte so groß waren, dass die Diskontogesellschaft sie nicht bewältigen konnte, und der trotz der Inflation seine Substanz ständig vermehrte. Während die Staatsbank ihre Substanz nahezu völlig eingebüßt hatte! Hier liegt der springende Punkt für die Entschließung Rühes, die Erklärung für sein ganzes Verhalten. Die Staatsbank hatte ihre Substanz verloren, und die Generaldirektion war sich dahin schlüssig geworden, dass alles geschehen müsse und jeder nach besten Kräften an seiner Stelle dabei mitwirken müsse, die verlorene Substanz wiederzugewinnen. Welch ein Anreiz für den ehrgeizigen Rühe! Als deshalb am 4. Oktober 1923 Kutisker in seiner Eigenschaft als Generaldirektor des alten Bankhauses E. v. Stein zu ihm auf die Staatsbank kam und ihn mit Empfehlungsschreiben, Protzereien mit Dollarguthaben und dergleichen sowie großen Transaktionen auf der Börse beschwatzte, sah er in der Geschäftsverbindung mit diesem Mann die Möglichkeit auftauchen, große Gewinne für die Staatsbank zu machen. Er schenkte Kutisker restlos Vertrauen und wenn er einmal Vertrauen gefasst hatte, so wurde er so leicht nicht wankend. Das sollte sein Verhängnis werden.«135
Die staatsanwaltschaftliche Suada hörte hier nicht auf: Dank »der große[n] Überredungsgabe Kutiskers« erreichte dieser bei dem Beamten, der voller »Optimismus« die Reorganisation der Bank betrieb, »was er wollte, [nämlich] was die kleinste Privatbank ihm [Kutisker – MHG] glatt abgelehnt hätte«. Zwar war am Ende »der Verdacht der Bestechung und der Untreue keineswegs völlig ausgeräumt«; dennoch habe es keine greifbaren Anhaltspunkte gegeben, »die geeignet wären, seine Verurteilung herbeizuführen«. Nachweisbar war nicht einmal ein »dolus eventualis« – also das Bewusstsein, etwas Falsches zu tun. Nein, Rühe sei es nur darum gegangen, »der Staatsbank zu nützen«; er wollte von den Geschäften der Steinbank profitieren (wie wir das ähnlich im Falle Barmats sahen); das Problem war die falsche Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Jahr 1924, die sich als mehr als nur eine Phase von »kurzzeitigen Stockungen« erwies.136 Das war nichts anderes als die Geschichte eines aufrechten deutschen Michels, wie man ihn mit seiner Zipfelmütze und naiven Unschuldsmiene in den Karikaturen der Zeit zuhauf findet, der sich, geblendet vom Schein und der Beredsamkeit seiner Gegenübers, hinters Licht führen ließ – in diesem Fall von einem »jüdischen Kapitalisten«, ohne dessen wahre Persona zu erkennen. Der Oberfinanzrat kam auf jeden Fall ungeschoren davon.
Kritischer sah die Staatsanwaltschaft den Fall Hellwig, der Ende 1924, also kurz vor dem Zusammenbruch, von der Staatsbank in den Barmat-Konzern übergewechselt war, wo er eine unbedeutende Position innehatte. Er war der einzige der Bankbeamten, der bestraft werden sollte, und zwar wegen passiver Bestechung und Betrugsabsicht.137 Zusammen mit Rühe hatte er Anfang Februar 1924 an der ersten Geburtstagsfeier des Kindes von Henry Barmat und am Einsegnungsfest des Sohnes von Julius Barmat teilgenommen; er pflegte den geselligen Umgang – Hellwig legte gelegentlich mit seinem Ruderboot in Schwanenwerder an –, und während der Reisen Barmats »wurde dieser Verkehr in Form eines fast überschwänglich freundschaftlichen Briefwechsels aufrechterhalten«.138 Auch wenn das Gericht in seinem Fall später passive Bestechung als erwiesen ansah, unterstrich es, dass dem Bankbeamten Hellwig kein absichtliches Handeln zum Nachteil der Staatsbank nachgewiesen werden könne, ja es habe auch keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, »daß Dr. Hellwig eine solche Absicht zuzutrauen wäre. Sein ganzer Lebenslauf, seine Erziehung und seine gesellschaftliche Stellung, seine mit Auszeichnung abgeschlossene juristische Vorbildung und seine durch die Berufung in das Justizministerium anerkannten Leistungen im Justizdienst, aber auch seine anschließende Tätigkeit in der Staatsbank sprechen dagegen, daß er nun unter dem Einfluß Julius Barmats von dem bisherigen geraden Wege seines Lebens abgewichen sein und seine Pflichten als Beamter so weit vergessen haben sollte, daß er sich zu der für seine Moralbegriffe höchst verwerflichen Tat hergegeben hätte, die Staatsbank absichtlich zu schädigen.« Er handelte nicht »böswillig, aber aus einer überspannten Großzügigkeit und einer Überschätzung seiner wirtschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen heraus«; so sei es »in leichtfertiger und fahrlässiger Weise zu der Behandlung der Kreditgeschäfte gekommen, die zu den schweren Verlusten für die Staatsbank führten«.139
Eine andere Geschichte der subtilen Bestechung, ja der Unterwerfung erzählte auch Wilhelm Koenen (USPD/KPD), der Barmat 1920 anlässlich des niederländischen Hafenarbeiterstreiks kennengelernt hatte. Für ihn war das Zusammentreffen ein sehr »unangenehmes Pech«, wie er später formulierte, das »einzige derartige Malheur« in seinem bisherigen Leben. Denn Barmat gab ihm in Holland einen kleinen »Privatkredit« über mehrere Hundert Gulden, den der Geschäftsmann später, angesichts der wüsten Angriffe auf ihn seitens der Kommunisten, in einer öffentlichen Erklärung zurückforderte. Koenen behauptete, er habe diesen Kredit zurückbezahlt (was aber auch nicht glaubwürdig war), ohne dass er dies aber nachweisen konnte. Sehr dramatisch schilderte er im Reichstagsausschuss sein Schicksal: Barmat unternehme alles nur Mögliche, um Personen in »seinem Netz« zu fangen: »Das ist der Eindruck: wie eine Spinne, die in der Mitte sitzt und aufpaßt, wo fängt sich einer in meinem Netz, wo kann ich ihn dann packen und für meine Zwecke dann doch noch heranziehen. […] Diese Versuche wurden mit einer Aufmerksamkeit und Umsicht, einer Beharrlichkeit gemacht, mit einer Eleganz, mit einer – man kann es schlecht in deutsche Worte kleiden – übertriebenen Liebenswürdigkeit, in einer Form, die wirklich etwas Ungewohntes an sich hatte.« Koenen erzählte später dem – wie das stenografische Protokoll vermerkte – »leicht erheiterten« Reichstagsausschuss, Barmat habe mit dem Kredit geglaubt, ihn »erdrücken« zu können, ja er habe sogar – vergeblich – versucht, die Hotelrechnung der deutschen Delegierten zu begleichen. Im folgenden Jahr, so Koenen, ließ der Kaufmann ihm ein Liebesgabenpaket zukommen und versuchte – erfolglos –, über ihn Kontakte zur russischen Handelsdelegation herzustellen. Ironie der Geschichte: Solche Empfehlungen erhielt Barmat später dann vom Diplomaten von Maltzan, der in dieser Zeit als Russlandexperte die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion mitgestaltete.140
Geschenke dieser Art sollten denn auch dem Berliner Polizeipräsidenten Richter und dem früheren Reichskanzler Gustav Bauer politisch das Genick brechen. Wo lag die Grenze zwischen Freundschaftsgeschenken und aktiver Bestechung? So klar die Gesetzesnormen sind, die aktive und passive Bestechung – Vorteilsnahme, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung, Bestechung (§§ 331–334 StGB) – definieren, so kompliziert gestaltet sich seit jeher ihre Anwendung. Das gilt selbst für einzelne Aspekte des Falles Höfle, der in vielerlei Hinsicht eklatant war (auch wenn das Gericht über den in Untersuchungshaft gestorbenen Höfle nicht mehr richten musste). Der Postminister hatte sich beim Bau eines Hauses in Lichterfelde übernommen, da die Gesamtkosten weit die ursprünglich erwartete Summe von 125000 GM überstiegen. In diesem Zusammenhang vermittelte Julius Barmat direkt über die Amexima einen Kredit von 42000 GM. Der so Begünstigte glaubte, das Geld zurückzahlen zu müssen, und wollte es, so seine Aussage, später durch eine Hypothek abdecken, was aber nicht geschah. Die Ermittlungen zeigten, dass die Amexima den Kredit als »Konzernunkosten« verbuchte, was wiederum Höfle nicht gewusst haben will.141 Problematisch waren außerdem 500 US-Dollar, die Höfle sich »als Reisekosten« nach Marienbad schicken ließ, aber auch die Beträge über 700 und 500 Mark, die er von Julius Barmat für die Witwen und Waisen der Post und für die Partei erhielt. Das warf die Frage auf, ob er mittelbare Vorteile dadurch hatte, dass er über diese Gelder zu Partei- oder Wohltätigkeitszwecken verfügen konnte (eine ähnliche Spende ermöglichte 1919 die Gründung des Rosa de Winter Heims für bedürftige Kinder in Sachsen).142 Außerdem stand die Frage im Raum, wie die regen Finanztransaktionen zwischen dem Aufsichtsratsmitglied der Barmat’schen Merkurbank Lange-Hegermann und Höfle einzustufen waren; es handelte sich offenbar um Parteispenden, die allem Anschein nach im Zusammenhang mit der Kreditvergabe der Reichspost standen.143
All diese Geschichten tauchten seit 1925 zunächst im Zuge des Skandals, dann der Untersuchungen der verschiedenen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse und schließlich der Justizbehörden auf. Es ging um einige der merkwürdigsten und spektakulärsten Fälle der Kriegs-, Inflations- und Stabilisierungszeit (auch wenn sich bei näherem Hinsehen die Zahl der Fälle und der involvierten Personen schnell vervielfacht), die nun aber nicht nur der Anlass waren, diese früheren Geschichten aufzuarbeiten, sondern auch sehr umfassend Kapitalismus, Demokratie und wirtschaftliche Moral zu verhandeln. Kehrte man mit der erfolgreichen Währungsstabilisierung und dem Abbau der Kriegs- und Übergangswirtschaft zurück in die Bahnen eines »rationalen Kapitalismus«? So sahen das zweifellos viele Zeitgenossen, zumal in den Reihen der Wirtschaft. Der Abbau der Kriegswirtschaft hieß Abkehr von den krassesten Formen des »politischen Kapitalismus« im Weber’schen Sinne, auch wenn neue »korporatistische« Arrangements von Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik sowie die viel diskutierten »politischen Löhne« und »politischen Arbeitsbedingungen« des Sozialstaates diese Phänomene in ein neues Licht rückten.144 Oder waren die Exzesse vielleicht nur vordergründig ausgetrieben? Machten sich Formen von Misswirtschaft, Betrug und Korruption in allen Bereichen des öffentlichen Lebens wie der Wirtschaft breit, auch weil das neue demokratische System sie beförderte? Sechs Jahre später, nach einer kurzen Phase des wirtschaftlichen Booms, hatten viele den Eindruck, dass die Währungsstabilisierung weniger erfolgreich war, als es scheinen mochte, und dass es noch mehr als genug Grenzgänger des Kapitalismus gebe, die es in die Schranken zu weisen gelte.
* Schon vor der Währungsstabilisierung zirkulierten sogenannte werbeständige Zahlungsmittel, wobei oft leicht missverständlich von Goldmark (GM) gesprochen wurde. Die Reichsmark (RM) löste im August 1924 die Rentenmark ab, die mit der Einleitung der Währungsstabilisierung am 20. November 1923 eingeführt worden war; zeitgenössisch war es aber üblich, nicht von Renten-, sondern von Goldmark zu sprechen. Auch nach Einführung der Rentenmark gab es noch die buchmäßige Rechnung mit der (Inflations-)Papiermark im Verhältnis eine Rentenmark gleich eine Billion Papiermark.