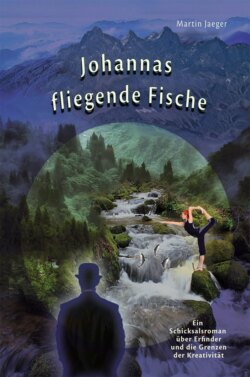Читать книгу Johannas fliegende Fische - Martin Jaeger - Страница 10
Iglu
ОглавлениеHier. Hier ist es gut. Das Bett ist heute Nacht ein Iglu. Mein Refugium erwärmt sich schneller, wenn ich durch den Mund atme. Ein wärmendes Haus habe ich gebaut gegen die innere Kälte. Der offene Schlitz am oberen Ende der Bettdecke erfüllt perfekt die Funktion einer Klimaanlage, führt mir Sauerstoff zu, die Höhle wärmt das Fleisch, während ich friere wie eine Nacktschnecke in der Arktis. Die Luft über die Wirbelsäule in die Füße ziehen. In die Füße!
Energie erzeuge ich allein: Bin mein eigener Ofen. Die Heizung hat der Vermieter abgestellt, nur das persönliche Charisma, so vorhanden, erhellt meine zweifelhafte Wirklichkeit. Immerhin, zwingt die Kälte zur Konzentration. Die habe ich bitter nötig. Die Leinwand muss total verdunkelt sein, bevor das aktivierte Körperlicht den Ort hier zu erleuchten vermag.
O Ascher, bester Ascher, alter Flieger, wann ist dir bloß dein Optimismus abhandengekommen?
Wenn ich in das undurchdringliche Schwarz des Zeit-Raum-Gefüges hier starre, öffnet es sich in alle Farben hinein. Ein Lichtermeer aus gelben, roten, blauen Prismen und Punkten tanzt vor den Augen, will Bilder malen, die wieder zerstieben, bevor sie fertig und erkennbar sind. In rhythmischen Abständen dringt nur pechschwarz herein, während herzheißer Atem versucht, die Luft unter der Bettdecke zu erwärmen, die ich mir luftdicht über den Kopf gezogen habe.
Sie haben mich gefeuert! Aber noch immer weiß ich nicht genau, warum! Muss eine Erklärung finden in dieser Nacht. Der erste Eklat seit fast zwölf Jahren mit Chief Spiegel, dem Boss und Mentor.
Der Rückflug aus Asien am Morgen kostete Kraft, mehr als ich mir eingestehen will. Mein gesamtes Zeitgefüge hat sich in kleinteilige Trümmer zerlegt.
Spiegel und Scheck saßen hinten im Flugzeug bei den Düsen und isolierten mich, als sei ich bereits Vergangenheit. Warum nur? Hatte ich denn nicht meinen Part erfüllt, hatte akquiriert wie ein Wilder, mindestens alle Vierteljahre einen talentierten Entdecker angeschleppt, immer schön angeboten, dabei gegurrt und gedienert wie eine Hofschranze?
Zuletzt war es mir geglückt, diesen rührigen japanischen Ingenieur aufzutreiben und erfolgreich zu einer Demonstration seiner abgefahrenen Geräte zu überreden. Als ob das nichts gewesen wäre. Eine absolute Höchstleistung!
Dieser unscheinbare Takayama, er versprach Unabhängigkeit von allem, was man heutzutage als Privatmensch in einem Haus an Energie benötigt. Ein kleiner Kasten war sein ganzes Geheimnis. In einzigartiger Weise hatte sich offenbart, dass jede hinreichend fortgeschrittene Technologie sich als ununterscheidbar von echter Magie erweist, wie die Unterhaltungskünstler schon immer behaupteten.
Takayama hatte uns auf seine zurückhaltende Art in Vollendung etwas vorgezaubert, ohne das Bedürfnis zu wecken, seine Arbeit auch nur irgendwie erklären zu müssen. Aber die Requisiten führte er dennoch alle vor. Das war wunderbar. Wir erlebten einen Hattrick, drei großartige Mirakel auf einmal. Keine 18 Stunden ist das jetzt her.
Die Akquise war relativ unaufwendig. Die Internetrecherche mit der russischen Suchmaschine erwies sich als sehr ergiebig. Sie zensierte in meinem Interessensbereich deutlich weniger. Obendrein wies sie ein benutzerfreundlicheres Ranking auf als die Konkurrenz. Ich sah schneller, was ich suchte, ohne manipulative Ablenkungen von irgendwelchen Großkonzernen. Jedenfalls zwei Wochen lang.
Auch hatte ich die Demofilme des Ingenieurs in einem Tokioter Erfinderportal entdeckt. Nichts davon war in englischer Sprache und ich verstand zunächst nur Bahnhof. Mein «Japanisch für Touristen» reichte mitnichten dafür aus. Das bedeutete in jedem Fall Arbeit! Aber dann konnte ich die asiatischen Schriftzeichen ins Englische übersetzen, fand mit Google Maps Adresse und Telefonnummer. Den Rest verdankte ich meinem Charme, wie immer. Wenn du keine Ahnung hast, halt wenigstens die Klappe und sei freundlich, hieß die Devise von Papa. Dann klappt es vielleicht auch mit den Frauen. Wie recht er hatte.
Den Göttern sei Dank sicherte ich alle Daten des Erfinders, bevor die Videos kurze Zeit später aus dem Netz verschwanden. Zack. Das Fenster war, wie meistens bei den seriöseren Erfindern, maximal 14 Tage geöffnet; ich musste wirklich schnell und auf Draht sein. Das nennt man dann wohl Anglerglück. Es sah nach nicht weniger als einer Revolution in Sachen neuer Energien aus. Schnell genug gewesen und dabei Glück gehabt, dachte ich.
Endlich hatte ich Spiegel und Scheck dort, wo ich sie schon immer haben wollte: staunen, akzeptieren, anerkennen.
Gefühlt lebte ich seit Jahren in der Haltung, dass Sonne und Wind nur Übergangsenergien sein werden, platzhaltende Diener des nächsten Jahrtausends, mehr Surrogate als Allheilmittel. Es schien etwas viel Unkomplizierteres, Praktischeres zu existieren, in der Lage, effektiv Energie zur Verfügung zu stellen. Meine freche Grundannahme setzte sich als Handlungsanweisung durch.
Takayama, der schweigsame, taoistische Züchter edler Koikarpfen, tauchte zum rechten Zeitpunkt auf. Er sollte den Chief überzeugen – auch von meinen Fähigkeiten – bevor ich aussteigen wollte aus diesem dubiosen Geschäft. Die Nase hatte ich schon eine ganze Weile voll. Es kam einfach nichts Vernünftiges dabei heraus. Im Prinzip wollte ich seit zwei Jahren den Laden verlassen.
‹Da sind sie dir ja fein zuvorgekommen, mein Freund.›
Ein Durchbruch stand ins Haus. Spiegel hatte sofort und ohne Diskussion wie sonst, den Kontakt akzeptiert. Ich freute mich noch, als er, im Gegensatz zu seinen sonstigen Gewohnheiten, leibhaftig anrief und knurrte, wir flögen für einen eintägigen Aufenthalt in den Norden Japans, um den Tüftler zu treffen. Ich solle schon mal vorschlafen und mein Business-Japanisch aufpolieren.
Siegeslaune legte sich wie Champagner auf mein Gemüt; es ging darum, der Welt ein unverhofftes, einzigartiges Geschenk zu machen.
Geblieben davon ist nichts außer einem zitternden, alten Mann im Jetlag unter der Bettdecke in Berlin. Hermetisch abschließen, die Löcher abdichten, wenn es in der nächsten Stunde gelingen soll, Wärme zu erzeugen. Atem, sei Heizung!
Wie hatte ich mich vorbereitet auf den Trip, mir den japanischen Sprachführer wiederholt einverleibt, den schwarzen Anzug abgebürstet, der noch passte wie angegossen. So schlecht war die Zeit am Ende doch nicht gewesen, redete ich mir ein, die Dinge liefen in gewisser Weise auf Schienen und wie von selbst. Kein Stress, keine Begehrlichkeiten, alles friedlich. Dachte ich.
Langsam wärmt sich mein Iglu auf. Ich will eine Position einnehmen, in der ich mehr Sauerstoff bekomme, ohne das Wärmefeld zu zerstören, in der ich das Gehirn mit frischer Luft versorge, solange ich wach bin. Werde vollständig rekapitulieren müssen, um der Sache auf die Spur zu kommen. Totale Erinnerung, jetzt.
Früher habe ich nie gefroren. Mich krummlegen wie ein Embryo, Nahrung aus der immer bereiten Fruchtblase aufnehmen. Mit einem heliumgefüllten Ballon an der Kinderhand irre ich durch den Jahrmarkt des Lebens, um die Dunkelmänner an diskreten Orten zu treffen. Unten und ganz weit hinten im Schatten der Vergangenheit halten sie sich auf, die mich initiierten, zu einem der ihren machten, einem Schläfer, der auf Befehl … auf Befehl?
Niemand hat mir etwas befohlen! Was ich tat, geschah ich aus freien Stücken. Seit einiger Zeit träume ich auf Englisch. Warum?
Meistens geht es um Energie, immer um unsichtbare Männer in Schwarz. Wo sind da Schuld, Unschuld, Ursache, Wirkung? Heute sprechen wir vom Tod und seinen Stellvertretern! Vergiss die Welt der sichtbaren Triebe. Beschwere dich. Es wird nichts bringen, denn es war dein Job – und du brauchtest das Geld. Feinfühlig genug reagiertest du darauf, was dir maßgeblich und wichtig erschien, suchtest dein Glück im Himmel, also auch auf Erden – und bist auf der Nase gelandet wie der Donnervogel im indianischen Medizinrad-Orakel. Und nun?
Wenn ich mich auf die Seite lege, zusammenrolle, schaue ich durch den magischen Würfel, den Kasten, der meine Wirklichkeit ist. Denn ich lebe in ihm: mein Wohnzimmer, ein Kubus von 3,60 Metern Kantenlänge. Mit viel Platz nach oben zum Spinnen harmoniert er schön mit dem Kohlekasten meiner Kindheit, dem privaten Denkraum, in dem ich damals, am Anfang, unsichtbar alles aus der Umgebung wahrnahm, ohne körperlich sichtbar zu sein. Den Rest besorgten Vorstellungskraft und eine punktgenaue Fantasie. Fuzzy Logic, eine Mischung aus Wahrscheinlichkeitsrechnung und Spekulation.
Jeder andere war zu groß, passte einfach nicht da rein. Längst lagerten die Eltern keine Kohlen mehr in dem Herd mit dem Rollenkasten unten. Das schwarze Gold deponierten wir im Keller. Aber Töpfe und Deckel, mit denen ich Lärm machte, die habe ich sofort gesehen. Ordentlich packt man die weg, or-dent-lich, wie jemand, der sein Nachtlager bereitet. Zwischendurch ein wenig Tschingderassa.
Eine angenehme Wärme herrscht dort, in der Küche, wo ich Siesta in meiner Box abhalte, mich hineinfalte wie ein Varietéartist. Peinlich bin ich darauf bedacht, auch noch nach dem Mittagessen hineinzupassen, auch später, als ich größer werde. Es ist entscheidend, dass man die Lade immer gut schließt, um nicht mehr sichtbar zu sein, wirklich für den Rest der Welt von der Bildfläche zu verschwinden. Nicht mehr vorhanden, futschikato! Geist in der Flasche, was hier ein Kohlenkasten ist.
Mutter schließt gewöhnlich den Kohlekasten. Zu. Bin so lange fort, bis sie ihn wieder öffnet. Das ist der Deal, bis ich auch das Öffnen allein beherrsche. Angst vor knallengen Räumen unbekannt. Eng ist schön. Doch, um diesen Ort zu verlassen, benötige ich ein Motiv. Der Dreijährige ist langmütig. Viel zu interessant sind die Gespräche und Begegnungen in der Zeit nach dem großen Krieg, die ich erlausche, um allzu leichtfertig den Posten aufzugeben.
So etwas tut man einfach nicht.
Die Mutter ist mit ihren fleischigen, roten Armen über den Spülstein gebeugt, hantiert in der Nähe des Feuers mit feucht Dampfendem, als es an der Küchenhaustür polternd klopft.
«Komm jetzt mal da raus und mach die Tür auf», höre ich ihre Anweisung im Zwielicht des Kohlekastens. Sie weiß genau, dass ich nur knapp an die Türklinke in der Küche langen kann, die auf den Hausflur hinausführt und ich nie, nie, nie die Haustür öffne. Sie hat es mir sogar verboten. So redet man doch nicht mit einem Kind! Türen, sie werden für mich immer geöffnet. Automatisch. Warum sollte sich das ändern?
Mürrisch verlasse ich mein Versteck, schiebe Leib und Lade aus dem Herd heraus, schwinge mich auf das beigestellte neue Dreirad, fahre durch ein wohlwollendes Gemisch von eingeweckten Senfgurken, Kohlefeuer und Kaffeeduft bis zur Küchentür. Dort stehe ich auf, stelle mich auf den Sitz des Gefährts, strecke den Arm bis hoch an die Klinke.
Die Haustür fällt mir fast entgegen. Plötzlich steht er vor, nein, über mir: Riesengroß, blond, über und über mit Ruß bedeckt, der original weiße Grubenanzug so kohlpechrabenschwarz wie die ganze Erscheinung. Nur ein paar helle Flecken scheinen auf dem Overall durch. Auf dem Kopf trägt er wie angewachsen den verschmierten Helm mit Grubenlampe. So tritt er ein in meine feuchtwarme Küche, ein Lachen auf dem rußigen Gesicht und grinst mich frech an. Ich weiche vorsichtig zurück vor dem Riesen. Er kommt immer näher, pflanzt sich an unseren Küchentisch.
Der ungeduschte Bergmann schnappt nach einer Tasse, schüttet mit riesigen Schaufelhänden Kaffee aus der Kanne ein. Und schwupps … platziert er mich mit einer flinken Bewegung auf seinen schwarzen, klobigen Schuh mit dem kleinen goldenen Teddy in der Schleife, schaukelt mit mir hin und her, lacht dabei ausgelassen.
Weiße blitzende Zähne in einem rußverschmierten Antlitz. Der riecht aber komisch. Dann schlägt er die Beine übereinander, setzt mich auf seinen Unterschenkel und schleudert mich durch die Luft wie nichts. Ich fliege, fliiiieege, bis er mich mit seinen Schaufelbaggerhänden wieder auffängt. Schüchtern und ungnädig versuche ich, mir die staubigen Handabdrücke von dem gerade frischen weißen Unterhemd zu wischen, Ruß, den der Bergmann mit seinen Fettkohlepranken auf dem vorher fleckenlosen T-Hemd hinterlassen hat.
Mein neues T-Hemdchen!
«Und du? Wo kommst du denn jetzt her?», fragt die Mutter so, als ob sie es nicht ganz genau wüsste, überspielt die Tatsache, dass ihr just jemand ihre Küche verdreckt. Gelassen wie eine Serviererin stellt sie ein Milchkännchen auf den Tisch, übersieht großzügig den Staub, den der Mann in unsere Wohnküche trägt. Das wird seinen Grund haben. Schwarzer Kohlenstaub bedeckt den Küchenboden, klebt am Grubenanzug, an den Füßen, überall. Zwischen zwei Schluck aus der Kaffeetasse bringt er ein «Unter Tage, wie immer» heraus.
Das Wort vernehme ich zum ersten Mal. Ich skandiere es nach, während ich mit dem Rad unter dem Küchentisch meine Kurven und Konsequenzen ziehe: «Un-ta-ta-ge, un-ta-ta-ge, un-ta-ta-ge.»
Im sicheren Wendekreis des Dreirades begutachte ich das größte Paar Stiefel meines Lebens, beinahe so groß wie ich selbst, pechschwarz, breit und hoch geschnürt, mit abgeschliffenen glänzenden Schutzplatten gegen Steinschlag. So müssen die Siebenmeilenstiefel aussehen, die Schuhe der Titanen, über die ich in den Gute-Nacht-Geschichten von Vati manchmal höre. An seinem linken Schnürsenkel überprüfe ich den Gesundheitszustand des feinen goldenen Teddybären-Amuletts. Bringt Glück, ganz bestimmt.
Der weiße Mann mit den schwarzen Stiefeln ist mir vertraut, doch so schwarz im Gesicht, dass ich unseren Nachbarn, den jungen Steiger, einfach nicht erkenne. Einem Teil in mir kommt er bekannt vor und ahnt, es ist derselbe, der erst vor kurzem als Weihnachtsmann unterwegs war und mir das Dreirad brachte, auf dem ich jetzt sitze. Der war auch so groß.
Unter Tage, da ist man weg, unsichtbar wie ein Heinzelmännchen, wie ich in meinem Schubfach. Das macht ihn mir sympathisch. Verstehe genau, was er den ganzen Tag treibt: Er beschafft die Kohle für den Ofen, die früher in der Lade lag, wo ich lausche. Aber der Kohlenkasten ist mein. Der ist privat, passt außer mir niemand hinein. Da bin ich unter Tage, arbeite, sammele Informationen, höre, was in der Küche geschieht, verborgen für alle, insbesondere wenn ich den kleinen Kasten schließe und verschwunden bin. Simsalabim! Ich kann zaubern, ich kann zaubern.
Die Faszination für die Schürfer des schwarzen Goldes bleibt für Jahre ungebrochen. Mit der Förderung von Kohle bezahlen die Deutschen ihre Kriegsschulden. Im Gegenzug versorgen die Siegermächte die Bergleute und ihre Angehörigen mit Nahrungsmitteln, damit sie ausreichend Kraft zum Schuften haben. Ohne die Förderer der Energie – das verstehe ich früh genug, säßen wir im Kalten. Kein Schnitzel am Sonntag.
Doch erst später, wird mir klar, was das bedeutet für die Energieversorgung. Im Ruhrpott, im Pütt, entscheiden sich nach dem Krieg die Schicksale von Bergmannsfamilien unter der Erde. Da heißt es Obacht, ein unbedachter Schritt – und im Nu bist du gewesen. Mit der Grubenlampe auf der Stirn und weit geöffnetem dritten Auge erkunden sie die Schächte in der Tiefe, finden intuitiv den Weg. Die Schätze der Welt sollen dem sternenlosen Schoß des Untergrundes entrissen werden.
Man kann nur ahnen, welche Risiken die Kumpel auf sich nehmen, wie weit sie in die Tiefe steigen müssen, um die Stollen zu bohren, die das schwarze Gold für uns verfügbar machen, das so hellorange im Ofen brennt. Niemand, der nicht dazu gehört, kennt die Art der Gemeinschaft, in der die Bergleute die drohenden Gefahren tragen, damit wir im Warmen sitzen. Noch vor dem Ölboom fertigt man probeweise alles Denk- und Kostbare aus Koks: Margarine, Öl, Treibstoff, Kunstdiamanten. Hast du Kohle, hast du alles. Mein Heinzelmännchen, mein Gott, morgens in Weiß, abends in Schwarz, das ist ein zwei Meter Hüne, ein Weihnachtsmann für alle Fälle, ein rußverschmierter Riese, auf dessen Schultern ich stehe.
Bis die Figur aus dem Leben verschwindet. Da heizten wir im Winter schon mit Gas. Aber es gibt ja keine Zufälle, sagt man. Man sieht sich immer … wie oft eigentlich?
Nach zwanzig Jahren bringt er sich auf schmerzhafte Weise zurück in die Erinnerung. Da hat es der Pimpf auf dem Dreirad zu einem Studenten des Fotojournalismus gebracht, der in den Semesterferien in einer Unfallklinik im Ruhrgebiet jobbt.
In einem weißen Kittel helfe ich, wo ich kann und darf: Waschen, füttern, Patienten verbinden, sorge ich mich um Exkremente, setze Katheter, nehme Blut ab, bade Kinder und frisch Operierte, verabfolge Einläufe bei alten Männern, lege Gipsverbände an und säge sie später von den Knochen der – toi toi toi – Ausgeheilten.
In den 70ern arbeite ich in den Ferien stolz als einer der letzten Laienpfleger des ausgehenden Wirtschaftswunders, angelernt von Medizinern und Nonnen – bevor die kommende Krankenhausreform nur noch geschulte Profis an die Kranken lassen wird. Der Job bereitet einen morbiden Spaß, entspricht gleichzeitig meinem empfindsamen Naturell, bekomme ich doch Gelegenheit, von Ärzten durch reines Beobachten zu lernen. Nach den Semesterferien werde ich mit Stift und Kamera das professionell institutionalisierte Grauen dokumentieren, dessen Zeuge ich sein durfte. Meine Spiegelreflex-Kamera registriert mit neutraler Sachlichkeit, was das nackte Auge des Betrachters nicht zu ertragen mag.
Welche innere Haltung benötigt ein Mensch, um einem Verletzten den Bauch sachgerecht aufzuschneiden und anschließend in der Mittagspause in der Kantine Gefallen an einem Schweineschnitzel mit Pilzen zu finden? Das ist die frühe Tabuforschung, derer der Nachkriegsintellekt fähig sein muss. All dies findet lange vor den Arztserien im Fernsehen statt, dafür live und ungeschnitten.
Was pragmatische Konditionierung bedeutet – mit der Unbill des Lebens und des Sterbens zurecht zu kommen – erlerne ich als Hilfspfleger von zwei befreundeten Unfallchirurgen. Während einer Amputation ruft mir einer von ihnen unter dem Kreischen der Knochensäge zu, dass er ursprünglich vorhatte, eine Holzhandlung zu eröffnen. Der Job als Operateur in einer Unfallklinik sei ganz ähnlich, nur miserabler bezahlt. Merke: Nur die Harten kommen in den Garten. Diese Männer meinen es tatsächlich ernst.
Das Krankenhaus liegt genau zwischen drei noch aktiven Zechen am Nordrand von Dortmund. Hier, in das Zentrum diakonischer Härte kehren Bergmänner heim, wenn sie das Schicksal am Schlafittchen packt.
Wenigstens zweimal pro Woche bringen die Sanitäter mit Alarmsirenen und Blaulicht einen Verunfallten in den sogenannten Durchgang, die Notfall-Aufnahmestation; in der Regel auf einer Bahre, häufig genug bewusstlos und mit gebrochenen Weißnichtwas. Die unheilige Allianz aus Ruß, Blut und Tränen gestaltet die Arbeit als Hilfspfleger nicht gerade als eine triviale Tätigkeit. In Wahrheit wird hier versuchsweise das finale Chaos von Leib und Seele geordnet. Brüche und Frakturen führt man mir vor, bei denen ich zum ersten Mal aus dem Körper herausragende Knochen zur Kenntnis nehme, abstrus verdrehte Extremitäten, schmerzverzerrte Gesichter, Fleisch an der äußersten Kante seiner biologischen Existenz. Das bedeutet Mitgefühl im Dauertraining. Hoffe, dass irgendwo immer ein paar Engel sind, die mir helfen werden, zu ertragen, was ich sehen muss, um das Leben zu verstehen. Wirklich schwach machen mich die Krankenschwestern, die ihren Beruf mit so viel Liebe und Hingabe verrichten und die eingelieferten halben Leichen auf den Weg der Besserung bringen. Man lernt nie aus.
In makellos weißem Kittel empfange ich die Notfälle, notiere als erster Ansprechpartner die Vorgeschichte des Geschehens, schreibe so präzis wie kurz die medizinische Vorgeschichte auf: Patient sei unter Tage unter Bruch geraten, steht da lakonisch auf den Formularen. Das Personal ist gehalten, die Angaben von Unfallopfern und ihrer Angehörigen nur im Konjunktiv, der Möglichkeitsform, zu dokumentieren. Die Berufsgenossenschaft wird später die Notizen prüfen, um keine falschen Rentenhoffnungen bei den Verunglückten aufkommen zu lassen.
Anschließend entfernen der Stationsarzt, die Schwestern und ich mithilfe von Schere und Skalpell die staubigen Kleider von den Opfern der Tiefe. Meine Helden, die Boten von Glück und Energie, hier sind sie an ihr vorläufiges Ende gelangt.
Eines Tages liegt er da, in unserer weiß gekachelten Durchgangsstation, dem Aufnahmebereich des Hospitals. Er fällt mir gleich auf, durch seine Größe und die scheinbare entspannte Lässigkeit, mit der er sich auf der Trage eingerichtet hat. Fragmente des einst goldenen Teddybären baumeln resigniert am Schnürsenkel seines Stiefels, verbogen und verkratzt. Der Lack und ein Ohr sind ab. Grauweiß sind die Haare des Steigers geworden, heller als ich sie kannte. Ruß klebt an den Schläfen. Er schaut aus wie eine schlecht geschminkte Leiche aus einem Film von Fellini, eine erstarrte Puppe, die gerade der Rest von Leben zu verlassen scheint.
Noch während ich mich neben ihn stelle, tritt Stationsarzt Trilling hinzu. Beiläufig erwähne ich die verdrehte Haltung meines ehemaligen Nachbarn auf der Bahre. Und dass ich ihn kenne.
«Und, Ascher? Fällt dir was auf?»
Trilling, mit dem ich einmal pro Woche früh morgens in den Waldgebieten um Dortmund herum laufen gehe, funkelt mich an, stets gewillt, jedem etwas medizinische Bildung beizubringen, der danach verlangt. Seine Augen sprühen vor Tatendrang.
Nein, gar nichts fällt mir auf. «Der atmet ziemlich flach», versuche ich es, doch Trilling wirft mir nur einen müden Blick zu, resigniert ob meiner Ignoranz.
«Der atmet überhaupt nicht mehr», seufzt er.
«Aber man sieht ja gar nichts. Wieso ist der tot?» Als Hilfspfleger und Laie darf ich mir erlauben, eine Diagnose nicht unmittelbar zu erkennen. Trilling streift ein Paar Gummihandschuhe über und weist mich an, es ihm gleichzutun.
«Hilf mir, ich werde dir die Todesursache zeigen.» Er ergreift den regungslosen Leib des Bergmanns und richtet ihn stöhnend auf. Schwer, der Mann. «Ah, mein Rücken! Das blöde Alter, verflixt. Komm, halt ihn gerad mal für einen Moment.»
Während ich noch mit Blicken auf den frischen weißen Kittel verweise, höre ich sein unwirsches «Kittel haben wir genug, nu halt gefälligst!»
Eh ich mich versehe, befinde ich mich in inniger Umarmung mit dem 120 Kilogramm schweren, verblichenen Steiger aus dem Schacht, dem Helden der Kindheit, meinem Weihnachtsmann.
Stationsarzt Trilling hat jetzt beide Hände frei, befühlt die Wirbelsäule des Bergmanns oberhalb der Schulterblätter.
«Hier greif da mal hin, fühl mal!»
Er führt meinen Arm am Gelenk, zeigt mir die Stelle, wo ich den Rücken des Bergmannes abtasten soll. Ich drücke und höre ein helles Klickern, das entfernt an einen Spaziergang in einem Kalksteinbruch erinnert. Klickediklick.
«Genau hier hat ihn der Steinschlag zu fassen gekriegt. Das Wetter, das ihn unter Tage traf, hat vom Nacken bis kurz vor der Herzgegend im Bereich des Rückgrats alles an Nerven und Sehnen durchtrennt. Seine Knochen schweben quasi im Nichts! Die Wirbel klackern hin und her wie Murmeln. Wir können bei ihm nicht mehr viel tun, nur noch einmal röntgen für den Schlussbefund und dann ab nach Zimmer 13!»
Er lässt los. Das Gewicht des Toten lastet auf mir. Ächzend lasse ich den Steiger auf die Bahre zurücksinken.
Trilling zieht die Handschuhe aus, während wie auf unsichtbaren Befehl eine Röntgenassistentin den Raum betritt. Routiniert öffnet sie den Abfalleimer direkt neben der Tür. Man kennt sich. Mit seinen feinen Chirurgenfingern knüllt er die Gummihandschuhe zu einem Ball, versenkt ihn dann mit einem zielgenauen Wurf in schlafwandlerischer Präzision in dem vier Meter entfernten Mülleimer. Die Röntgenschwester klappt den Eimer ordentlich zu, bevor sie an den Tisch tritt, mir mit einem Blick andeutet, dass sie nun anfangen wird, den Leichnam zu präparieren. Sie bemerkt meine persönliche Verunsicherung, ahnt, dass ich aus irgendeinem Grund betroffener bin als sonst. Ich möge mich bitte nach dem Transport in die kalte Klinik umziehen und erst einmal einen Kaffee trinken gehen. Rien ne va plus. Sie hält ihre flache Hand an die Kehle. Game over.
Trilling wendet den Kopf zur Seite, flucht verhalten. In Kürze werden die letzten Zechen der Region schließen; der Bergbau spielt im Ruhrgebiet so gut wie keine Rolle mehr. Trotzdem sterben immer noch Menschen unter Tage. Ohne mich eines weiteren Grußes zu würdigen, geht er zum Waschbecken, desinfiziert Hände und Unterarme und verlässt die Aufnahmestation in Richtung Operationssaal.
Kein schöner Beginn einer 36-Stunden-Schicht.
Irgendetwas tut mir leid, weiß nicht was und wo. Meistens bleibt nur wenig Zeit für Gefühle in der Unfallklinik. Sie bleiben zwangsläufig diffus.
Später bringe ich den Steiger mit einem Kollegen nach Zimmer 13, in die kalte Klinik. Das sind die Decknamen für das Zwischenlager des Unfallkrankenhauses. Speziell in Gegenwart von Angehörigen umschreiben wir das Wort Leichenhalle, nutzen andere Ausdrücke, um niemanden darüber zu verunsichern, dass auch bei uns gestorben wird. Für diesen Job gibt es traditionsgemäß im Anschluss einen Schnaps.
Der Raum liegt unterhalb des Erdgeschosses mit direktem Kontakt zum Parkhaus. Eine Zwischenlagerung ist heute nicht notwendig. Der Mann vom Beerdigungsinstitut wartet seit einer Viertelstunde am Ausgang des Kellerraumes mit seinem großen schwarzen Leichenwagen, gleich an der Rückseite des Krankenhauses, zur Straße hin. Bei Unfällen mit Todesfolge reagieren die Bergbaugesellschaften routiniert und rasch, um unnötiges Aufsehen zu vermeiden.
Der Bestatter ist ein Gnom, deutlich unter einsfünfzig Körpergröße, wirkt wie der Conférencier aus einem Zirkus, trägt ein ähnlich faltiges, zeitloses Gesicht zur Schau. Seine Augen blitzen. Der zerknitterte Frack mit der Nelke erweckt den Eindruck, als ob er auch darin schläft. Welch ein schmuddeliges Geschäft, am Tod von anderen zu verdienen, spricht es in mir. Aber einer muss es tun. Als wir den Raum betreten, in dem es immer nach Formalin riecht, sitzt er auf der Eisenpritsche, wo wir die Leichen ablegen. Mit seinen kurzen Beinen baumelt er spielerisch hin und her, springt erst von der Bahre, als ich mit dem Kollegen Blickkontakt aufnehme. Bin froh, dass er da ist, so brauchen wir die 120 Kilogramm nicht auf die Pritsche zu hieven.
Der Bestatter schaut mehr durch mich durch als mich an, zeigt zuerst auf die dunklen Flecken auf dem Kittel, legt dann den Zeigefinger auf die Lippen, bevor er raunt: «Niemand entgeht uns, leider.» Aus nikotingelben Zähnen zeigt er die Andeutung eines Lächelns. Ist in Eile heute.
Ich schaue auf den weißen Pflegekittel mit den schwarzen Abdrücken, nicke, verlasse den Raum, der regelmäßig desinfiziert wird und in dem auch jetzt wieder ein beißender Formalinnebel durch die Luft züngelt. Wer Zimmer 13 betritt, bekommt das Aroma so leicht nicht aus der Nase. Die Kollegen riechen es sofort, wenn man in der kalten Klinik war.
Ich will meinen Schnaps. Sofort. Immer häufiger tragen die Kumpel die Aura von Auflösung, für mich ein untrügliches Zeichen dafür, dass dieser Beruf in Kürze aussterben wird. Ihre Ausdünstungen vermitteln neben Blut, Schweiß und Tränen nur noch Abschied, selbst wenn ich sie im Durchgang noch lebend antreffe. Ein neuer Kittel ist fällig. Der Bestatter hat mich irritiert, seine zeitlos schmierige Eleganz in Anbetracht des Todes verstört. Niemals hat er Flecken auf der Weste. Seine pietätvolle Geschäftstüchtigkeit verunsichert mich.
Die einen sind im Dunkeln, die andern … Trotzdem kommt niemand an ihnen vorbei. Kaum jemand erkennt sie im Alltag. Wie die Bergmänner. Nach ihrem Einsatz gehen sie in das Dunkel zurück, aus dem sie kamen; eigentlich sympathisch, sogar nützlich, aber unheimlich. Der Blick des Leichenmannes bleibt haften. Bestenfalls im Traum ist so etwas zu verarbeiten. Ich schlafe viel in dieser Zeit.
Niemals wirst du ihnen entgehen; die Wölfe finden dich wie das Lamm, das aus der Herde ausbrechen will, um selbständig und frei zu leben. Sie sorgen dafür, dass du derjenige bist, der bezahlt.
Zunehmend fühle ich mich unwohl in der Heimat. Ich fürchte mich davor, hier den Rest meines Lebens verbringen zu müssen. Es ist an der Zeit, das morbide Ruhrgebiet zu verlassen. Irgendetwas schreit nach Jugend und Leben.
Daher heißt die nächste Ausfahrt: Berlin.