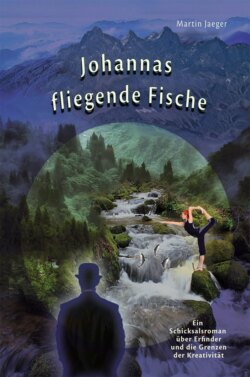Читать книгу Johannas fliegende Fische - Martin Jaeger - Страница 11
Frontstadt
ОглавлениеDas Eiland in der DDR ist noch von einer drei Meter hohen Mauer plus Selbstschussanlagen umgeben. Die vorläufige Insel der Glückseligen ist im Westteil gelegen. Denken wir zumindest. Worte wie «Internet», «joggen» oder «Handy» – Fremdwörter. Ein Traum von Aufbruchswilligen, Bundeswehr-Deserteuren und Flüchtlingen aller Art gibt sich vor Ort ein Stelldichein. Im Ruhrpott flüstern sie von paradiesischen Zuständen. In Berlin sei der Kopf rund, damit er sich in alle vier Himmelsrichtungen wenden kann, vertraut mir das zweihundert Jahre alte Sprichwort eines populären Königs an. Und Seligkeit funktioniert gemäß persönlicher Façon –, kommt drauf an, was du unter Glück verstehst.
Die physikalischen Grenzen des gefühlt 30 mal 40 Kilometer großen Gebiets gestalten sich ohne Frage erträglicher als die kleinteilige Heimat im Westen. Die Stadt wirkt sympathisch wegen des Kastens, eines überschaubaren Gebiets. Dein Terrain bestimmst du selbst, je nach Zugehörigkeit. Das führt zu Momenten freier Liebe, unabhängigem Arbeiten, stundenlangen Läufen durch den Grunewald, den futuristischen Träumen von Hippieparadiesen und der Idee, das da etwas sein könnte, das dem Mikrofon und der Kamera des gelernten Dokumentaristen bisher entgangen ist. Es soll, so hört man, Informationen geben, die die Gestalt klüger und den Atem leichter machen. So die Hoffnung der 70er Jahre. Es firmiert unter dem Namen Bewusstseinserweiterung; Abenteuer erleben, auch wenn sie nur im Kopf stattfinden. Vertikale Reisen sind das Gebot der Stunde. Der Stadtschamane ist unterwegs am Tage und in der Nacht. In einem Käfig voller Narren ohne Polizeistunde befindet er sich ständig auf der Suche nach dem inneren Heil, das die physische Teilung der einstigen Hauptstadt aufheben möge – und die im Gehirn der Einheimischen, die sich nichts sehnlicher wünschen als die Wiedervereinigung mit den Verwandten auf der anderen Seite. Daher lassen sie die Korken so laut knallen wie nur eben möglich, damit auch der Letzte noch den Ruf erhöre: Berlin bleibt frei.
Frei wovon und wofür, frage ich mich?
Aus aller Herren Länder stranden sie in der Frontstadt. Der Wind spült sie in das Zentrum der vorerst freien Rede: Lehrer, Gurus, spiritistische Medien, Würdenträger und Auserwählte. Frieden vor sich hertragend, machen sie auf allwissend und sei es nur in der Geste. Sie alle sind Teil eines nicht näher benannten, ein halbes Jahrhundert lang dauernden Bildungs- und Aufklärungsprogramms der verbündeten Siegermächte. Reeducation, Umerziehung, wird man es erst später nennen.
Hoffnung auf die neue Zeit weckt alles chlorophyllgrüne und die Idee der erneuerbaren Energien. Wie überhaupt ein verschwenderisches Verhältnis zur Energieversorgung existiert, schließlich kommt der Strom aus der Steckdose und ist seit Kriegsende ständig irgendwie vorhanden. Über seine Herkunft und den immer noch durch Kohlenstaub aus den Kraftwerken der DDR verursachten Wintersmog beginnt man gerade erst nachzudenken. Nichts an Selbstkritik ist sichtbar vor Tschernobyl. Erst nach dem Genuss von verstrahltem Hirschgulasch mit Pilzen macht sich die grüne Bewegung auf, dem radioaktiven Tod ein Schnippchen zu schlagen und Gaia, die heilige Mutter Erde, einer willfährigen Rettung zu überführen.
Überhaupt: Immer wieder anfangen, alles Visionäre willkommen heißen; mit heiterem Handauflegen werden wir Ärzte überflüssig machen, im Namen der Selbstermächtigung wollen wir vorangehen als Helden des kommenden Zeitalters. Die Fähigkeit der Trümmerfrauen, sich selbst zu helfen, gar am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen – selbst sind hier Mann und Frau – das halten wir hoch, solange es geht. Wer war noch gleich das Volk?
Bis die zarten Alternativstrukturen von den Generatoren erfahren, die ihre Energie aus dem Äther zu saugen vermögen, genauso wie Menschen auch. Eine Vision. Macht hoch die Tür, das hört sich vielversprechend an, besser als alle Hippieträume zusammen. Nicht genug bekommen wir davon zu hören, lernen, forschen, was das Zeug hält. Neben den neuen Technologien, solar Angetriebenes, Wind, Wasser und den Rest vom Fest, interessieren mich Ingenieure und Bastler, die in ihren Garagen, Kellern und Dachkammern der Stadt vor sich hin wursteln. Sie sprechen mit großen Augen von dem unendlichen Meer an Energie, das man maschinell anzapfen könne. Gibt es das wirklich oder entspringen diese Fantasien nur dem Wunschdenken?
Als Dokumentarist suche ich Leute auf, die damit zu tun haben, behaupten, Aggregate und Lichtmaschinen konstruieren zu können, die Strom aus dem Überall saugen. Doch so weit ist es noch nicht. Im Moment existiert all dies nur in den Köpfen oder auf dem Papier, wird allein von den ewig Gestrigen und ihren historischen Erinnerungen gespeist. Soll ich denen glauben? Darf ich das? Wann macht denken frei? Wo ist die Grenze? Zumindest gilt es, guten Geschmack zu bewahren. Schon immer.
Ein Kongress über unbekannte Phänomene jagt den nächsten im alternativen Berlin der 80er Jahre. Es scheint, als ob der Rest der Welt der Stadt ihren Geist aufzwingen will.
Wie auf dem Laufsteg präsentieren sich Gruppierungen und Sekten aller Art. Wie heißt die Mehrzahl von Unikum? Mitglieder einzelner Fraktionen aus Osteuropa lassen im Verlauf heiliger Gesänge Goldzähne und Plomben nachwachsen. Russische Yogis stellen sich vor, die mit Röntgenblick durch Mauern sehen können, amerikanische Hünen, die in den Wäldern von Wyoming mit kleinen Außerirdischen tanzten. Einer befreundeten Chirurgin empfiehlt genau jener Riese, in Operationssälen anstatt mit Metall besser nur noch mit Keramikmessern zu hantieren, da die Wunden so schneller verheilten. Warum nicht? Design soll sein.
Einer Eingebung Folge leistend beschließe ich, einen Kongress für Grenzwissenschaften und alternative Energien zu besuchen. Dokumentaristen und Reporter verkaufen gerade alles Originelle aus diesem Bereich: Fotos, Tondokumente, aktuell oder für die Archive. Insbesondere verschrobene Ideen und findige Exoten stehen für das Improvisationstalent des diskret besetzten Landes und der vermeintlich freien Stadt im Wirtschaftswunder. Es lebe der menschliche Erfindergeist!
Bereits auf den Pressekonferenzen bekommt die Öffentlichkeit Kuriositäten zu hören, die geeignet sind, den inneren Montagepunkt deutlich weiter als erlaubt in Richtung Transzendenz und Vielfalt zu verschieben. Möchten wir wirklich dorthin, wo es auch noch einen echten Himmel mit Geistern, Engeln und UFOs gibt – und ein Kaninchenloch, in dessen Untiefen alles machbar erscheint? Hoch ist tief und weit ist nah. Was geht? Woran wollen wir uns ausrichten in diesem irgendwann vereinten Deutschland? Es gibt Arbeit für mich: sammeln, sortieren, gewichten, entscheiden. Welcher Geist soll siegen? Kann ich Einfluss nehmen?
Hier treffe ich auf russische Generäle, die von Begegnungen mit vier Meter großen außerirdischen Robotern sprechen. Ein Blick in ihre Augen, und ich bekomme ein klasse mulmiges Gefühl.
Ein weißhaariger pensionierter Deutscher berichtet nostalgisch und mit heiligem Ernst von der Wiederentdeckung eines Antriebssystems, das seine Weggefährten erstmals in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts nach Zeichnungen aus alten indischen Schriften nachbauten, eine Maschine, die mit rotem Quecksilber funktionierte und wirklich flog. Das vedische Ramayana-Epos, Tausende von Jahren alt, scheint unserer Zeit weit voraus. Mal mehr asiatische Mythologie lesen, gelobe ich und die Zukunft gerät kurzfristig zu einer Erinnerung an die Vergangenheit. Ein ewiger Kreislauf. Wer bin ich, das zu beurteilen, denke ich, setze meine Erfahrungen in Krankenpflege zur Bildung von Toleranz und Ausdauer ein. Alles Wahnsinnige hier, ein Käfig voller Narren, aber interessant. Warum nicht, solange es Spaß macht?
Drei Tage renne ich mit dem Mikrofon herum, sammele Prospekte, befrage Informanten. Man spricht allgemein von einer neuen Epoche, die bald anbräche, in der unglaubliche Dinge geschähen, sich Potenziale in uns freisetzten, von denen wir nicht einmal wüssten, dass wir sie besitzen.
Ohne Wertung häufe ich Daten an, nehme stundenlang Tonbänder auf, schieße Fotos für Agenturen, hoffe, dass es mir später gelingen wird, die Spreu vom Weizen zu trennen, bemühe mich, meine Vorurteile zu revidieren, bin nur wissensdurstig. Das eigene Innere ist das eigentlich zu entdeckende, unbekannte Land, die wirkliche Terra incognita.
Landkarte beschreiben. Speicher füllen. Upload. Was glaubst du?
Die Rechner von heute arbeiten schnell, aber vor dem Internet ist die Datenverarbeitungsanlage im Kopf das Medium der Wahl. Unerfüllte Sehnsüchte machen Platz für Fantasie. Der Computer, das bin ich. Selbst denken hilft ungemein dabei.
Aber es war überheblich anzunehmen, wir wären bei unseren kindlichen Abenteuern allein und unabhängig, könnten tun und lassen, was immer wir wollten, würden bei all unseren Aktivitäten nicht genauestens beobachtet. Das genaue Gegenteil war der Fall.
Ohne es zu merken, laufe ich in seine Falle. Ein blinder Fleck, vielleicht. Jeder hat ja so was, irgendwo.
Am vierten Tag des Konvents, einem Sonntag, sehe ich ihn zum ersten Mal. Er sitzt hinten rechts in der Cafeteria des Kongresszentrums. Für einen Moment verbuche ich ihn als blinden Mann, der in der Ecke Platz genommen hat und alleine Hof hält. Eine Sonnenbrille in einem geschlossenen Raum bemerke ich, dazu ein schwarzer Anzug, Krawatte, weißes Hemd, Nelke im Knopfloch, diese altmodische Melone und ein Gehstock mit Silberknauf. Overdressed sagt man heute dazu. Damals ging es so gerade noch. Unpassend gekleidet erschien er mir. So hat der Bestatter in Dortmund auch ausgesehen. Ein Engländer möglicherweise, vermute ich, belauere ihn mit meinem angelesenen, schamanisch-castanedaschen 180-Grad-Blick aus den Augenwinkeln heraus. In einem bestimmten Winkel kann ich mich auch wegdrehen und ihn über die Spiegelung in den Brillengläsern observieren. Beobachten, ohne zu fokussieren ist mir zu anstrengend heute. Wie ich überhaupt das Gefühl nicht loswerde, dass hier jeder jeden beobachtet. Kein Unterschied scheint mehr zu existieren zwischen privat und öffentlich in der kulturellen Wirklichkeit Westberlins.
Einige Tonaufnahmen ergeben bei der Überprüfung zu Hause nur weißes Rauschen von sich und die Negative von ein paar Filmen mit Fotos sind bemerkenswert unbrauchbar. Geschwärzte Filmrollen, nicht schön. Wie machen sie das nur? Vielleicht sollte ich schlicht heimfahren, Feierabend machen. Beim Bezahlen des letzten Cappuccinos für den Tag an der Theke winkt er mich heran. Ob ich mich nicht zu ihm gesellen wolle. Warum nicht? Eventuell noch ein Informant. Oder, besser: eine Gelegenheit zur Entspannung.
Das Aufnahmegerät lege ich neben das Tischbein, puste vorsichtig über den Milchschaum, dessen warmer Dampf sich als feiner Nebel auf die Brille setzt. Durch beschlagene Gläser nehme ich den Mann in Schwarz mir gegenüber ins Visier. Der Silberknauf seines Gehstocks oszilliert in meinem eingenebelten Brillenglas in allen Farben, genauso wie die Skulptur des Messingfalken hinter ihm. Fertig bin ich, einfach fertig. Drei Tage lang das Mikrofon hinhalten, immer nur zuhören, Fragen stellen. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich habe genug. Basta. Der Kaffee schmeckt merkwürdig metallisch. Vielleicht bin ich das ja selbst – metallisch –, sollte mehr Wasser trinken.
Für einen Blinden spüre ich den Mann in Schwarz recht intensiv. Muss an der Erschöpfung liegen. Er betrachtet, erfühlt mich durch die undurchsichtige Sonnenbrille, schenkt mir ein schmallippiges Lächeln. Zumindest sieht es so aus, denn die Mundwinkel sind leicht angehoben. Eine Stimmung ist nicht auszumachen. Hinter getönten Gläsern amüsiert er sich anscheinend fürstlich über mich.
«Soweit, so gut, Ascher, so weit, so gut. Ich habe mir erlaubt, Sie ein wenig zu beobachten in den letzten Tagen. Fleißig sind Sie ja, das muss man Ihnen lassen. Offensichtlich wollen Sie tatsächlich etwas wissen. Weiterkommen, wie? Karriere machen als Reporter – eventuell?»
Woher kennt er meinen Namen? Ach ja, mein Teilnehmerschild auf dem Jackett, dass mich als Pressevertreter ausweist. Er hingegen trägt keinerlei Kongressausweis. Mit den Fingern seiner Linken, graue Handschuhe, vollführt er eine affektierte Drehbewegung. Er verunsichert mich, spricht korrektes Deutsch mit amerikanischem Akzent. Nein, er ist nicht blind. Aber eigenartig.
Ein unangenehmes Gefühl breitet sich in meiner Magengrube aus. Liegt das an dem dritten Cappuccino heute? Als ob ich halluziniere. Zahllose Interviews mit psychischen Medien, Zeugen und ausländischen Erfindern habe ich absolviert, stets bemüht, eine passable Ernte einzufahren, immer erst nach hochnotpeinlicher Selbstkritik die Spreu vom Weizen getrennt, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten verworfen. Da macht seine Ironie auf eine gewisse Weise Sinn. Vielleicht liege ich ja falsch mit meinen Vermutungen über die Verschleierungen bei den modernen Energieformen; gerade weiß ich selbst nicht mehr, was ich glauben soll. Perpetuum mobile, Nullpunktenergie, Tachyonen-Beschleuniger: für den Sohn eines schuldbeladenen Landes, das gerade knapp 45 Jahre Umerziehung hinter sich gebracht hat, erweist sich das visionäre Material dieses Konvents als starker Tobak, selbst für mich. Bin nur ein Fotograf und Dokumentarist, der um seine Miete kämpft, kein Physiker. Was werden die Redakteure im Sender sagen? Wahrscheinlich darf ich über den Konvent nur als Kabarettnummer berichten; Satire verkraftt man bezüglich dieses Themas gerade noch. Doch die Leute meinen es hier ernst. Und ich auch, im Prinzip.
«Mein Name ist Spiegel, angenehm», unterbricht er meine internen Adrenalinstöße. Warum fühle nur ich mich in seiner Gegenwart so merkwürdig?
«Meine recht lange, aktive Arbeitsphase kommt nun bald an ihr Ende. Da dachte ich, ich besuche einmal eine solche Konferenz. Wie ist es für Sie gelaufen hier? Sie sind ja noch ein Neuling auf dem Gebiet – wie ich sehe.»
Woran sieht er das? Jetzt bloß nicht patzen, es ist definitiv der falsche Augenblick. Im Prinzip soll er mir egal sein, aber vielleicht hat er was, einen Job, eine Information. Immer schön vorsichtig. Profi bleiben. Tief einatmen, Energie im Hara halten, Hirn in Bewegung setzen – und los.
Innerhalb von 5 min 10 s liefere ich ihm einen Report, den ich im Wortlaut so ähnlich auch am kommenden Tag live in einem Rundfunksender der Noch-Frontstadt abgeben werde. Mein Hirn ist eine Festplatte, merkt sich alles Neue, kann wiederholen, Anmerkungen und wörtliche Rede abspulen. Darum bin ich Dokumentarist geworden. Wahrnehmungen authentisch wiederzugeben benötigt genau die Konzentration, über die ich verfügte. Vergangenheitsform.
Es amüsiert mich, dass ich es trotz Überlastung noch drauf habe, strahle nach vollzogenem Bericht den alten Herrn gegenüber triumphierend an.
Spiegel senkt leicht den Kopf, bewegt geschmäcklerisch Mund und Nase hin und her, blitzt mich schließlich durch seine getönten Gläser an. Selbst durch die dunkle Brille ist zu erkennen, dass er gerötete Augen hat wie ein lichtscheuer Albino. Was will er?
«Es ist mir klar, dass Sie Aufregendes erfahren haben, mein Junge und nun natürlich mehr wissen wollen. Ihre Recherchen waren recht anständig. Es gefällt mir, wie Sie Fragen stellen und mit Feingefühl und Druck schnell auf den Punkt kommen. Sie verfügen über Charme, das ist selten in Ihrer Branche. Emotionale Intelligenz und Einfühlungsvermögen sind in unserem Ressort durchaus brauchbar.»
Er beugt sich vor, kommt nah an mein Gesicht. Atmosphärisch ist nichts Bedrohliches zu spüren. Sein Atem riecht nach Bittermandeln.
«Es gibt in meinem Sachbereich leider nicht so viele talentierte, universelle Dilettanten. Sehen Sie das nicht als Beleidigung, keineswegs. Es ist absolut anzuerkennen, wenn jemand wachsen will.»
Worauf will er hinaus? Der Mann in Schwarz besitzt jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Er registriert, dass ich ihm zuhöre.
«Nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Art der Persönlichkeitsentwicklung, wie Sie sie betreiben, fröhliche Wissenschaft, Meditation, Therapie und gutes Essen, in zehn bis zwanzig Jahren in dieser individualistischen Form nicht mehr existieren wird. Einige Dinge werden wir in den Zeitgeist überführen, andere, die meisten, wie ich fürchte, wird der Strom der Zeit verschlucken. Sie und ich, werden dann etwas vermissen.
Die natürliche geistige Evolution gelangt dann erst einmal an ihr Ende.»
«Und dann?»
«Danach übernehmen die Maschinen. Auf der Erde herrscht eine große Vermischung, verstehen Sie. In Kürze, wenn die Mauer fällt, ich sag es Ihnen schon einmal, werden Sie sehen, was ich damit meine. Da braucht es andere Maßnahmen zur Steuerung der Wirklichkeit und Aufrechterhaltung der Ordnung.»
«Wer sind Sie?», entfährt es mir nervös. Der ist noch härter als meine UFO-Kontaktler.
Es kommt wie aus der Pistole geschossen, ich habe keine Chance: «Dazu kommen wir etwas später. Zunächst dies: Wissen Sie, was ein Algorithmus ist?»
«Nein. Sollte ich?»
Er zieht einen Mundwinkel hoch, kichert hintergründig. «Ich denke schon. Aber vielleicht ist das ja nicht so Ihr Gebiet. Kommt für Sie alles noch … vielleicht.»
Dann legt er los mit seinen Definitionen, hört sich selbst dabei an wie ein Roboter:
«Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten Einzelschritten. Somit können sie zur Ausführung in einem Computerprogramm implementiert, aber auch in menschlicher Sprache formuliert werden. Und ich sage Ihnen, verehrter Ascher, mein Wort darauf: Ich tippe etwa so gegen 2013/2014, möglicherweise schon etwas früher, ist es so weit. Es sind die Algorithmen, die die Maschinen für Menschen so gefährlich werden lassen. Sie erkennen jegliche Muster, jegliche! «
Mit einer kantigen Kopfbewegung schnuppert er an seiner Nelke am Revers. Es sieht aus, als ob er zu der Blume weiter spräche, die ich von meinem Platz aus, zwei Meter entfernt, riechen kann.
«Bis dahin haben wir alle noch ein bisserl an unserer Makellosigkeit zu arbeiten, nicht wahr, nicht? Vor allem Sie! Sie meinen es doch ernst, oder?»
«Why not?», versuche ich es altklug, weil ich sicher bin, einen US-amerikanischen Akzent herausgehört zu haben. Spiegel nickt, geht locker darüber hinweg, dass ich eine englischsprachige Herkunft erahne.
«Lassen Sie sich als Erstes sagen, was Sie benötigen. Es ermangelt Ihnen nämlich, neben Ihrer zu saloppen Kleidung, noch an etwas anderem, viel Wesentlicherem. Eventuell interessiert Sie das ja, ich möchte mich nicht aufdrängen.»
Luft holen, ruhig atmen, Klappe halten. Abnicken. Er bestätigt meine Reaktion ebenfalls mit einem Kopfnicken.
«Zunächst einmal sollten Sie abwarten können. Wie ein Jäger in seinem Hochsitz im Morgengrauen. Denken Sie immer daran, dass es so etwas wie Zeit nicht gibt. Wir kennen das einfach nicht. Schauen Sie, Ascher, Sie zum Beispiel. Dies ist ihr Leben – in einer Nussschale.»
Er beschreibt meinen längst verstorbenen Vater und mich, die kleine Wohnung am Nordrand des Ruhrgebiets in der Bergmannssiedlung, erwähnt sogar den Leberfleck auf meinem Rücken. Er schafft mich. Erschöpft sinke ich zurück in den Stuhl, stiere gedankenlos vor mich hin.
«Das Zweite ergibt sich aus dem Ersten», lächelt er und schnuppert kurz an der Nelke am Revers.
Wie? Was?
«Was für die Zeit gilt, hat, wie Sie eventuell erahnen können, immer auch für den Raum in gewisser Weise eine Bedeutung. Was ist der Raum denn mehr als eine Konstruktion, die uns die Illusion vorgaukelt, dass es voneinander getrennte Objekte gäbe? Where do you want to go today? Jemand wie Sie könnte überall etwas werden. Besonders bei Ihren Talenten, der naiven Neugier und Kommunikationsfähigkeit. Indes: Das Maß der Sichtbarkeit hängt davon ab, wie weit Sie in der Lage sind, sich unsichtbar zu machen, um von der Bildfläche zu verschwinden. Schauen Sie!»
Nun beugt er sich vor. Ich möge mich auf seine Cappuccino-Tasse konzentrieren. Nur die Schaumkrone hat er ab geschlürft, und ich sehe eine wabernde, rehbraune Melange vor mir und seine Lippenabdrücke am Tassenrand. Mit der linken Hand wedelt er kurz über die Öffnung der Tasse und der hellbraune Milchkaffee verwandelt sich plötzlich in einen reinen Kaffee schwarz! Während ich noch mit offenem Mund auf den Kaffeetopf starre, ergreift er das Milchkännchen:
«Ich mag ihn eigentlich lieber mit Sahne», und gießt sich aus dem Kännchen nach, bis der Inhalt seiner Tasse wieder die ursprüngliche rehbraune Farbe angenommen hat.
Ich fühle mich so erschöpft, möchte nur noch liegen.
«Ein Letztes, und dann lass ich Sie auch in Ruhe – für heute. Sie sollten sich mehr und besser entspannen, den Körper schonend und pfleglich behandeln, auf keinen Fall zu viel Koffein zu sich nehmen, mehr schlafen. Es geht um Sie, um Ihre Energie. Öffnen Sie Ihren Geist und passen Sie auf sich auf. Sie werden noch gebraucht, eventuell.»
Spiegel räuspert sich: «Wenn Sie mich jetzt kurz entschuldigen würden. Wir sehen uns noch. Haben Sie einen schönen Tag.»
Er steht auf, tippt sich an den Hut und verschwindet durch eine Tür in Blickweite auf der Herrentoilette. Ich sitze da, sage nichts, denke nichts, fühle nichts, starre in die Richtung der nur wenige Schritte entfernten Tür mit dem großen «H».
Eine halbe Stunde lang verharre ich reglos, bis ich selbst den Wunsch verspüre, den Waschraum aufzusuchen, um mir die Hände zu waschen.
Der Mann in Schwarz ist fort, obwohl ich genau sah, wie er den Raum durch diese Tür betrat. Die Toilette hat vergitterte Fenster. Überhaupt kennt niemand einen Herrn namens Spiegel hier.
Ich verlasse den Ort, setze mich ins Auto, drehe mir eine Zigarette. Sie schmeckt metallisch, und ich werfe sie aus dem Fenster. Das war es jetzt erst einmal. Schluss mit dem Rauchen. Mein Leben ist dabei, sich zu verändern.
Behutsamer als sonst fahre ich mit dem Auto nach Hause, dusche, falle auf dem Bett in einen tiefen, zwölf Stunden währenden, traumlosen Schlaf. Als ich glaube, ausgeschlafen genug zu sein, fühle ich mich, als ob jemand in meinem Kopf herumgeschraubt hätte. Wie auf einem Trip, an diese Selbsterfahrung aus der Hippiephase erinnere ich mich, gehe ich auf die Straße, kutschiere geistesabwesend in den Sender, spule routiniert in fünf Minuten und zehn Sekunden einen Bericht von der Konferenz ab, kehre geradewegs zurück in die Horizontale, ruhe weitere acht Stunden. Von diesem Tag an bin ich nicht mehr hypnotisierbar, denn wahrscheinlich befinde ich mich schon in einem Trancezustand, von dem ich ahne, dass ich ihn, wenn alles nach Plan läuft, nie wieder verlassen werde.