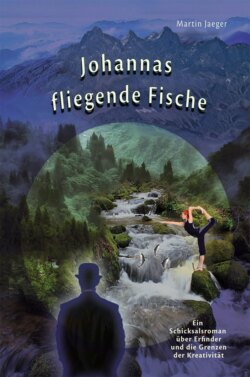Читать книгу Johannas fliegende Fische - Martin Jaeger - Страница 6
Cord
ОглавлениеEs war kurz nach 7 Uhr in der Früh, als Cord van Galten mit dem Stuhl aus seiner Portiersloge hinter das Haus in den Innenhof des Physikalischen Instituts zog, seinem angestammten Platz im Sommer.
Den Kaffeepott in der Hand hatte er sich auf seinem Lieblingsplatz eingerichtet, war aus den verschlissenen Holzschuhen geschlüpft, hatte die derben Wollsocken ausgezogen, die trockenen Füße massiert, Schwielen und Hornhaut gerieben. Wie stets hatte er mit dem linken Auge der lieblichen Morgensonne zugezwinkert, einem flirtenden Galan ähnlich, der frohlockend einem amourösen Rendezvous entgegensieht.
Anschließend träumte er abwechselnd von der guten, alten Zeit mit dem Meister und von Hanneken, seiner Tochter. Merkwürdig, dass man sich die Vergangenheit im Nachhinein immer schöner phantasiert, als sie wirklich ist, dachte er bei sich.
Mit dem Ohrensausen, einem ausgemachten Tinnitus, der ihn beim Träumen begleitete, lebte er bereits eine halbe Ewigkeit, zu lange, um das akustische Hintergrundrauschen einer besonderen Aufmerksamkeit zu würdigen. Ungeachtet dessen empfahl sich das gegenwärtige Quietschen, das ihm aus dem Hinterkopf entgegenschlug, nicht gerade als positives Omen für den heutigen Tag. Dafür hörte es sich heute zu gruselig an, mitnichten vertrauenswürdig. Normalerweise waren die Geräusche nicht von zirpenden Grillen zu unterscheiden, doch heute oktavierte sich das Konzert hinter den Schädelknochen nahezu orchestral, schwoll abwechselnd an und wieder ab wie ein Konzert laichender Frösche. Gefährlich, das. Einen Hörsturz konnte er gerade überhaupt nicht brauchen. So lange und ausführlich hatte er sich mit den quietschenden Frequenzen im Innenohr beschäftigt, dass er einen Katastrophentag intuitiv an den analogen Ohrgeräuschen erkennen konnte. Was war heute nur los? Das Grübeln hinderte ihn jedoch keineswegs am Träumen.
Zu diesem Zweck konzentrierte er sich einfach nur auf seine persönlichen Krafttiere.
Van Galten visualisierte auf seine entortete, entrückte Weise springende Forellen. Jeden Morgen fantasierte er sich über das Grün der Sträucher direkt in die Sonne hinein, bewegte die Erinnerung an den alten Mühlbach, erinnerte er sich, wie die Fische immer wieder ihr vertrautes Element verließen, um sich schwerelos in die Luft zu schrauben, als suchten sie einen Raum, der nicht zu ihnen gehörte und doch Ziel all ihres Strebens war.
Das Wissen um den Ursprung des Phänomens hatte ihm in jungen Jahren einen wohlverdienten Höhepunkt mit dem Meister beschert. Wenigstens war es gelungen, ein paar von den verbotenen Ideen zu rekonstruieren.
Der Forstrat, der Wasserprofessor: Wo wären die Naturforscher heute ohne ihn, ohne seine Entdeckungen? Viktor Schauberger war es, der der Welt unzweideutig klarmachte – mein Gott, das war jetzt auch bald ein Jahrhundert her – dass eine jegliche, dem Menschen dienliche Erfindung dem Naturreich abzuschauen sei! Gesundheit, Wohlstand, das Gedeihen eines Landes würde sich rechtschaffen nur dort einstellen, wo man verstand, wie Wald, Fluss und Wiese ihre Ordnungsprinzipien realisierten – und genau das dann kopierte. Schauberger selbst war zeit seines Lebens gegen den Strom geschwommen, hatte Techniken und Maschinen entwickelt, die im Einklang mit eben diesen Naturgesetzen standen. Wie transportiert die Natur? Wie reinigt sie Wasser, wie macht sie es lebendig? Und vor allem: Wie generiert sie ihre Energie? Welche Aufgabe spielen Sonne, Mond und Sterne?
Niemals ging es ihm darum, die ewigen Gesetze des Äthers, allemal schöpferisch kreativer Naturraum, zu verbiegen, schon gar nicht, wenn man sie so schlau zu handhaben vermochte, wie er es verstand.
Die Eigenarten der Natur verstehen, den Kreislauf des Wassers und des Jahres klug nutzen – es hätte so einfach, so gut sein können.
Die Regel bedeutete jedoch: immer wenn es im großen Stil schöpferisch wurde, kurz vor einem größeren Verständnis, da kamen die Kriege.
Van Galtens Gedanken flogen hoch in die Bibliothek zu Bulgakov, seinem jetzigen Vorgesetzten, der ihn so dringend benötigte. Ein weiterer Schützling, eine Generation später.
Von der Raumenergie, über die der Chef andauernd sprach, verstand er als Handwerker nicht allzu viel, mehr von den Materialien, mit deren Hilfe man sie erzeugte. Aber er schätzte den Institutsleiter für seine unkonventionellen Methoden, selbst wenn nicht immer klar war, worüber der Leiter des Instituts gerade grübelte. Der Mann besaß hohe Ideale, hatte Mut, war obendrein beliebt bei der lokalen Bevölkerung in Graz. Und vor allen Dingen glaubte er an das Gleiche wie er: dass ein Wandel in eine bessere, heilsamere Epoche der Energiewirtschaft machbar sei: ohne Atom, ohne Kohle, ohne Verbrennung von irgendwas. Ja, vielleicht.
Für die neue Unternehmung war Bulgakov an einer Art Anti-Gravitations-Maschine gelegen. Er meinte, die Schwerkraft, das sei auch nur so eine mathematische Idee, die es zu überwinden gälte. Nun gut, das Lieblingsprojekt van Galtens war das definitiv nicht, aber immerhin, der Junge war auf dem Weg.
Cord würde auch diese Eskapade geduldig an seiner Seite als stiller Assistent mit ihm aussitzen, ausharren mit der ihm eigenen Demut.
Das halbe Leben wartete er schon. Niemals war klar, ob sich die Warterei lohnte. Allezeit stand er als Universalhandwerker bereit, durfte nur auf Anfrage nach Bedarf agieren. Zwischendurch geschah mal etwas, von dem man dachte, das wäre es, doch wer wusste schon, ob das Getane die Wartezeit tatsächlich verkürzte oder nur erneute Komplikationen bescherte.
Die Entwicklungen des leitenden Physikers oben im dritten Stock ähnelten dem Wirken eines Uhrmachers, der stets noch ein neues Rädchen einzubauen hatte, um Funktionalität und Zufriedenheit über sein Uhrwerk zu bewirken. Nie war ein Projekt ganz fertig. Trotzdem war der Akademiker eine pure Wohltat für das Institut und die Öffentlichkeit, verbreitete er doch grundsätzlich Hoffnung auf eine bessere Zukunft: die Realität kostenloser Energie für alle.
So war es wohl: Cord van Galten fungierte als Türsteher und Portier eines kommenden Zeitalters, beharrlich darauf wartend, den Raum für den Rest der Welt öffnen zu können.
Für ihn ging es immer nur um die Sache. Darum hatte er sich nach dem Exil in Holland bereit erklärt, nach Graz zurückzukehren, um diskret als Pförtner und Hausmeister tätig zu werden. Dekan Meyerhof war als Leiter der Universität der Einzige, der seine wahre Geschichte kannte .
Ich bin ein Untercover-Portier, schmunzelt er in sich hinein, nimmt einen großen Schluck aus dem Kaffeebecher.
Es bereitete Befriedigung, Fakten zu schaffen, Maschinen und Prototypen nach den Skizzen der Dozenten zusammen zu bauen, selbst wenn dies nicht sein offizieller Job war. Schließlich erwies sich der Intellekt der Akademie erst durch die Mitarbeit tatkräftigen Handwerks als effizient. «Herz, Hirn, Hand», so lautete das Motto von Cord van Galten. Anders hatte der Herrgott die Welt auch nicht erschaffen, dessen war er sicher.
Genüsslich zieht er den süßlichen Duft der Jasminblüten in sich hinein, öffnet die Augen, betrachtet seine zerfurchten Handwerkerhände, knorrige, elastische Äste, die sich den wärmenden Strahlen der Sonne darbieten, als könne das Licht Falten in Jugend verwandeln.
Das beste Werkstück war die alternative Antriebstechnologie, die er mit dem Meister nachgebildet hatte, die geliebte Repulsine. Die meisten Leute unterschätzten sowohl die Bescheidenheit als auch das Gedächtnis des Forstrats. Es war die Zeit nach dem Krieg, als Schauberger mit seinem Sohn in Bad Ischl die Pythagoras-Kepler-Schule eröffnete und sich daran machte, die Wirbelphysik, die er den Bewegungen des Wassers abgeschaut hatte, auf eherne, vor allem theoretische Füße zu stellen. Bezüglich der Erklärungen waren sie im Prinzip damals mit dem Mathematiker Pythagoras und dem Astronomen Kepler gut bedient.
Heuer wäre das wahrscheinlich nicht mehr ganz so leicht zu stemmen. Van Galten gluckst still in sich hinein. Seine Landleute verdrängten lieber, dass Viktor Schauberger der Größte war, den das Land jemals hervorbrachte. Wasser ist Leben. Vielleicht hielten sie auch nur den Ball flach. Klüger war es ja.
Huuuuuiiiiii pfiff sie, danach sauste das geschweißte Stück Metall, die Repulsine, turboschnell durch das Dach der Werkstatt; wie beim ersten Mal in den 30er Jahren, als sie begannen, die neuen Antriebe zu entwickeln. Schnitzer und Fehlleistungen hatte Maestro Schauberger mit Absicht nachgebaut, um zu erforschen, was genau dabei geschah. Auf dem Weg zur Perfektion zog er aus Fehlern häufig mehr Erkenntnis als aus dem Gelingen. Kein Wunder, dass die Alliierten das Artefakt nach dem Krieg unbedingt mitnehmen mussten, obwohl es zum Fliegen nicht wirklich taugte. Da gab es wohl Effektiveres, anderswo. Und als Schauberger nach der Rückkehr aus Texas so unerwartet verstarb, war es gut, dass er in den Niederlanden für anderthalb Jahrzehnte untertauchen konnte. Das war notwendig und überhaupt nicht fair. Wie schnell hätte auch ihm etwas zustoßen können.
Holland tat ihm gut. Es war auch richtig, nach der Hochzeit mit Mareike ihren Familiennamen anzunehmen, um die Spuren der Vergangenheit zu verwischen. Weil es besser so war. Damit er in Ruhe wirken und an Stellen helfen konnte, wo die meisten Entwickler scheiterten. Helfen, darum ging es doch.
Van Galten schaut hoch in den dritten Stock. Auch Bulgakov droben in der Bibliothek steht nun kurz vor einem Durchbruch. Er wird ihn unterstützen, so lang es geht.
Hausmeister und Universalhandwerker, welch schicke Untertreibung. Ja, er kocht Kaffee, wechselt Sicherungen, kommt in der Früh, verlässt als letzter die Werkstätten. Nur wenn er mit den Doktoren, Ingenieuren und Erfindern allein ist, lassen sie kurzfristig ihre Masken fallen und die Arbeit an einer neuen Physik darf beginnen. Niemals existieren Probleme, immer nur Situationen, die es zu wandeln gilt. Die größten Schwierigkeiten erfasst er beim Betreten der Laboratorien mit einem Blick. Natur und Effizienz eines wissenschaftlichen Versuchsaufbaus kann man riechen, ja was denn sonst? Zu lange hat er sich mit der Schwerkraft und ihrer technischen Überwindung beschäftigt, als dass er auftretende Komplikationen nicht auf Anhieb durchschaut. Selbst dort, wo er eine elektrische Schaltung kaum zu lesen vermag, erkennt er Lösungen intuitiv, aus dem Bauch heraus. Häufig genug liegt er richtig.
Löten, drehen, fräsen, schleifen, polieren: meistens erledigt er handwerkliche Aufgaben nach Dienstschluss, zwischen 20 Uhr und Mitternacht. Dann legen die Studenten und Dozenten ohne Ehrgeiz die Hände in den Schoß. Trotzdem sitzt er morgens als Erster in seinem Verschlag, den privaten acht Quadratmetern, lächelt verbindlich aus dem Portierskabäuschen heraus, wenn die Studenten zu den Vorlesungen an den Universitätsplatz eilen. Nicht wenige, die ihn völlig übersehen, weil es so aussieht, als ob er die Tage bestenfalls dösend oder träumend verbrächte, auf dass es Abend wird und er endlich fortführen kann, was er einmal angefangen hat.
Ein tiefes Seufzen entweicht ihm und mit blinzelnden Augen starrt er in den Morgenhimmel. Wie ein Dieb in der Nacht läuft er durch das Leben, in dem er nicht einmal der eigenen Familie über seine heimlichen Tätigkeiten Auskunft geben darf. Auf keinen Fall schlafende Hunde wecken. Oder schlimmere. Doch was heißt hier Familie?
Cord fummelt an seinen roten Bartflusen.
Mit der Tochter hat er es verrissen. Immer wieder packt ihn die Melancholie, wenn er in seinem Hausmeisterverschlag hockt und an den Streit mit dem Hannerl denkt. Dem eigen Fleisch und Blut. Seit vier Wochen zählt er die Tage. Dergleichen hat schon härtere Kaliber als ihn in die Depression gestürzt. Genau hierin offenbart sich die melancholische Mentalität seiner Heimat? Und er dachte noch, er käme drum herum.
Irgendetwas wird geschehen. Er fühlt es im Bauch, er hört es im Kopf. Was könnte es dieses Mal sein? Kann doch nicht schon wieder ein Krieg ausbrechen, wie 1939, als der Forstrat kurz vor der technischen Revolution mit natürlichen Mitteln stand.
In zwei Wochen wird Bulgakov einen Antigravitations-Generator präsentieren – und dann soll es gut gewesen sein. Toi, toi, toi. Die Sehnsucht nach Beschaulichkeit wird jeden Tag größer. Soll ja wohl in Ordnung gehen, mit 73 Lenzen auf dem Rücken.
Über den Sonnenstrahlen, die durch das sommerliche Blattwerk fallen, bilden sich regenbogenfarbene Prismen im Morgentau auf dem Blattwerk der Bäume. In ihnen lässt er schwungvoll Johanna tanzen. Immer häufiger tanzt er mit ihr, denn nichts ist so groß wie der Wunsch, sie endlich wieder in seine Arme zu schließen. Weil er sie verloren hat, sie gehen ließ, er sein dummes Schandmaul nicht halten konnte.
Wie in Stein gemeißelt kauert die ungeklärte Situation in einer Ecke seiner Brust und er möchte, dass die morgendliche Wärme sie auflöst, geradewegs ungeschehen macht.
«Ich hab sie getragen sieben Jahr», murmelt er niedergedrückt in die Birke des Lichthofs hinein, blinzelt dabei mit halb geschlossenen Augen durch das Astwerk.
Sie verließ ihn, gleich nach der Maturafeier, am letzten Schultag, nachdem sie ihm mit einem triumphierenden Blick ihr brillantes Zeugnis überreicht hatte.
Gerade kam sie vom Laufen, zwei Stunden nach der Abschlussfeier in der Schule. Wie sie halt ist, hatte sie es sich nicht nehmen lassen, auch nach einem solch einmaligen Ereignis mit dem Rad in den Wald zu fahren, um sich 25 Kilometer lang laufend auszutoben. Soeben ein Ziel erreicht und schon das neue im Visier. Ein Marathonlauf sollte es werden, sagte sie und trainierte, wann immer sie Zeit dafür aufbringen konnte.
Zur Feier des Tages hatte er einen Obstsalat gemacht. Mit noch nassem Kopf vom Duschen setzte sie sich zu ihm an den Mittagstisch. Die roten Haare streng nach hinten gekämmt, traten ihre Sommersprossen heftig hervor, Pigmente wie bei ihm früher und der Mutter. Ihre Augenfarbe changierte immer, wenn sie sich aufregte, von Blau nach Grün. Vererbt von der Großmutter. Sie wirkte aufgeregt – grün, das hieß: voller Tatkraft, Unternehmungslust und Selbstbewusstsein. Schön eigentlich.
Nur ein wenig hatte er sie hochgenommen, gesagt, dass sie ein Typ sei, der die empfindliche Haut auch im Winter behielte. Wie meistens in Momenten der Betroffenheit zog sie die hohe Stirn in Falten, tat gereizt, schien aber ihr Schicksal zu akzeptieren. Eine Ermutigung würde ihr guttun, hatte er noch gedacht, sie gelobt für ihren Fleiß und die Ausdauer. Dann sprach sie davon, dass sie Umwelttechnik in Wien studieren wollte.
«In dem polytechnischen Kurs ging es zuletzt um die optimale Verbindung von Physik und Umweltwissenschaften. Unter anderem haben wir über die Reinigung von Trinkwasser gesprochen, wenn man keine technischen Möglichkeiten besitzt, wie zum Beispiel in Afrika. Wir sprachen darüber, wie man Wasser reinigen kann, wenn es keine finanziellen Mittel gibt. Wir haben Brackwasser aus der Pfütze in eine Plastikflasche gefüllt und in die Sonne gelegt. Der Dreck hat sich abgesetzt. Das Wasser oben war absolut trinkbar. Papa, ich werde Umwelttechnik studieren. Brunnen bauen, Ressourcen erschließen. »
Mit nur anderthalb Sätzen hatte er es verdorben:
«Da solltest du einmal bei uns im Keller des Instituts schauen. Forstrat Schauberger hat in dieser Hinsicht bereits vor über hundert Jahren Erstaunliches zuwege ge…!» Jählings schlug er sich die Hand vor den Mund.
Euphorisiert blickte sie ihn an. «Was? Bei dir in der Firma? Aber gerne! Interessiert mich. Ich bin ja so neugierig. Was ist? Was hast du da? Was gibt es da bei Euch im Keller?»
Sie war Feuer und Flamme. Und er saß da mit einem roten Kopf, traute sich nicht weiter zu sprechen, lebte das Dilemma seines Lebens vor dem eigen Fleisch und Blut.
«Passt net. Mir fällt gerade ein, dass ich dir die Kellerräume und das Lager überhaupt nicht zeigen darf. Entschuldige bittschön, leider verhält sich das so. Weißt du, der Zugang ist nur Geheimnisträgern und für Eingeweihte gestattet. Schweigepflicht halt. Tut mir wirklich leid, mein Engel.»
Sie nahm ihm das Zeugnis aus der Hand, das er gerade noch studieren wollte und schmiss es achtlos neben den Obstsalat. So wütend hatte er sie noch nicht gesehen. «Was meinst du mit Geheimnisträger? Wie soll ich das verstehen? Rede bitte vernünftig mit mir!»
«I derfs halt net, mein Engel.»
Da geschah es. Auf einmal wechselte sie ihre Augenfarbe. Blau.
«Engel. Engel. Engel hin, Engel her!»
Mit einem scharfem Knarren schob sie den Stuhl vom Küchentisch, erhob sich, stampfte mit dem Fuß auf, schmiss die Serviette auf den halbvollen Teller, verzog sich in die hinterste Ecke der Küche, stand schwer atmend dort mit verschränkten die Arme und fixierte ihn: «Was darf dein Engel nicht? Und vor allem, warum nicht? Ich bin doch deine Tochter?»
«Ich habe es unterschrieben, ich wollt, es wäre nicht so! Die Schweigepflicht gilt vor allem auch für Familienmitglieder. Es tut mir leid.»
Da ging sie auf ihn zu, ganz langsam. Sie war wieder sehr ruhig und beherrscht, so sehr, dass ihm eine Gänsehaut über den Rücken lief. Dann schaute sie ihm mitten zwischen die Augen.
«Cord!»
Immer wenn sie ihn mit dem Vornamen ansprach, wusste er, dass die väterliche Autorität verspielt war.
«Ich hab immer gedacht, wir könnten über alles reden. Jetzt sehe ich, dass wir uns über nichts austauschen können, was mir wirklich etwas bedeutet. Über gar nichts. Da kann ich genauso gut gehen. Wollte dir schon längst sagen, dass ich vorhabe, zur Tante nach Wien zu ziehen, um dort zu studieren. Wo ich nun seh, dass du so viele Geheimnisse vor mir hast, mag ich am liebsten sofort gehen. Es ist an der Zeit für einen Tapetenwechsel. I mag nimmer. S‘langt mir.» Sie warf ihm den finstersten Blick seines Lebens zu, bevor sie die Tür knallend in ihrem Zimmer verschwand. Eine halbe Stunde später ein kurzes Abschiedswort – «Ade, Papa», die Haustür klappte und dann war sie fort.
Das war es dann wohl mit der Wohngemeinschaft.
Seit zwei Wochen wohnt sie bei der Tante in Wien. Wenigstens ist sie noch in der Nähe. Zum Geburtstag und zu Weihnachten würden Ansichtskarten eintrudeln – wenn er Glück hat. Sie interessiert sich für Afrika. Das ist sehr weit weg. Wie eine Drohung.
Vor seinem inneren Auge tanzt sie in der Sonne, nach Wüste und Wind duftend, bis sie einen Sonnenstrahl ergreift und auf ihm reitend zwischen dem üppigen Blattwerk des Jasmins entschwindet.
«Und wenn Zeit in Wirklichkeit nicht existiert?», brummelt er halblaut vor sich hin, schielt dabei auf seine verhornten, verbogenen Fußnägel, will sich gut zureden.
«Wenn sie morgen kommt, werde ich sie in die Arme schließen, als wäre nichts geschehen. Als wäre nichts geschehen. Oh, Hanneken, ob du mir wohl wirst verzeihen können?», seufzt er vor sich hin, zupft immer wieder an seinem roten Rauschebart, reißt sich vereinzelte graue Haare aus.
Ein Schatten legt sich auf sein Gesicht. Er wird sich zukünftig auf ein Leben ohne sie einstellen müssen. Erst nach der Präsentation von Bulgakov kann er wieder auf sie zugehen, einen neuen Annäherungsversuch versuchen. Vielleicht gibt es ja noch eine Chance. Wenigstens vertragen könnte man sich.
Es klingelt an der Eingangstür.
Wer mag das sein, in aller Herrgottsfrüh? Er ist täglich ab 6.30 Uhr anwesend, behördlicherseits öffnet das Institut erst um acht. Jetzt ist es 7.50 Uhr. Außer dem Professor und der Putzkraft in den Hörsälen hält sich niemand im Haus auf.
Van Galten steckt die nackten Füße zurück in die Wollsocken, die Holzschuhe, schlurft zur Tür.
Ein unscheinbarer, blasser Mann in einem schwarzen Anzug mit Sonnenbrille und Hut baut sich da vor ihm auf. Sieht offiziell aus. Aber so früh? Hoffentlich nicht wieder so ein Journalist oder Wirtschaftsvertreter wie vor sechs Wochen. Der elegante Herr nickt ihm zu:
«Bitte sagen Sie mir, wo finde ich den Institutsleiter, Professor Bulgakov, ich habe einen Termin.»
«Um diese Uhrzeit hält sich der Professor normalerweise in der Bibliothek auf. Derf i Sie anmelden?»
«Danke nein, ich kenne mich aus.»
«Fahrstuhl dritter Stock, bittesehr. Die Bücherei befindet sich gleich am Ausgang des Lifts.»
Van Galten zeigt mit dem Finger auf den Aufzug. Der für die Jahreszeit zu förmlich gekleidete Mann mit dem ausdruckslosen Antlitz schiebt sich an ihm vorbei. Selten hat er ein derart flaches Gesicht erblickt. Der Hut kommt ihm von irgendo bekannt vor. Liegt es daran, dass die Geschäftsleute heuer alle gleich aussehen? Hat er den Typen schon einmal gesehen?
Van Galten schlurft zurück in seine Portiersloge. Eine Anwandlung schläfriger Unruhe hat ihn erfasst. Warum hat er nicht nach dem Ausweis des Mannes gefragt, wie sonst auch bei fremden Gästen?
Einen Atemzug lang schließt er die Augen, versucht, sich zu erinnern, woher er diesen Druck auf der Brust kennt, dieses nicht ortbare Schwindelgefühl, seitdem der merkwürdige Besucher das Institut betreten hat. Außerdem ist da noch das immer intensiver werdende Sausen in seinem Kopf.
Für einen Augenblick setzt van Galtens Geist aus; er fällt in eine Morgentrance, die gar nicht unangenehm ist, der er aber dennoch misstraut, wie ein nachtwandelndes, mondsüchtiges Gefühl in der Früh, das er so von sich gar nicht kennt. Wie ein Nachtwächter kommt er sich vor, der sich ein Nickerchen gönnt, obwohl er weiß, dass er nicht einschlafen darf. Du – sollst – nicht – schlafen! Nur nicht wegdämmern! Wie eigenartig: Im Vergleich zu anderen verdösten Momenten am Morgen ist das innere Auge heuer so leer, dass keines der bekannten Traumbilder aus der Vergangenheit sich zu ihm gesellen will. Woher rührt dieses plötzliche Vakuum?
Aus seiner Geistesabwesenheit weckt ihn ein unterdrückter, gurgelnder Laut, gefolgt von einem stumpfen Klatschen vor dem Gebäude.
Was war das? Van Galten rührt sich nicht, kann sich nicht bewegen, verschmilzt mit dem Grau der Portiersloge wie ein Chamäleon. Wie zur Salzsäule erstarrt, sieht er wenig später aus den Augenwinkeln heraus den Schatten des Burschen in Schwarz an ihm vorbeihuschen, dem Seitenausgang entgegen und hinaus.
Erst als der Mann das Haus verlassen hat, erhebt er sich, jagt, so schnell wie es Holzschuhe und Wendigkeit gestatten, zum Haupteingang, schließt das Portal von innen auf. Nein, nicht so. Bitte nicht!
Da liegt Bulgakov in verzerrter Pose vor ihm auf dem Asphalt, gleich neben seinem Fahrrad. Van Galten schaut hoch, macht das offene Fenster der Bibliothek aus, die Feuertreppe, schaut wieder hinunter auf den Chef, der ihn so sprach- wie bewegungslos aus weit aufgerissenen Augen anstarrt. Er sieht eigentümlich aus, leuchtet merkwürdig aus der Mitte heraus. So etwas hat man noch nicht gesehen, nein, das kennt er nicht. Den Chef jetzt lieber nicht anfassen. Aber er lebt noch. «Halten’S aus, Herr Professor, warten’S, i hol Hilfe!»
So schnell wie es geht rennt er in die Portiersloge, ergreift den Telefonhörer, verständigt die Notfallambulanz. Dann läuft er zurück, beugt sich zu dem halb an-, halb abwesenden Mann herunter, der immer noch mit starren Augen durch ihn hindurch blickt, die Pupillen hin und her bewegt, als wolle er den Kopf schütteln, ihm etwas mitteilen.
«Nicht bewegen, Professor, nicht bewegen, denken’S an ihr Rückgrat, glei kommt die Rettung, i hab telefoniert.»
Er wagt nicht, den Kopf des Verletzten in die Hände zu nehmen, ihn überhaupt nur zu berühren. Bestimmt ist die Wirbelsäule gebrochen. Er sieht es genau, kann es nicht, will es nicht fassen: Hier stirbt gerade sein zweiter Chef eines unnatürlichen Todes, gute vierzig Jahre nach dem Ersten. Ein Weiterer, dem er helfen wollte, die Physik zu revolutionieren.
Noch während er auf den sterbenden Institutsleiter blickt, dessen hin und her zuckende Augen ihm sprachlos eine Nachricht mitteilen möchten, wird ihm von einem Moment zum anderen auch sein eigenes Scheitern bewusst. Augenblicklich ist auch ihm nach sterben zumute. Immer müssen die Falschen gehen.
Da kommt die Ambulanz. Leise und ohne Blaulicht. Warum nicht? Ist es zu früh für den Lärm? Zwei Sanitäter schieben den Professor auf einer Bahre in den Wagen, sagen, sie haben die Polizei verständigt. Und ob er etwas gesehen habe. Nein, hat er nicht, auf gar keinen Fall.
Van Galten und sein Chef schenken sich einen letzten, ernsten Blick. Stumm winkt Cord dem sich schnell entfernenden Rettungswagen ein «Adieu» hinterher. Er ist sich gewiss: Das war es.
In Holzschuhen und dem schäbigen Hausmeisterkittel schlurft er 300 Meter bis zu seiner Wohnung, schließt auf, setzt sich in der Küche an den Tisch, weint tonlos und mit offenen Augen. Tränen wandern die langen rötlich-grauen Barthaare hinunter, versickern in dem roten Bart, bis sie auf den schwarz-weiß gekachelten Küchenboden fallen.
Mit tränenverhangenem Blick schaut van Galten auf den Küchenschrank, wo ein Foto von der noch jungen Johanna am Schrank klebt. Der verblichene Fotoabzug symbolisiert alles, was geblieben ist von dem, was sich einmal eine Familie nannte. Sie ist noch so zart auf dem Bild und macht Übungen bei den Fischen. Laut spricht er zu dem verwaschenen Bild:
«Johanna, du liebe, meine Arbeit am Institut ist beendet, ich kann und ich will nicht mehr. Ich habe Angst, muss ich dir gestehen. Ich fürchte, ich werde ganz schnell die Stadt verlassen. Du sollst bei mir und auch hier im Haus immer einen Platz haben, mein Engel.» Vielleicht wird sie ihn verstehen. Aber er darf nicht mehr sagen. Niemandem. Immer noch nicht.
Mit sturem Blick starrt Cord auf die Tischdecke und die Brotkrumen, die vom Frühstück geblieben sind. «Zwei Stunden später und schon hat sich die Welt verändert», flüstert er den Krümeln zu, bevor er sie vom Tisch fegt. Von einem Haken an der Wand ergreift er Mareikes Schürze, die seit einem Vierteljahrhundert dort hängt, schnaubt mehrfach in sie hinein, putzt sich gründlich die Nase.
Dann wendet er sich ab, zuckt mit den Schultern, zieht eine abgewetzte, lederne Reisetasche aus dem Schrank, fährt sich nervös mit den Fingernägeln durch den zerzausten, tränenfeuchten Bart. Ein letztes Mal spricht er das Bild an:
«Ich muss dringend zum Friseur. Ich fahre in zwei Tagen. Wohin, wird sich weisen! Du wirst es erfahren, irgendwann.»
Nur ist sicher: Die Grazer Universität wird er nie wieder betreten.