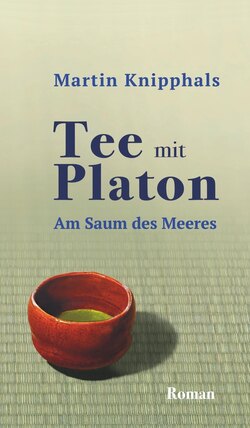Читать книгу Tee mit Platon - Martin Knipphals - Страница 14
Оглавление5 Usucha
Bild und Blume in der Bildnische wurden erneut gewechselt. Und erneut wird das Eingangsthema zurückhaltend aufgegriffen. Fast zaghaft und eher nur erahnbar vermengt sich „Geschautes“ mit Erlebtem, ein Gestern nicht interessierend und ein Morgen nicht bedenkend. Den Klang des Tees in sich tragend verlieren nämlich all die Hamsterrad-Aktionen, wir Heutigen nennen das Karriere machen, ihren Reiz.
Abb.: Nin - Kobori Shotsu, 20.Jhd.
In der Tokonoma hängt das Schriftzeichen: `Nin`, die Geduld. Mit leichter Hand, fließend gemalt, dem Frosch von Sengai ähnlich. Ist Geduldig-Sein wie ein Frosch eine gute Lebenseinstellung? Ermöglicht diese Haltung Gärten, wie den soeben erlebten, zu erschaffen? Und Räume wie diesen? Und Tee zu machen, der den Menschen zu berühren vermag, da er nicht nur irgendein Getränk ist? geht es Platon durch den Kopf. Und eben diese darin verborgene Haltung läßt offenbar auch die Blume finden, als Fortführung des im Bild Begonnenen; unaufdringlich und doch gegenwärtig; verhalten und dennoch den Betrachter einstimmend; motivierend und auf das Koan von Buddha hinweisend. Als sei eben dieses Nachsinnen - ohne Denken!, meint Tokuzen hier spontan einwerfende - das Natürlichste von der Welt.
Hakuin lächelt, sich vorbeugend, wie ein stummes Bejahen, dem sich alle anschließen.
Unter dem Bild steht, zum Erstaunen von Platon, ein Stück Kiefernstamm mit Rinde, teilweise ausgehöhlt, der nun als Behältnis für eine Blume dient. Wartend, bis der Betrachter beim Anschauen die Blume durchschaut und sich selbst? Ein Dasein wie eine Blume? Mitten im Alltag? Mit Geduld? Unspektakulär, aber gerade dadurch nachhaltig.
Erneut auf dem Sitzplatz scheint ihm jetzt sogar der Klang des Kessels verändert. Sonderbar. Selbst der Raum scheint größer und die Stille hierin klingt berührend, durchwoben vom Duft des Sandelholzes, in den hinein die Schiebetür geöffnet wird.
Auch diesmal werden alle Chadogu (Teeweg Geeignetes, welches nur von Meistern wahrzunehmen ist) in den Raum getragen. Dem Ein- und Ausatmen bei der Faltung des Fukusa (indigo-farbenes Seidentuch) folgt eine Entsprechung beim Reinigen der Dose. Doch wer reinigt hier was und wovon? fragt sich Platon. Vom Anhaften an Meinungen und Labordaten? Von wirren Ansichten mit der Erdscheibe und Met trinkenden Göttern im Orbit, die als Schwan oder Känguru die Mädels beglücken? Er lächelt, Sie auch?
Unsere Vorfahren müssen offenbar durchaus Sinn für Humor gehabt haben, so wird einem klar. Nur humorlose Einfallspinsel hatten damals offenbar diese netten Lagerfeuergeschichten nach Met und Hanf tatsächlich für wahr gehalten und sich wie Ertrinkende daran geklammert, vollkommmen übersehend, dass sie all die Zeit hierbei auf festen Boden hocken. Und zwar auf dem Boden der eigenen Denkhöhle. Alle Teegäste schmunzeln.
Hilft es sich vom Anhaften an die üblichen Sichtweisen eines ICH zu befreien, wenn man das Äußere der Lackdose mit diesem Tuch der Unabdingbaren Unausweichlichkeit reinigt? Selbst im betrachtenden Mitvollzug durch den Gast? Wie ein sanftes Break-down-the-Wall a la Pink Floyd, auf dass wir uns näher kommen, da wir die von uns selbst vorgenommene, duale Willkür-Trennung in allem zu überwinden vermögen?
Pflegen wir bei dieser Tätigkeit die Nicht-Zweiheit, kommt dies allem zugute, geht es Platon durch den Kopf. Worüber er staunt, denn erneut war hierbei mal wieder sein Kopf aktiv. Sagt ihm sein Kern. Das erneute Falten des Tuches und das anschließende „Entstauben“ des Teelöffels aus Bambus lädt offenbar ebenfalls zum Loslassen ein.
Und im Hinwegheben der Seide setzt sich die Spur ins Nichts, wie Hisamatsu sagen würde, ins Ungeborene fort, …
(Was jeder selber ergründen mag, meint der Autor.)
Dieser kleine, unscheinbare Span ermöglicht wohldosiert das zeitlose Grün von Mutter Natur (den Tee) in die irdene Schale aus Menschenhand gleiten zu lassen. Achtsam, mit ganzer Hingabe, ohne Zögern, ohne Zweifel, ohne ICH-Beimengung.
Nachdem beim Koicha zuvor Yokan gereicht worden war, stellt der Gastgeber nun Senbei (Kekse) mit leicht süßlich-zimtener Note auf einem Stück Treibholz skandinavischer Herkunft vor die Gäste auf die Tatami und verbeugt sich.
Ist dieses Stück Treibholz erneut ein stiller Hinweis auf überflüssige `Schwimmringe`, sprich Ideologien?
Wer schwimmen kann, benötigt bekanntlich keine Bootsplanke mehr, wie Bodhidharma damals allen vorlebte, als er einen Fluß ohne Fährmann überquerte. Auf einem schlichten Schilfblatt. Und so dient nun dieses Bootsfragment fortan als Gefährt für Gaumenfreuden. Auch als dezenter Hinweis auf jene Begebenheit mit Bodhidharma (jap. Daruma)?
In den Geschmack der Senbei hinein gleitet unmittelbar darauf jener des Matcha. Aus einer unscheinbaren Schale von beträchtlichem Alter, die in beiden Händen ruht.
Der alte Grieche fragt sich: Vermag das recht temperierte Wasser sich mit dem Teepulver zu wandeln und im Takt des Besens ein Melange des Unvorstellbaren zu werden?
Kann man dieses noch Tee nennen? Obwohl beides im jeweils anderen vollkommen vorhanden ist und seine Eigenschaft nicht verliert? Etwas Drittes? Neues? Da es nicht nur x Teile Teepulver und y Teile Wasser sind.
Wer will das wissen?, fragt Kanno in diese Gedanken hinein. Würde eine Antwort den Geschmack erhöhen oder verbessern oder gar erst möglich machen?
Abb.: Chawan v. OHI Chozaemon IX., Kanazawa, 1975
Was den Denker Platon in weiteres Grübeln bringt, ohne sich diesem als ein Entfernen von direkt vor ihm Liegenden bewußt zu sein. Noch. Da ist kein Stimme in ihm, die sagt: Hallo, alter Freund, dein Nachsinnen hilft dir nicht. Trink lieber den Tee und bleibe ganz bei diesem Vorgang! Laß all das Grübeln.
Was Platon jedoch nicht hört. Noch nicht, denkt Kanno hoffnungsvoll. Sein Erkennen der Höhlensituation ist zwar ein guter, erster Schritt, aber eben auch nur ein gedachter Schritt, ohne Bezug zum Realen. Statt nur zu trinken, läßt er sich von Gedanken an das Trinken ablenken.
Die `Verrückte Wolke`, so der Name des Chawan, weist auf Ikkyu hin, der sich einst diesen Namen selber gab. Er hatte um 1460/70 diese Zen-Tee-Zubereitung angeregt und bekommt nun als erster Tee. Mit feinstem Schaum dank langer Übung aus versierter Hand.
Damals hatte er inmitten von Clankriegen und Hungersnöten, Orientierungslosigkeit und großer Verzweiflung den „Neuen“ Tee für alle aus der Taufe gehoben. Wie einen alles durchdringenden Akt, der (fast) alle einte und friedvoll auf neue Horizonte zugehen ließ. Und bald gab es den Tee auch außerhalb der Teeräume von jenen, die sich bis dahin die teuren Utensilien (aus China) leisten konnten.
Heute, über ein halbes Jahrtausend nach Ikkyu und dreihundert-fünfunddreißig Jahre nach Bach, machen dies längst Menschen in allen Ländern der Erde. Wie ein Taichi im Sitzen oder Zazen in der alltäglichen Arbeit. Was gerade in den Modernen Zeiten als Ausgleich allen gute Dienste zu leisten vermag.
Sofern man hieraus kein fades Ritual macht, denkt Dogen, sonst verkommt alles zu einer folkoristischen Kunstform mit wohlklingenden und bezahlten Titeln in edler Kleidung. In diesem Fall versucht man leider narrenhaft noch immer den Mond von der Oberfläche des Teiches zu fischen.
Oder die Schatten auf der Höhlenwand zu interpretieren, ergänzt Platon in Gedanken.
Ebensogut könnte man die Noten von Mozart`s Zauberflöte wiegen und wüßte dann, wie das mit der Musik im allgemeinen ist, meint Kanno grinsend.
Oder man nimmt schwarz-weiß Fotos von japanischen Häusern und gründet dann tolldreist einfach eine Akademie für Architektur in Weimar, meint Peter. Und schon hat man ein gebautes Haus, ein sogenanntes Bauhaus. Alle schmunzeln nachsichtig ob dieser Wirrnis. Schließlich kennen die Meister die zahlreichen Ego-Aktionen verwirrter Wesen in ihren engen Denkhöhlen zur Genüge. Was eventuell ursprünglich nur als Gag gedacht war, nächstens, bei Bier am Lagerfeuer, mutierte zur unsäglichen Plattenbauweise mit dem Zukunftsslogan (in Normalsprache nennt man das einfach nur Gelaber): Dat is die Zukunft! Eckig, öde Bauhaus! Natürlich in passendem 08-15 Grau.