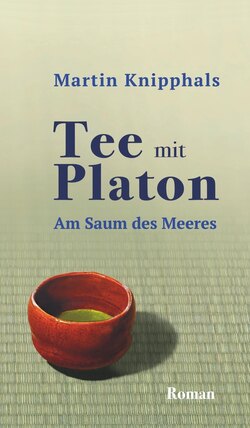Читать книгу Tee mit Platon - Martin Knipphals - Страница 15
Оглавление6 Tee im digitalen Zeitalter
Was Bankei aus der Ferne in Naito`s schönem Kameoka zum Anlaß nimmt, über Tee im digitalen Zeitalter zu sprechen. Entstofflicht, als imaginärer Gedanke sozusagen, welches - schaut man genau hin - ein unnötiges Doppel-Gemoppel darstellt. Gedanken sind schließlich immer nur imaginär. Nicht real, nur ein Furz im Hirn, wie Kodo Sawaki einst deutlich sagte. (Ob das zahlreiches Entweichen dieser aus entleerten Köpfen die schlechten Luftwerte und den Klimawandel als Ursache erklärt, kann nur eine hochdekorierte Kommission aus Schlauhausen ermitteln.)
Bankei: Liebe Teegäste und Leser, natürlich geht es bei diesem Teemachen, wie Sie gewiß schon bemerkt haben, nicht um ein hochfeierliches Hineinhängen von Teebeuteln mit oxydiertem Tee (Schwarztee) mittels akzentfreiem ´Oooomhh´. Auch nicht um den friesischen Heißaufguß indischer Blattreste, die nur mit viel Zucker und Sahne genießbar scheinen. Selbst die grasig schmeckenden Chinablätter oder im Rauchfang ruinierter Samowartee sind hier nicht gemeint. Von Wurzelextrakten und zerhäckselten Baumrinden mit Jasminblütenaroma ganz zu schweigen. (Nicht alles, was man technisch trinken kann, sollte man auch seinem Körper aufbürden; denkt der Autor.)
Geht man mit allem achtsam um und versucht nicht, Natürliches zu verfälschen, bleibt auch die grüne Teepflanze „Camellia sinensis“ nach dem Trocknen selbstverständlich grün. Vorausgesetzt, die Plantage weiß, wie man innerhalb weniger Stunden ab Ernte die gefürchtete Oxydation (zum Schwarztee) vermeiden kann, bei der wesentliche Bestandteile und das eigentliche Aroma verloren gehen.
Womit automatisch japanischer Tee in den Fokus rückt. Und innerhalb der großen Vielfalt dessen, ist der Tencha nach Jahrhunderten sorgfältiger Züchtung besonders aus der Region Uji (nahe Kyoto) jener unübertroffene Weltklasse-Tee, über den seit hunderten von Jahren geschrieben wird.
Das von Blattadern befreite Blatt (Tencha), wird langsam in Gesteinsmühlen zu ultrafeinem Pulver zerrieben und dann in eigenwilligen Teeschale mit etwa 60° warmem Wasser aus einer Eisenkanne oder einem Eisenkessel, behutsam mit einer Bambuskelle übergossen und mit einem Bambusbesen (Chasen) schaumig geschlagen. Hierbei wird also das ganze Blatt getrunken, wodurch man in den vollen Genuß dieser edlen Pflanze kommt. Die außerdem noch reich an Antioxidantien und vielem anderen ist. Was das neuzeitliche ICH natürlich wissen sollte, denkt sich das ICH. (s.Forschungsarbeit von Prof. Dr. Schlau im Tiefseegraben)
Diesen zu Pulver zerriebenen Tee tranken zunächst nur die Zenmönche in China und ab 1230 auch die Zenmönche in Japan. In Togano (im Nordwesten Kyotos) ist heute noch der erste? Teestrauch von Meister Myoe (1173-1232) im Kozan-ji aus jener Zeit zu sehen. Ein äußerst stiller Ort hoch oben im Zedernwald, mit dem Duft und dem Flair von achthundert Jahren. (Und guten Restaurants wie Schwalbennester über der tiefen Schlucht.)
Auch der chin., später der jap. Adel (Daimyo) tranken ihn, aber in kunstvollen Ritualen mit edlem Geschirr. Man wußte schließlich, was man seinem Stand schuldig war. Und Untergebene konnte man so mit einem aufgesetzen Daimyo-Tee beeindrucken und huldvoll auszeichnen. Was sie dem Edlen Herrn noch mehr gefügig machte. Der Westler kennt dies gut von Messen aus holden Einschüchterungs-Hallen, wo einem mit dem Kreuz gedroht wird, falls man nicht gefügig ist. Hier allerdings mit Billigwein aus den Vatikan Kolonien jesuitischer Eroberer.
Juko: Erst um 1470 initiierte mein Lehrer Ikkyu in Kyoto den Beginn des Teeweges als Zenübung im Alltag. Beim morgendlichen Takuhatsu (Bettelgang) als erweitertes Kinhin (ein achtsames Gehen zwischen den Sitzphasen). Schlicht, ungekünstelt und tiefgründig, ohne Ritual-Touch und daher als Möglichkeit für alle, den Dualismus überwinden zu können. Was bald schon alle praktizierten. Jeder mit den Dingen, die ihm in seinem Alltag zur Verfügung standen.
Obgleich es weiterhin (völlig unzeitgemäß sogar bis heute) den rituellen (Daimyo)-Tee gab, hatte der Zentee (Wabicha) binnen weniger Jahre das ganze Volk erreicht und fortan Japan zu dem werden lassen, was ihr Heutigen als eindeutig >japanisch< anseht. Obwohl dies alles längst international geworden ist, sozusagen ent-japanisiert. Euer Bach und Beethoven sind ja schließlich auch international zuhause oder Rembrandt, Feininger und Dali. Wie übrigens bei allem, wo Menschen es vermögen, das Zeitlos-Gültige friedvoll zum Ausdruck zu bringen.
Wird man mit der Zeit der Übung auf dem Teeweg (Chado) ein Chajin, ein Teeweg-Mensch, so stellt sich ein klarer, unbestechlicher Blick für die Stimmigkeit des Zeitlos-Gültigen ein. Bei allem im Alltag. Sowohl bei Dingen, wie auch bei Vorgängen und Arbeitsabläufen. Dann läuft man nicht mehr Gefahr, schöne, schicke, ungewöhnliche oder bewußt häßlich gemachte Objekte*, versehentlich für geeignet zu halten. (*Findet man oft bei Pseudo Teeschülern, die dies für zen-gemäß halten. Ab der 3. Ochsenstufe verliert sich das.)
Diese Urfähigkeit in uns allen ist erfreulicherweise nicht von gesellschaftlichen Normen, einem Zeitgeschmack, persönlichen Vorlieben oder anderem abhängig oder manipulierbar. Dieser zeitlos gültige Zugang zu allem hilft uns allen, wie ein neutraler Kompass in uns, den Weg zu finden, zu gehen und bei Zweifeln dennoch mit geradem Rücken ehrenvoll zu handeln. Also ein uns gemäßes Leben zu führen. Was allen Tätigkeiten eine ungeahnte Qualität verleiht, selbst beim Haus- und Gartenbau, der Städteplanung, wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben.
Sagen wir der Gier, Angst, Fanatismus, schicken Titeln und sonstigem Adieu und besinnen uns auf den Kern in uns, beruhigt und belebt sich unser Alltag. Was Meister Sozui, im gar nicht so fernen Kyoto, in diesem Moment mit einer stummen Verbeugung bestätigt. Kanno schließt sich an, Juko lächelt.
Wobei gerade das Selber-Tun von großem Wert ist. Das Reinigen der Schalen, das Einfüllen, Übergießen und Schlagen des Tees aus menschlicher Hand erschafft, weswegen wir Menschen sind, denkt Sozui. Darum kommen wir zusammen. Und erst dann entsteht Kultur. Durch uns, mit uns. Ein Teeraum ist kein modernes Wasserloch für gierige Paviane!
Technoider Maschinentee als Ersatzhandlung? Hier regt sich heftigst der Würgreiz (bei echten Teetrinkern). Solches ist eventuell nur von einer Maschine für eine andere Maschine sinnvoll! Bei braunem Bohnensud, Kaffee genannt, ist dies für Coffein-Junkies offenbar unerheblich, wie weit verbreite Nutzerzahlen deutlich zeigen. Ein jüngst skizziertes Bild beschreibt dies recht treffend: Zu selbständigem Denken befähigte
Kaffeetrinker finden dem Herdentrieb gehorchend und Gesundheits-Risiken übergehend, den Weg zur Kaffee-Tränke, aus glänzendem Edelstahl. – Bis der Arzt oder Heilpraktiker abrät und Grüntee empfiehlt.
Ozeki: Knopfdruck und dann gibt`s Maschinen-Tee? H2O sagen und man kann schwimmen? Herumhocken wie ein Frosch und man ist erleuchtet? Nicht nur Sengai lacht hier herzlich. Und Nagaya schüttel den Kopf über solche dualistische Wirrnis. Kanno grinst. (Und der Autor denkt sich seinen Teil.)