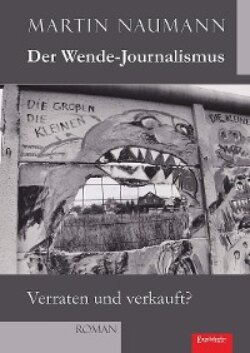Читать книгу Der Wende-Journalismus. Verraten und verkauft? - Martin Naumann - Страница 10
6
ОглавлениеVon seinem Schreibtisch aus konnte Conrad die Straße einsehen. Eine Blechlawine, stehen, im Schritt fahren, stehen. Parkende Autos, halb auf den schmalen Fußwegen, im Halteverbot, Anlieferer in der zweiten Reihe, dazwischen die Straßenbahn. Alles wurde von einem gleichmäßig brodelnden Lärm überlagert, in dem sich die hilflosen Signale eines Rettungswagens verloren. Das war die Anarchie des Straßenverkehrs. Hinzu kam, dass jetzt jeder ein Schild hinstellen konnte, um eine Straße aufzuhacken. Verschiedene Firmen stellten gegensätzliche Leiteinrichtungen auf, sodass diese Straße entweder gar nicht befahren werden konnte oder nur entgegengesetzt zur Einbahnstraße. Auch das war ohne weiteres möglich, denn die Polizei stand diesem Phänomen ebenso hilflos gegenüber. War dies das Gegenteil von Planwirtschaft?
Sollen sie sich durchwühlen, dachte Conrad und war in diesem Punkt nicht böse auf seinen Feierabend zu vorgerückter Stunde. Eine Tageszeitung wird vormittags geplant, nachmittags zusammengestellt und wenn sie etwas auf sich hält, kann noch bis 24 Uhr nachgeschoben werden, zum Beispiel ein Europapokalspiel, das der Leser am Frühstückstisch braucht, obwohl er es viel besser am Abend vorher im Fernsehen verfolgt hat.
Es war ziemlich spät, als er endlich die Heimfahrt antreten konnte. Schade nur, dass der Tag schon so gut wie zu Ende war. So machte er sich keine Hoffnung, dass er noch seine jüngere Tochter und die Enkelkinder antreffen würde, die waren längst daheim, „bei mein Papa“, wie der kleine Fratz immer sagte. Die Große, sofern man bei fünf Jahren von groß sprechen kann, hatte heute Klavierunterricht gehabt, anschließend kamen sie immer zu Besuch, leider sah er sie meist nicht. Seine Enkelin hatte Musik im Blut und weil die Großeltern kein Klavier besaßen, spielte sie immer auf der Tischkante vor, wobei sie sich genau so verspielen konnte und den Fehler mit ärgerlichem Gesichtsausdruck verbesserte.
Jetzt kam er zügig voran und unterwegs musste er wieder über diesen Meisel nachdenken, der dem Aufschwung Ost auf der Spur war. Aufschwung Ost, am liebsten hätte ihm Conrad gesagt, dass er sich da beeilen müsse, bevor auch der letzte Betrieb schloss. Aber das hatte er sich verkniffen, weil Meisel das sicher selbst wusste, ein Wirtschaftsjournalist konnte nicht so blind sein wie die Regierung.
Als er durch das für ihn offenstehende Gartentor fuhr, schüttelte er den Tag ab, dieses Haus erschien ihm wie eine Burg. Die Burgherrin hörte den Motor und setzte den Tee auf.
Erika Conrad war Sekretärin gewesen und nun arbeitslos, weil das Kombinat, für das sie gearbeitet hatte, nicht mehr existierte. Sekretärinnen wurden sogar gesucht, aber bitte jung und dynamisch, höchstens vierzig. „Das einzige, das auf mich noch zutrifft, ist dynamisch, da würde ich den Herren, die solche Forderungen stellen, noch etwas vormachen, aber das langt wohl nicht“, hatte sie auf dem Arbeitsamt gesagt und die Suche aufgegeben. So war sie eine von den 50 Prozent Frauen, die nach der Wende ihre Arbeit verloren hatten. Sie kam ihm entgegen, begrüßte ihn mit einem Kuss und sagte: „Die Kinder sind gegangen, schon vor zwei Stunden, aber Mutter ist da, sie will uns wieder mal was Gutes tun, rede ihr die geplante Werbeverkaufsfahrt bloß aus, auf dich hört sie besser.“
Inzwischen hatte der Junior von seinen Fußballübungen in der Wiese abgelassen, das Gartentor geschlossen und sagte: „N’abnd, Paps, du kommst wieder mal spät, also Journalist werde ich bestimmt nicht.“ Dabei schlenkerte er ungelenk seine Arme, er war fünfzehn, schon einsachtzig und noch kein Ende abzusehen. Dann protestierte er: „Also ich find’s stark, wenn Oma was mitbringen will, red’s ihr nicht aus, ich könnte einiges gebrauchen.“
„Du kannst alles gebrauchen“, sagte sein Vater und sie gingen zusammen ins Haus.
Oma Hertha war der gute Geist der Familie und die Stimme des Volkes, wie Conrad behauptete. Immer noch war sie eine äußerst resolute alte Dame, welche die meiste Zeit damit verbrachte, nach preisgünstigen Geschenken für die lieben Kleinen Ausschau zu halten. Erst gab es nichts, jetzt zuviel.
Oma Hertha schätzte den Rat ihres Schwiegersohnes, obwohl er sie einmal gekränkt hatte, als er behauptete, sie habe eine Kaffeephilosophie. „Das klingt ja gerade so, als ob ich aus dem Kaffeesatz lesen würde.“ Aber sie war eine Kaffeeliebhaberin wie die meisten Sachsen seit der Bachschen Kaffeekantate. Die Wirtschaft eines Landes beurteilte sie zuerst nach der Qualität des Kaffees. Doch es gab Länder, in denen überhaupt kein Kaffee getrunken wurde, wie zum Beispiel in der Sowjetunion. Das wusste sie seit einer Fahrt nach Leningrad, wo sie der Reiseleiter auf dieses Manko aufmerksam gemacht hatte. Trotzdem hatte sie mit ihren Reisebegleiterinnen im Hotel einen Kaffee bestellt und tatsächlich bekamen sie etwas, das wie Kaffee aussah, aber unbeschreiblich schmeckte; sie hatten es stehen lassen. Inzwischen war aus der Sowjetunion wieder Russland geworden, mit einigen Randstaaten ringsum und aus Leningrad Sankt Petersburg. Aber Jelzin, den sie erst mit Sympathie betrachtet hatte, weil er so männlich wirkte, brachte noch nicht einmal genug Brot auf den Tisch, geschweige denn Kaffee. Kein Kaffee, man sah ja, wo das hinführte.
Sogar die DDR hatte auf den Kaffee nicht verzichten können. Das waren zwar die billigsten Bohnen, die auf dem Weltmarkt zu bekommen waren, aber es war wenigstens Kaffee, für acht Mark das Viertel. Gegen Jakobs Krönung kam er natürlich nicht auf, das sah man an den verklärten Gesichtern in der Werbung, die Hertha regelmäßig sah, obwohl sie gleichzeitig schimpfte: „Die Werbeleute müssen die Zuschauer reinweg für beschränkt halten.“
So um die Weihnachtszeit herum hatte sie von ihrer Cousine aus Hannover immer ein Päckchen mit Kaffee, Schokolade, Bonbons und Gebäck bekommen, was sie aber, abgesehen vom Kaffee, nie für sich behielt.
Und dann geschah etwas, das Hertha tatsächlich in die Lage versetzt hatte, aus dem Kaffeesatz den Untergang der DDR vorauszusagen. Das war kein gewöhnlicher Kaffeesatz gewesen, sondern der Bodensatz einer neuen Kaffeemischung, die aus 10 Prozent Bohnenkaffee und 90 Prozent Malzkaffee bestand. Gut fürs Herz, behauptete die Parteiführung, die es leid war, wertvolle Devisen für Kaffee auszugeben.
„Das ist der Anfang vom Ende“, hatte Hertha entrüstet gesagt, die einen Beutel für zwei Mark gekauft hatte, um ihn dann als ungenießbar in den Müll zu werfen, so sparsam sie auch sonst war. Das war Protest und das Ende nicht mehr weit. Die Führung hatte zwar auf Oma und das Volk gehört und das Gesöff wieder aus dem Verkehr gezogen, was aber den Untergang nicht hatte verhindern können.
Einmal im Jahr war Oma Hertha zu ihrer Rentnerfahrt in den Westen aufgebrochen. Anfangs hatte sie sich geschämt Geld anzunehmen, aber das kam ja nicht von den Armen, das konnte man sehen. Obwohl sie auch hierin beinahe schwankend geworden wäre, denn bei ihrer ersten Westreise, sie war gerade sechzig geworden, wäre sie mitten auf dem Fußweg beinahe über einen Bettler gestolpert, ein junger Mann! Sie war erschrocken, dass man so etwas duldete. In der DDR wäre der Mann glatt verhaftet und in eine Gleisbaubrigade gesteckt worden.
Trotz aller Kaffeephilosophie hatte sie durchaus auch ein kritisches Verhältnis zu dem anderen Staat. Vor allem seit dem Tag, als sie der Einfachheit halber nicht nach Hannover zu ihrer Cousine, sondern nach Westberlin gefahren war. Als sie dort in einen Omnibus stieg, erstarrte sie, da waren Hakenkreuze auf die Lehnen geschmiert und an der Rückseite las sie: Deutschland den Deutschen. Hertha lief ohne zu zögern durch den fast leeren Bus und sagte zum Fahrer: „Wissen Sie eigentlich, was Sie für Schmierereien in ihrem Bus spazieren fahren? Sie müssen sofort ins Depot, damit das entfernt wird.“
Der Fahrer war verdutzt, bisher hatte sich noch kein Fahrgast beschwert und er entschuldigte sich im Voraus, sicher wieder eine pornographische Zeichnung, und ging mit nach hinten, dem anklagenden Finger Herthas folgend.
„Ach so, das da“, sagte er erleichtert, „das finden Sie überall. Sie sind nicht von hier? Na, dann gehen Sie mal durch die S-Bahn-Stationen, da guckt doch keiner mehr hin.“
„Na, was hast du diesmal auf dem Herzen?“, fragte Conrad seine Schwiegermutter nach der obligatorischen Umarmung, dabei sah er unauffällig auf die Uhr. Schon nach acht, da musste er sie wieder nach Hause fahren. Er war müde.
„Also Carl, stell Dir vor, Erika will keine Handnähmaschine, dabei passt die in jede Handtasche, für unterwegs, wenn mal was geflickt werden muss. Stattdessen will sie lieber ihr altes Nähetui mitnehmen. Und dann gibt es auch noch ein Kaffeeservice. Doch wenn Erika durchaus nicht will, dann bekommen das die Mädchen. Aber es gibt auch noch eine Armbanduhr im Militarylook, so steht es im Prospekt, und die habe ich dir zugedacht, Carl.“
„Nein ich habe doch eine Uhr und du weißt auch, dass ich Pazifist bin.“
„Dann kriege ich die Uhr“, rief der Junge laut dazwischen, „die ist sicher mit Kompass und Höhenmesser!“
„Na gut“, entschied Oma Hertha, „so ist mir’s auch lieber, da kommt keines eurer Kinder zu kurz und Gerechtigkeit muss schließlich sein, stimmt’s, Carl?“
„Ja“, entgegnete dieser, „aber du kennst meine Meinung zu den sogenannten Werbeverkaufsfahrten, da werden den Teilnehmern minderwertige Sachen zu überhöhten Preisen aufgeschwatzt, die sie überhaupt nicht brauchen. Ich rate dir, nimm kein Geld mit, sonst wirst du ausgeraubt.“
„So ein Unsinn, das sind lauter nette Leute“, widersprach Oma Hertha und ließ sich das Abendbrot schmecken. Aber das Thema beschäftigte sie doch noch: „Ich muss schon so ein günstiges Angebot annehmen, für 16 Mark nach Nürnberg, wo doch mein Sparguthaben halbiert worden ist.“ Sie hatte nie verstehen können, dass bei der Währungsunion der größte Teil ihrer Ersparnisse von 20 000 Mark, der Notgroschen für das Alter, halbiert worden waren, obwohl sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet hatte, während zum Beispiel bei ihrer Cousine in Hannover viel mehr auf der hohen Kante lag, dabei hatte diese nur aushilfsweise etwas dazu verdient.
„Dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen“, pflegte sie zu sagen und sie meinte ihre Teilnahme an den Montagsdemonstrationen, in die sie aber mehr zufällig geraten war.
Oma Hertha war „heilig“, wie ihr Schwiegersohn scherzhaft sagte, weil sie regelmäßig die Kirche besuchte. Früher hatte sie sogar versucht, ihn zu bekehren, ihn, einen waschechten Heiden. Dabei war mancher Missklang aufgekommen, denn ihre Tochter hatte sich auch gänzlich von der Kirche abgewandt, weil weder Kirche noch der liebe Gott all das Elend in der Welt abwenden konnten.
Und doch hatte die Kirche etwas bewirkt: Sie hatte den Bürgerrechtlern ein Dach über dem Kopf gegeben, ob sie nun glaubten oder nicht. Und die Gläubigen waren bei den Demonstrationen in den vordersten Reihen marschiert und sie hatten Kerzen in der Hand getragen. Mit Kerzen hatten sie einen totalitären Staat besiegt, das war einmalig in der Geschichte und Oma Hertha war dabei gewesen. Nicht gleich freilich, da war sie überhaupt nicht in die Kirche hinein gekommen, überfüllt, bereits Stunden vor dem Gottesdienst, wo hatte es so etwas schon gegeben? Ja sie war überhaupt nicht in die Nähe der Kirche gelangt, sie hätte sich durch die Menschenmassen drängen müssen und das wagte sie sich nun doch nicht. Später dann, nach der ersten Euphorie, war wieder Platz für die Gläubigen.
Oma Hertha war auch überzeugt, dass diese Montagsdemonstrationen nicht zufällig in Leipzig stattgefunden hatten, sondern dass Gott ein Auge auf diese Stadt geworfen habe, wie es der Pfarrer auch in einer Predigt gesagt hatte. Gott musste auch schon früher die Stadt im Blick gehabt haben, denn hier wurde Napoleon besiegt und nun Honecker. Und sie war der Meinung, dass man noch in mehr als hundert Jahren von den Montagsdemonstrationen reden würde, so wie heute noch über die Völkerschlacht von 1813. Und sie war dabei gewesen!
Auch wenn Conrad manchmal über die Ansichten von Hertha lächeln musste, hier gab er ihr recht.