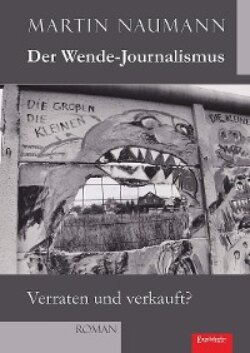Читать книгу Der Wende-Journalismus. Verraten und verkauft? - Martin Naumann - Страница 7
3
ОглавлениеEin böses Wort, Stalinist, was stellte sich Meisel unter einem Stalinisten vor? Conrad, danach befragt, hätte keine gültige Antwort geben können. Stalinismus war nicht gelehrt worden, damit hatten sich höchstens die Historiker unter freiem Himmel befasst, immer argwöhnend, dass ein Hüter der reinen Lehre sie verpfiff. Stalinismus war das allmächtige Wissen der Parteiführung, sie allein wusste, was richtig und falsch war. Sie sagte den Bauern was angebaut werden musste, wann sie mit der Aussaat zu beginnen hatten und wann mit der Ernte. Sie befand darüber, was Kunst zu sein hatte und was nicht, sie wollte den Malern die Pinsel führen, sie befahl, was produziert werden sollte, sie gab den Wissenschaften die Linie vor, sie bestimmte die Erziehung, kurz und gut, kein Gebiet, auf dem sie nicht führte. So auch bei den Käsesorten, die wurden auf einem Parteitag festgelegt und auch, dass es nun rote Telefone geben solle. Bei alledem duldete sie keinen Widerspruch, keinen wohlmeinenden Rat, sie gab nur soviel von ihrem allmächtigen Wissen an die nächste Führungsebene ab, dass diese in ihrem Sinne tätig werden konnte. Und so befahl sie den Bauern in Thüringen, in Höhen von über 600 Metern Mais anzubauen, weil Chruschtschow von der „Wurst am Stängel“ gesprochen hatte, was er eindrucksvoll durch das Hineinbeißen in einen Maiskolben bewiesen hatte. So gesehen ist Stalinismus ein System, das nicht nur Menschen, sondern auch eine Volkswirtschaft ruiniert. Doch dazu werden Erfüllungsgehilfen gebraucht.
Sind das die Stalinisten? Von ihnen wird man am wenigsten eine Antwort auf diese Frage erwarten können. Also wird man jene fragen müssen, die unter diesem System zu leiden hatten. Doch auch hier wird es verschiedene Antworten geben. Der Ausgewiesene, der Enteignete, der Eingesperrte, der Gemaßregelte, der auf der Karriereleiter Hängengebliebene, sie alle werden eine Antwort haben, jede wird einen Teil Wahrheit enthalten, aber nicht die ganze.
Als Stalin 1953 starb, rollten die Tränen, vor Schmerz oder Freude, je nachdem ob Gepeinigter oder Nutznießer. Einige hunderttausend Liquidierte hatten diese Tränen nicht mehr, sie lagen irgendwo unter der Erde, vergessen. Später sollte auch Stalin vergessen werden, man schämte sich seiner. Deshalb auch wurde sein einbalsamierter Körper von Lenins Seite wieder entfernt und in die zweite Reihe verlegt. Der in den roten Granit des Mausoleums gehauene Name wurde getilgt.
Und ausgerechnet aus der Sowjetunion kamen Rufe gegen das Vergessen. Von dort stieg ein Sputnik auf, geisterte durch den Zeitungswald und piepste auch in deutscher Sprache. Doch was in der Zeitschrift stand, dem Magazin Sputnik, das war kein Piepsen, das waren Donnerschläge. In schonungsloser Offenheit wurden da die Verbrechen Stalins genannt, er hatte fast die gesamte Generalität hinrichten lassen. 1941 war die Armee so ziemlich führungslos. Oder der Kongress der Liquidierten, 90 Prozent überlebten die Prozesse und Gefangenenlager nicht. Stalin musste mit Hitler verglichen werden, was einen Sturm der Entrüstung auslöste, logischerweise vor allem bei den Stalinisten. Und so enttarnte sich auch die Führung der DDR als stalinistisch, denn sie ließ das Heft „Sputnik“ auf den Index setzen, verbieten.
Danach war wenigstens klar, ein Stalinist war ein Mensch, der unbeirrbar dem allwissenden und allmächtigen Führungsanspruch der Parteiführung folgte, ohne nach Sinn oder Unsinn, nach Recht und Gesetz zu fragen und diese Linie mit allen Mitteln, auch mit brutalstem Zwang verwirklichen will oder doch zumindest diesen Zwang billigt, keinesfalls aber verurteilt.
Doch der Stalinismus ist keine Erfindung von Stalin. Wie würde man zum Beispiel einen Menschen bezeichnen, der seine Ziele mit erbarmungsloser Gewalt verwirklichen lässt? Da käme niemand auf die Idee, von einem Stalinisten zu reden, höchstens von einem gewissenlosen Politiker.
Die Wende brachte ein ganzes Heer solcher Ideologie-Akrobaten hervor: Ein Kaderleiter bestrafte Angestellte, die an der Montagsdemonstration teilgenommen hatten, durch Prämienentzug. Später dann, als Personalchef mit einem Westchef über sich, entließ er diese Leute mit dem Ausdruck tiefen Bedauerns zuerst. So konnte er sich auf einfache Weise unangenehmer Weggefährten entledigen.
Doch da waren noch viele Zeugen, die störten und weg mussten. Das war der Unsicherheit der Karrieristen geschuldet, die einst von einer Parteischule zur anderen gewandert waren und in der Moskauer Parteischule ihre Krönung gesehen hatten, weil danach ein Chefsessel sicher war. Doch wie ließ sich dieser Doppelsprung erreichen, einmal erneut die Karriere zu sichern und sich gleichzeitig unliebsamer Begleiter zu entledigen? Ganz einfach so:
1. Tag: Der Chef legt seinen Entwurf auf den Tisch, schweifwedelnd stürzt sich das Chamäleon darauf.
„Ja, ganz vorzüglich.“ Der neue Chef, der im Osten noch keine Freunde hat, braucht dieses Lob, er nimmt es ohne jeden Argwohn auf. Aber er würde sich etwas vergeben, wenn er ganz zufrieden wäre und so entdeckt er eine zugearbeitete Stelle, die ihm noch nicht gefällt, das müsse verbessert werden.
Da findet er eifrige Zustimmung: „Ich habe das Nötige schon veranlasst, aber der Verantwortliche tut sich schwer.“
Der Chef nickt noch nicht einmal, keine Reaktion, ob er das registriert hat? Nur die Falte auf seiner Stirn wird einen Millimeter länger.
2. Tag: Der Chef legt seinen Entwurf vor.
„Ganz ausgezeichnet“, sagt das Chamäleon und dem Chef wird es angenehm warm im Bauch, „aber da ist doch noch etwas“, sagt er.
„Ja, ich habe mit dem Kollegen geredet, aber der hat da seine Schwierigkeiten.“
Schwierigkeiten? Der Chef möchte keine Schwierigkeiten,
3. Tag: Der Chef legt seinen Entwurf vor.
„Einfach wunderbar“, hört er nun mit tiefer Befriedigung, die allerdings durch die bewusste Zuarbeitung doch etwas getrübt ist.
„Ich habe alles versucht, mit dem Kollegen muss einmal ein ernstes Wort gesprochen werden.“
Der Betreffende weiß natürlich von nichts, ihm klingelt es noch nicht einmal in den Ohren. Vom Chamäleon wird er nichts erfahren, das bleibt dem Chef überlassen.
4. Tag: Der Chef legt seinen Entwurf vor.
„Das ist phantastisch“, hört er und glaubt nun langsam selbst an seine außergewöhnliche Begabung. Leider hat sich in der bewussten Sache noch immer nichts geändert.
Das Chamäleon zieht ein missbilligendes Gesicht: „Von dem Kollegen kann man nichts anderes erwarten.“
Der Chef macht sich eine Notiz.
5. Tag: Der Chef legt seinen Entwurf vor.
„Einfach genial“, sagt das Chamäleon mit verzücktem Gesicht. Misstrauisch sieht nun doch der Chef auf. So ehrlich ist er zu sich, dass er sich nicht für genial hält: „Also bitte, genial, soweit sind wir noch lange nicht.“
Doch das Chamäleon versucht ihn davon zu überzeugen: „Doch, das ist genial.“ Nun aber erschrickt es, es hat dem Chef widersprochen, das ist ihm so herausgerutscht. Außerdem, vollkommen ist der Entwurf nicht, der Chef könnte das als Ironie auffassen. Das Chamäleon verändert seine Farbe, bekommt eine feuchte Stirn und begibt sich auf die Flucht nach vorn: „Es wäre genial, wenn endlich die ungenügende Zuarbeit verbessert würde. Aber“, das Chamäleon senkt die Stimme, „ich glaube, der Kollege sabotiert die Arbeit.“ Da ist er heraus, der vergiftete Pfeil, und der Chef macht sich eine längere Notiz.
Nunmehr geht alles seinen Gang. Der Kollege bekommt eine schriftliche Ermahnung, eine zweite wird folgen, Papiere für die Personalakte, es muss alles seine Ordnung haben.
Der Delinquent ist wie vom Blitz geblendet, er gelobt Besserung, was schwer ist, denn er arbeitet schon gut. Also versucht er zu ändern, nun wird es wirklich schlechter, die Unsicherheit steigt, Fehler schleichen sich ein, erneute Abmahnung und schließlich die Kündigung.
Allerdings lässt sich an diesem Spiel der Kräfte absehen, dass es so überall in der Welt ablaufen kann, also doch nichts mit Stalinismus? Vielleicht müsste man ein anders Wort dafür finden, das dann überall einsetzbar wäre. Nicht der Name macht es also, sondern die Handlung.
Solche tiefgehenden Gedanken zu diesem Thema wären Meisel fremd gewesen, aber er dachte über das Gespräch nach und stellte dabei fest, dass er diesem Conrad wenig Sympathie entgegenbrachte.