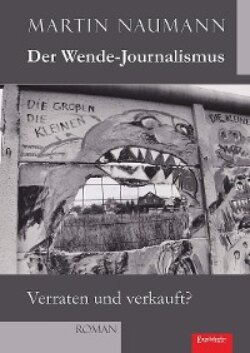Читать книгу Der Wende-Journalismus. Verraten und verkauft? - Martin Naumann - Страница 11
7
ОглавлениеDabei hatte es ausgesehen, als hätte jedwede Macht, die himmlische wie die irdische, ihre Augen von dieser Stadt abgewandt. Wenn ihre Bürger wirklich von allem verlassen waren, so doch nicht von dem Willen nach Veränderung. Wie, das wussten sie selbst nicht. Der letzte Funke für das Feuer vom 9. Oktober wurde vielleicht zwei Tage vorher geschlagen, ausgerechnet am 40. Jahrestag der DDR. Wie in einer Kristallkugel hatten sich da die 40 Jahre gespiegelt.
Dieser Gedanke hatte sich Conrad am Abend des 7. Oktober aufgedrängt, als er von früh bis spät die Ereignisse mit der Kamera begleitete. Der Morgen hatte mit Heldenverehrung begonnen. 9 Uhr Kranzniederlegung am Antifaschistischen Ehrenhain auf dem Südfriedhof. Eine verordnete Zeremonie, die politische und staatliche Führung war erschienen, alle, die repräsentieren mussten, alle, die gesehen werden wollten, und auch einige, denen es Bedürfnis war, derer zu gedenken, die unter dem Fallbeil gestorben oder erschossen worden waren. Und da lagen auch viele, friedlich dahingeschieden im Bett und nun vereint im Ehrenhain erster Klasse. Das Fußvolk dagegen drängte sich im Ehrenhain zweiter Klasse, die angestrebte klassenlose Gesellschaft ließ sich auch im Tod nicht verwirklichen.
Wie oft hatte Conrad das schon fotografiert. Die Bilder glichen sich wie ein Ei dem anderen, man hätte einen Film daraus zusammensetzen können. Hatte der Bildreporter nicht die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Vorgang jedes Mal anders zu sehen? Mal von oben, mal von unten, mal mit dem Feuer im Vordergrund, mal mit der Trommel, dann wieder mit Blumen, feierlich ernste Gesichter, oh der Möglichkeiten gab es viele. Aber er konnte so viel variieren wie er wollte, ja das wurde sogar verlangt, unter einer Bedingung: Die Führung musste scharf im Mittelpunkt stehen. Jedes Jahr die gleichen Leute. Ein Musikkorps der Volkspolizei war aufmarschiert. Unsterbliche Opfer, wofür hatten sie ihr Leben gegeben? Dafür, dass alles in Unfähigkeit erstickte, für eine Utopie?
Hinter den Grabplatten aus geschliffenem rotem Granit standen Thälmannpioniere, Schüler in Uniform mit rotem Halstuch, eine rote Nelke in der Hand, die sie auf ein Kommando hin niederlegten. Die Lehrer hatten Mühe, die Kinder in der nötigen Andacht zu halten.
Ohne Kampfgruppe ging da nichts, sie musste die Kränze tragen. Wenn nicht die dicken Bäuche und Bärte gewesen wären, hätte das sehr militärisch aussehen können. Es hatte geregnet und der geschliffene Granit spiegelte die Kämpfer kopfstehend. Conrad fotografierte sie mit dem Völkerschlachtdenkmal im Hintergrund.
Das Ritual ging weiter. 10 Uhr fand die nächste Kranzniederlegung am Ehrenhain der Sowjetarmee auf dem Ostfriedhof statt. Der ganze Konvoi – Autos und Omnibusse – setzte sich in Bewegung. Conrad kletterte in seinen Trabant und war früher da, er kannte den kürzesten Weg.
Dort verdoppelte sich der Einsatz, zwei Musikkorps standen auf dem grünen Rasen, rechts die Sowjetarmee, links die Volksarmee. Die Sowjets wirkten schneidiger in ihren Paradeuniformen und sie spielten auch besser. Die Volksarmee dagegen sah in ihren langen Mänteln hölzern aus. Es trafen die gleichen Ehrengäste ein, verstärkt durch Abordnungen der bewaffneten Organe, Militärbezirk, Polizei, Staatssicherheit. Für Minuten brannte nun das ewige Feuer, betrieben aus einer Propangasflasche, bewacht von einem Feuerwehrmann. Sobald die Nationalhymnen erklangen, erstarrte alles in strammer Haltung.
Wieder standen Thälmannpioniere hinter den Grabsteinen. Die dort Beerdigten waren im Durchschnitt 20 Jahre alt geworden. Merkwürdigerweise stand auf manchem Grabstein nur der Familienname und die Jahreszahl 1946. Warum war der Name nicht vollständig und warum fehlte der genaue Todestag? Es gab da Geheimnisse, waren die Begrabenen im Tod wieder die Opfer? Ein Jahr später wurden die Grabsteine mit Hakenkreuzen beschmiert und umgeworfen.
Offiziere der Sowjetarmee legten als erste Kränze und Blumengebinde nieder. Im zackigen Stechschritt zogen sie wieder ab, der Alte Fritz hätte seine Freude gehabt. Weniger bei der Nationalen Volksarmee, die als nächste an der Reihe war. Dann lief alles weiter streng nach Protokoll, da war nichts dem Zufall überlassen. Zuerst die Partei, dann alle möglichen Organisationen, bis das Volk an der Reihe war, die Delegationen aus den Betrieben und den Wohnbezirken, eine ansehnliche Menge, die allerdings weniger aus eigenem Antrieb gekommen war, sondern mehr, weil sie keine Ausrede bei der Hand gehabt hatten.
Mit dem Volk, inmitten sowjetischer Zivilangestellter und Offiziersfrauen, kam auch Vater Fjodor Povnyi, der Hauptgeistliche der Russischen Gedächtniskirche, das Kreuz leuchtete golden auf seinem schwarzen Gewand. Es war erst das zweite oder dritte Mal, dass er teilnehmen durfte. Dank dem Monster Perestroika hielt nun auch die Religion Einzug in der Sowjetarmee, die Kirchen begannen wieder zu „arbeiten“. Bei seinen Reisen in die Sowjetunion hatte Conrad oft gehört: Diese Kirche arbeitet jetzt als Museum. Nun war die Kirche zurückgekehrt, misstrauisch von den Parteioberen betrachtet: wo sollte das hinführen, wurde die Armee aufgeweicht.
Zwei Kranzniederlegungen waren aber nicht genug, Der Tross zog weiter, wenige Schritte nur bis zum polnischen Ehrenmal. Hier achtete der polnische Generalkonsul auf das Protokoll. Aber das Pulver war bereits verschossen, es ging weniger feierlich zu, keine Musikkapelle, weniger Blumen. Aber immerhin, man hatte dem großen ungeliebten Bruder wieder einmal gezeigt, dass man an Polen nicht vorbei kommt. Deshalb wohl auch hatten die Polen ihr Ehrenmal in Sichtweite des sowjetischen errichtet, eine große, unregelmäßig geformte Steinplatte mit Fußabdrücken, vielleicht symbolisierend die letzten Spuren der ums Leben Gekommenen.
Nunmehr eilte Conrad zu seinem Trabi und fuhr in die Merseburger Straße, die zu Ehren des 40. Jahrestages zum Teil in eine Fußgängerzone verwandelt worden war.
Das System hatte eine Vorliebe für Jahrestage, deren Bedeutung dadurch unterstrichen wurde, dass die Werktätigen förmlich danach lechzten, irgendetwas zu übergeben: Eine neue Produktionslinie, ein neues Produkt, neue Wohnungen, einen neuen Kindergarten, einzig und allein gebaut zu Ehren des Jahrestages, gewissermaßen auf den Geburtstagstisch gelegt.
Nun war das mit diesen Geburtstagsgeschenken so, dass ihre Fertigstellung nicht unbedingt synchron mit dem Ereignis lief. Manchmal war eine neue Einrichtung früher fertig, meist aber später. Man half sich, indem die zu früh fertig gestellten künstlich angehalten oder auch zweimal übergeben wurden, das erste Mal zum Probelauf und dann mit symbolischem Knopfdruck zum Jahrestag. Vorher durfte die Presse nichts darüber berichten, der Geburtstagsüberraschung wegen. Und was zum Jahrestag noch nicht fertig war, wurde trotzdem übergeben und die Presse musste darüber berichten, auch wenn die Anlage noch nicht lief. So gesehen war die kleine Fußgängerzone ein recht mickriges Geburtstagsgeschenk, zumal, wenn man die Jubiläumszahl 40 betrachtete.
Für die Anwohner dieser einst stark befahrenen Straße war es dennoch angenehm. Anstatt auf Blech und wabernden Auspuff-Qualm blickten sie nun von den Fenstern ihrer strahlend weißen Fassaden auf Blumenschalen. Der Verkehrslärm war verschwunden, ein Idyll im Arbeiterwohnviertel.
Aber der Verkehr sucht sich einen anderen Weg, wenn ihm ein Hindernis vor die Räder gelegt wird. So brandete er nun durch die Nebenstraße, eine enge düstere Schlucht, die auch durch die bunten Karossen nicht verschönert wurde. Viele Gebäude standen leer, die Scheiben eingeworfen, durch die zerlöcherten Dachrinnen tropfte das Wasser, ein Taubenparadies. Für die, die dort wohnen mussten, wurde es nun noch schlimmer. Conrad fotografierte die neu gefärbten Fassaden. Das Alte, den Dreck, wollte keiner sehen, am wenigsten zum Jahrestag.
Als er den Apparat wieder absetzte, umringte ihn eine Gruppe Jugendlicher: „He, bist du etwa von der Zeitung? Sieh dir lieber die Rückseiten an, die haben sie nämlich glatt vergessen.“ Ein jungen Mann mit dünnem Haar hielt Conrad sein Glas Bier vor die Nase: „Komm, trink einen Schluck mit.“ Conrad hatte es riskiert abzulehnen, obwohl das in solchen Situationen unklug war. Aber die Leute gaben sich nicht beleidigt: „Na gut, mit dem Auto“, sagte der Wortführer, „da trink ich eben mein Bier selbst, ist ja 40. Jahrestag, da mach auch ich meine Amnestie mit dem Staat. 13 Monate war ich im Knast, weil ich das Maul zu weit aufgerissen hatte, vergessen“, sagte er versöhnlich und trank das Bier in einem Zug aus.
Conrad fotografierte die Rückseiten der Häuser für das private Archiv. Rohes Mauerwerk, Salpeter bis in das Erdgeschoss, defekte Dachrinnen, halb eingefallene Schuppen und ein entsetzlicher Unrat, alles, was nicht mehr gebraucht wurde, lag herum.
Der Mann mit dem Bierglas war ihm gefolgt: „Fotografiere das ruhig“, sagte er, „die DDR im Kleinen.“ Und dann begann er zu erzählen, vielleicht hatte ihm das Bier die Zunge gelöst, jedenfalls war er sehr mitteilsam. Er ärgerte sich über die schlechte Behandlung der Arbeiter. Als Niederdruckheizer müsse er im Winter oft 13 Stunden am Tag arbeiten, der Verdienst wäre dadurch nicht schlecht und er wolle nicht weg, aber dass er nur 18 Tage Urlaub bekomme, dass sehe er nicht ein, wo doch die Verwaltung, die immer mit der Kaffeekanne herumrenne, 26 Tage bekomme. Nein, gerecht wäre das nicht. Er wäre schon bei der Gewerkschaft gewesen, aber natürlich umsonst.
Es war nicht zu überhören, die Zeit der Sprachlosigkeit ging zu Ende, Conrad war aufgefallen, dass die Leute immer offener ihre Meinung sagten. Die Partei, die doch vorgab, auf alles eine Antwort zu wissen, stand dieser Erscheinung hilflos gegenüber, hier half kein Lehrbuch weiter. Und so sah man in jedem, der seine Meinung offen sagte, einen Unruhestifter.
Am Ende der Fußgängerzone stand der Quell des Bieres, ein Wagen mit strammen Brauereipferden davor gespannt. Natürlich kein Freibier zur Feier des Tages, 50 Pfennig kostete der halbe Liter.
Beim Weggehen traf Conrad den Sekretär des Rates aus dem Stadtbezirk, er war aus der Eckkneipe gekommen und zählte jetzt die Fahnen, die in eisernen Ständern steckten.
„Die wird doch keiner wegnehmen“, sagte Conrad, bei einer DDR-Fahne konnte er sich das nicht vorstellen.
„Doch, die klauen wie die Raben“, entgegnete der Sekretär, „wenn sie wenigstens ihre Fenster damit schmücken würden, aber nein, sie zerbrechen die Stiele oder stecken sie an die öffentlichen Toiletten.“
Na schön, sollte er seine Fahnen zählen, das war nichts für die Berichterstattung, und so eilte Conrad in die Redaktion.
Aus dem Mittagessen wurde natürlich nichts. Er klemmte sich eine Scheibe Brot zwischen die Zähne und eilte in die Innenstadt, um das bunte Treiben der Markttage, die dem 40. Jahrestag ein festliches Gepräge geben sollten, zu fotografieren.
Auf der Bühne am Markt traten Breaktänzer auf und sie erhielten großen Beifall für ihre amerikanische Subkultur, wie die Funktionäre sagten. Früher wäre das verboten worden, aber auch die Liberalisierung in der Unterhaltung ließ sich nicht mehr aufhalten, wenn auch argwöhnisch von der Stasi beobachtet. Doch die jungen Leute hatten ein Klubhaus gefunden, das der Eisenbahner, das ihnen Trainingsmöglichkeiten gab. Es war bemerkenswert, was sie gelernt hatten, denn eigentlich waren das keine Tänzer, sondern ganz raue Draufgänger, die vorher nicht wussten, wohin mit ihrer Kraft. Aber anstatt auf den Fußballplätzen zu randalieren, hatten sie für sich den Breakdance entdeckt. Das waren Lehrlinge, Arbeiter aus einfachem Milieu; Intelligenz oder politisch Engagierte waren nicht darunter, denn welch geistig durchgebildetes Haupt möchte sich wohl im Kopfstand rasend um seine Achse drehen?
Auf der kleinen Bühne am Eingang zur Petersstraße spielte die Lose-Skiffle-Gemeinschaft poppige Folklore. An sich nichts besonderes, das war erlaubt, den englischen Text verstand sowieso keiner. Aber die Ansage: „Wir singen jetzt ein Lied für ein inhaftiertes Mitglied“, war stark, denn sie würden kein Lied für ein Mitglied vortragen, das eine wirkliche Straftat begangen hatte, also Diebstahl, Unterschlagung, schwere Körperverletzung. Das umstehende Volk nahm das auch nicht an, denn es klatschte Beifall, es verstand. Und die unauffälligen Herren, in ihren leichten Mänteln, bewaffnet mit Regenschirmen, als ob sie permanent mit einem Unwetter rechnen würden, hatten glatte unbeteiligte Gesichter, schlechte Kundschafter, denn sie klatschten nicht. Aber sie schritten auch nicht ein, ganz im Gegensatz zum vergangenen Sommer, als plötzlich Straßenmusikanten aufgetaucht waren und in der Innenstadt spielen wollten. Das war verdächtig, denn das war nicht die FDJ, sondern es konnten irgendwelche Rattenfänger sein. Wer hatte die Texte kontrolliert, woher kamen die Leute? Was wollten sie? Hatten sie überhaupt eine Genehmigung? Nein! Also verbieten, wo kämen wir hin, wenn jeder spielen und singen könnte, was er wollte.
Die Zurückhaltung der unauffälligen Herren konnte darin begründet sein, dass ihnen die knisternde Spannung nicht entgangen war, die über dem Markttreiben lag. Eine Machtprobe stand bevor, das Wort gegen bewaffnete Gewalt. Der stellvertretende Chefredakteur hatte gesagt, es würden Informationen vorliegen, dass konterrevolutionäre Elemente versuchen wollten, die Markttage zu stören, wahrscheinlich würden sich die Vorgänge wieder um die Nikolaikirche konzentrieren.
Konterrevolution? Wollte sie den Bürgern die Festfreude nehmen? Konnten die Menschen überhaupt Festfreude empfinden, wo in jedem Bekanntenkreis, bald in jeder Familie Plätze leer blieben? Wenn diese Massenflucht das Werk der Konterrevolution war, dann saß diese in Berlin, in den höchsten Ämtern, denn die Situation hatte nicht das Volk verschuldet, sondern die Führungsspitze mit ihren Hofschranzen.
Also an der Nikolaikirche stand die Konterrevolution und der gute Staatsbürger ging da nicht hin und weil der Journalist ein besonders guter Staatsbürger zu sein hatte, hatte er erst recht nicht hinzugehen. Wenn etwas mitzuteilen war, kam es von der staatlichen Nachrichtenagentur, abgesegnet von Joachim Herrmann, dem Pressezaren. Anscheinend war Conrad kein besonders guter Staatsbürger, natürlich ging er hin. Er sah das als seine persönliche Pflicht an, wenn er sich mit einigem Recht auch ein Dokumentarrist nennen wollte. Man könnte ihn festhalten, er würde seinen Presseausweis zeigen, das genüge nicht, wo ist der Auftrag? Ihm war klar, dass ihn die Redaktion, wenn es zu Zwischenfällen käme, nicht schützen würde. Lächerlicher Gedanke. Sie würden sagen: Tut uns leid, wir haben dem Reporter diesen Auftrag nicht gegeben.
Nur wenige Schritte vom Markt entfernt, kam er in eine andere Welt. Die Grimmaische Straße war vollgestopft, überall standen Menschengruppen, vor allem Jugendliche, aber auch Familien. Alle starrten in die Ritterstraße. Großes Gebrüll erhob sich, Bewegung kam in die Menschen, sie flohen vor etwas, das nicht zu erkennen war. Sie stolperten über Bänke, trampelten Grünpflanzen nieder. Conrad hörte dumpfe Schläge und ein eigenartiges Trommeln. Da sah er sie und fühlte sich um Zweittausend Jahre zurückversetzt, eine Szene aus der Antike. Männer in grünen Uniformen trugen Helme mit geschlossenem gläsernem Visier und ledernem Nackenschutz. Sie hielten helle Schilde vor sich, Schlagstöcke baumelten. Allein schon diese Ausrüstung war eine Provokation und bedeutete, dass der politische Gegner als Steinewerfer eingestuft wurde. Aber es flogen keine Steine, obwohl die Menschen auf einem wahren Munitionsdepot standen, so hätte man die Kieselsteine der Wasserspiele bezeichnen können. Die Polizei sperrte die Grimmaische Straße ab. Was sollte das werden? Niemals zuvor hatte es einen solchen Polizeieinsatz gegeben. Das System der Erziehung, Bevormundung, Gängelei und Bestrafung hatte perfekt funktioniert, so perfekt, dass die Menschen nur einzeln den Widerspruch wagten. Zum Beispiel mit der Abgabe eines Ausreiseantrages oder indem sie nicht zur Wahl gingen, was trotz Wahlgeheimnis eine Information an die Arbeitsstelle zur Folge hatte. Oder indem Wähler sogar die Stimmzettel öffentlich durchstrichen, was als staatsfeindlicher Akt angesehen wurde. Und sie waren einzeln in Gewahrsam genommen worden, wenn sie offen gegen den Staat antraten. Jetzt aber protestierten tausend junge Leute schon allein durch ihre Anwesenheit. Was wollten die Menschen an der Kirche?, Und warum wollte sie die Polizei von dort vertreiben? Die Kirche hatte geschlossen, den staatlichen Feiertag überließ sie allein dem ungeliebten Staat; die Konterrevolution konnte sich also dort nicht verstecken. Aber diese Kirche war zum Symbol der aufkeimenden Bürgerrechtsbewegung geworden und jeder, der ihre Nähe suchte, war verdächtig. Also vertreiben!
Erst waren es wohl ein Dutzend, die sich versammelt hatten, argwöhnisch von der Stasi beobachtet. Das konnte doch nur eine Provokation sein, um den Feiertag zu stören, da musste Polizei her. Doch die Vertreibung erreichte genau das Gegenteil, die Jugendlichen wollten gegen den Stachel lecken und hier konnten sie es, sie ließen sich nicht vertreiben. Hinzu kamen zufällige Passanten, junge Leute meist, die zunächst nicht wussten, um was es eigentlich ging, es wurden immer mehr. Die Polizei forderte Verstärkung an. Auf den Dächern der umliegenden Gebäude drehten sich die Überwachungskameras, die ihre Bilder in den Stab der Volkspolizei übertrugen. Die Alarmstufe wurde ausgerufen, Mannschaftswagen fuhren auf und Kirche und Vorplatz wurden abgesperrt. Da standen sich nun die Fronten gegenüber und keine Partei wusste, was das werden sollte.
Plötzlich lief ein junger Mann auf die Postenkette zu, er wurde zusammengeschlagen und unter ohrenbetäubenden Protestrufen nach hinten abtransportiert. Nach dieser Heldentat zogen sich die Polizisten wieder in die Ritterstraße zurück, wo inzwischen die Hauptmacht stationiert war. Dort stand auch ein Lastwagen mit vorgespanntem Räumschild. Das lästige Volk sollte wohl weggeschoben werden?
Die Nikolaistraße war ebenfalls abgesperrt. Junge Bereitschaftspolizisten, Wehrpflichtige, standen Auge in Auge mit der aufgebrachten Menge, die versuchte, mit den Polizisten zu reden: „Warum seid ihr hier?“ „Geht nach Hause!“ Die Polizisten waren verlegen, sie wussten nicht, was sie antworten sollten, sie hatten einen Befehl auszuführen und man sah, dass sie Angst hatten. Aber immerhin, einzelne Worte wurden gewechselt.
Zeit zum Nachdenken blieb nicht. Wieder flüchtende Massen, wieder nachstürmende Polizisten, die eine Kette in Richtung Altes Rathaus bildeten. Dabei trommelten sie mit ihren Gummiknüppeln auf die Schilder, es war wie das Imponiergehabe der Gorillas, sie wollten sich Mut machen und gleichzeitig abschrecken.
Doch sie schreckten niemanden ab. Jedes Vorgehen war wie ein Schlag ins Wasser. Die Menge teilte sich, flutete auseinander, um dann wieder zurückzubranden, Es bildeten sich Sprechchöre: „Schämt euch was!“ und „Wir bleiben hier!“ Das war eine Antwort an Honecker, der gesagt hatte, es sei um keinen schade, der gehen will. Einige Demonstranten stimmten die Internationale an: „Wacht auf, Verdammte dieser Erde…“ Unter Beifall kehrte sie sich jetzt gegen die Staatsgewalt. Aber besonders Textfest waren die Leute nicht. Und dann tönte immer lauter ein Ruf: „Gorbi, Gorbi“. Ausgerechnet der erste Mann der Sowjetunion, die ihre eigenen Probleme hatte, wurde zur Hoffnungsfigur. Allerdings auch, weil das Volk sehr wohl gemerkt hatte, dass Gorbatschow von der DDR-Führung als Trojanisches Pferd angesehen wurde. Einst konnte man vom großen Freund nicht genug lernen, das Siegen vor allem, da tauchte das Gespenst der Perestroika auf und plötzlich war das eine interne Sache der Sowjetunion. So intern, dass darüber nicht geredet wurde, und wenn doch einmal ein vorwitziger Genosse danach fragte, erfuhr er, dass die DDR ihre Perestroika längst hätte und die Sowjetunion nur nachziehe. Und so hatte Jochen Pellert, der erste Parteisekretär, mit leiser Genugtuung in der Stimme gesagt: „Aus dem Lehrling ist der Meister geworden.“ Größenwahn stand schon immer vor dem Absturz.
Eine Frau bekam vor Aufregung einen Herzanfall. Der Rettungswagen sorgte für neue Unruhe. Die Geprügelten aber wurden nicht mit dem Rettungswagen abgeholt, sondern auf die bereitstehenden Lastwagen mehr geworfen denn geschoben.
Trotzdem, das Volk machte sich Luft. Keiner sah misstrauisch zum Nachbarn, der ein IM sein konnte, einer von der Stasi, sollte er ruhig, hier bekam er die Meinung gratis. Überall standen diskutierende Gruppen, die den Polizeieinsatz verurteilten. Keiner wagte es oder hatte das Bedürfnis, Partei für den Staat zu ergreifen. Im Gegenteil, es fielen harte Worte: „Das haben sie von den Nazis gelernt.“ Conrad hörte, wie ein junger Mann mit Tätowierungen am Arm zu Frau und Kind sagte: „Diese Ratten, wenn es hart auf hart kommt, steche ich mindestens drei von denen ab.“ Natürlich richtete sich der Hass der Leute gegen die unmittelbare Gewalt und damit gegen die Falschen, denn die Polizisten waren nicht aus freien Stücken gekommen, viele waren Wehrpflichtige, Bereitschaftspolizisten, wer weiß, aus welchem Dorf sie kamen, und nun standen sie mit großen Augen in der großen Stadt einer tausendköpfigen Menge gegenüber und ihr Befehl lautete, für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
Conrad war auf eine Bank gestiegen und so war er mit seinen 1, 82 m und der Kamera vor dem Auge nicht zu übersehen. Dabei hätte er sich am liebsten unsichtbar gemacht, denn er musste wie eine einzige Provokation wirken, nicht nur für die Polizei, sondern auch für das Volk, Doppelprügel waren angesagt. Zudem bemerkte Conrad, wie das Objektiv der Überwachungskamera immer wieder in seine Richtung geschwenkt wurde. Auf einmal befand er sich genau zwischen den Parteien. Ihm blieb nichts anderes übrig, als auf der Bank stehen zu bleiben. Jetzt sah er sie alle von vorn, links die Polizei mit ihrem grimmig blickenden Kommandeur und rechts die Demonstranten, welche die Polizei verhöhnten: „Geht nach Hause.“
Doch trotz aller Angst, die ihn beschlich, siegte das Mysterium der Frechheit. Die Polizei hielt wohl nicht für möglich, dass sich irgendwer auf die Bank stellt und sie beim Prügeln fotografiert, also musste es einer von der Stasi sein. Fatal wäre es gewesen, wenn das Volk zu der gleichen Meinung gekommen wäre. Aber das wiederum dachte mit Recht, die Stasi würde sich nicht so offensichtlich zeigen. Einige Demonstranten warnten Conrad: „Vorsicht, dort wird ein Fotograf verhaftet.“ Und tatsächlich, unter ohrenbetäubendem Gebrüll wurde ein älterer Mann mit grauem Haar von zwei Polizisten mehr weggeschleift als geführt, um den Hals baumelte seine Kamera. Er hatte wohl den Fehler gemacht, heimlich fotografieren zu wollen.
In dieser doch ein wenig unangenehmen Lage bekam Conrad plötzlich Verstärkung, ein junger Kollege stieg atemlos auf die Bank. „Nanu, wo kommst du her?“, fragte Conrad erstaunt und schielte dabei nach der Postenkette, die immer näher rückte. „Pellert hat in der Redaktion angerufen, in der Stadt käme es zu Zusammenstößen; das ist eben der Nachteil, wenn man als einziger aus der Fotoabteilung Telefon hat und so haben sie mich vom Kaffeetisch weggeholt.“ Dabei sah er mit großen Augen in die Runde und wagte zunächst nicht, die Kamera zu heben. Conrad aber wunderte sich, er selbst stand gewissermaßen illegal hier, während sein Kollege fotografieren sollte, was, das war klar, nämlich die Konterrevolution. Und für wen? Auch das war klar, nicht für eine Veröffentlichung, sondern für den Propagandasekretär der SED-Bezirksleitung. Zum Nachdenken blieb keine Zeit, doch Conrad war froh, jetzt Rückendeckung zu haben. Wie sich allerdings zeigen sollte, waren beide gänzlich ungeeignet für diesen Auftrag, indem sie nämlich nicht hinter der Polizei standen, sondern inmitten der Demonstranten und vor ihr.
Insgesamt blieb die Strategie der Polizei undurchschaubar. Sie bildete eine Kette, mal dort, mal da, dann ging sie zurück, schließlich wurden die Demonstranten über den Karl-Marx-Platz gejagt. Ein Offizier schleppte ein junges Mädchen im Haltegriff ab. Darüber erregte sich eine Frau, die zur Strafe über eine Absperrkette gezerrt wurde. Conrad hätte das fotografieren müssen, aber er hatte einfach Angst. Nur als wenig später fünf Polizisten einen Mann zusammenschlugen, riss er die Kamera und drückte auf den Auslöser.
Es trat nun eine gewisse Ruhe ein, überall bildeten sich Gesprächsgruppen und es wurde diskutiert. Der ganze Frust kam hoch, keine verstohlenen Blicke, ob jemand zuhörte, im Gegenteil, die Leute sollten zuhören! Auch die Polizei!
Eine ältere Frau im abgetragenen Mantel wendete sich direkt an einen Polizisten und sagte: „Ich war Trümmerfrau hier, dort vorn fuhr die Feldbahn“, und sie zeigte zum Platz, „Ich habe die Steine mit abgeputzt, aus denen Neues gebaut wurde. Jetzt habe ich Angst, dass diese Steine wieder herausgebrochen und auf die Staatsmacht geworfen werden.“ Der Polizist war völlig überfordert, sie hatten nur mit Schild und Knüppel geübt und nicht mit Argumenten.
Ein Demonstrant so um die Vierzig herum, der ebenso zufällig hier war wie viele andere, gab sich als Reserveoffizier zu erkennen. Er sagte, er wüsste nicht, was er tun sollte, wenn er einberufen würde, so eine Aktion könne er jedenfalls nicht mitmachen.
Von Altenburg war eine kleine, rundliche Frau in die große Stadt gefahren, der Markttage wegen, wie sie sagte, in der Hoffnung, dass es da etwas Besonderes zu kaufen gäbe, vielleicht sogar Döbelner Salami; und nun sei sie mitten in den brutalen Polizeieinsatz geraten.
Ein Mann im guten Tuchmantel erklärte, er sei durchaus nicht für den Kapitalismus, aber das hier sei auch kein Sozialismus. Honecker müsste vor der Fernsehkamera klärende Worte an das DDR-Volk richten und sagen, wie es weiter gehen soll. Es war erstaunlich, offenbar traute dieser Mann Honecker das zu, er setzte ihn damit nicht gleich der Führungsschicht, die sich weit vom Volk entfernt hatte.
Es wurde dunkel und die Bildreporter glaubten, nun genug riskiert zu haben und eilten zur Redaktion, obwohl Sonnabend war und keine Zeitung gedruckt wurde. Aber sie wollten ihre Filme entwickeln und sehen, ob da wirklich alles festgehalten war. Mancher westliche Bildreporter wird wohl lächeln, wenn er an seine Kampfeinsätze bei Wackersdorf, Brockdorf oder sonst wo denkt. Aber hier war die DDR und in dem sozialistischen Musterland deutscher Prägung gab es keinen Aufruhr und keine Revolution. Somit hatten die beiden gewissermaßen Neuland betreten.
Und doch wurde der Aufruhr indirekt zugegeben. Anders war die Tatsache nicht zu erklären, dass das eiserne Tor zum Redaktions- und Druckereigebäude verriegelt war. Es öffnete sich auch nach heftigem Klingeln nicht, denn die Konterrevolution könnte ja draußen stehen und dem öffnenden Pförtner eins über die Mütze hauen, um dann vielleicht Flugblätter zu drucken oder die Maschinen unbrauchbar zu machen, damit das wichtigste Organ der SED-Bezirksleitung empfindlich getroffen werde. Nein, da gab es Maßnahmen. Also, wer hinein wollte, musste von außen telefonieren, falls er einen funktionierenden Münzfernsprecher fand, und dann mitteilen, wann er vor der Tür zu stehen gedenke. Dann aber genügte einfaches Klingeln, kein konspiratives Signal. Der Verlagsdirektor öffnete höchstpersönlich; was wollte dieser Samstagabend im Betrieb?
Mit dem eisernen Tor hatte es noch eine besondere Bewandtnis. Vor dem 17. Juni 1953 war der Zugang zu Redaktion und Druckerei frei. Doch als draußen die Konterrevolution marschierte und Schüsse fielen, musste ein besonderer Schutz her und dafür schien eine Mauer mit eisernem Tor am besten geeignet zu sein.
Als die beiden in der Redaktion ankamen, herrschte eine Art Bunkermentalität. Einige leitende Redakteure saßen fast im Dunklen, nur beim Schein einer kleinen Tischlampe, damit der imaginäre Gegner denken sollte, die Redaktion sei nicht besetzt. Ja wieso war sie denn überhaupt besetzt? Die Zeitung wurde erst am Sonntag gemacht.
Ein Chef und zwei Abteilungsleiter stürzten sich auf die Reporter, als kämen sie von der Front. Conrad nahm sich kein Blatt vor den Mund und sagte, dass allein die bürgerkriegsähnlich ausgerüstete Polizei eine Provokation sei. Der Chef hatte seine Theorie, wie man mit diesem Aufruhr fertig werden würde: Wenn diese Leute schon demonstrieren wollten, dann solle man sie ruhig marschieren lassen, immer um den Ring herum, so lange, bis sie ihre Schuhe zerlatscht hätten, dann würden sie von allein nach Hause gehen.
Das Telefon klingelte, ein Anruf vom 1. Sekretär: am Peterskirchhof und vor der Thomaskirche wären Gruppen mit Spruchbändern aufgetaucht, die sollten fotografiert werden. Außerdem wolle er von allen Aufnahmen des Tages Vergrößerungen haben. Conrad fühlte sich unwohl, aber die Fotos konnten ihm nicht verweigert werden, denn er vertrat den Herausgeber.
So hatten sich die beiden noch einmal auf den Weg gemacht. Die Situation war unverändert, durch die Dunkelheit jedoch ins Gespenstische verzerrt. Hinzugekommen war nur ein Wasserwerfer, der kurze Salven in die Menge spritzte. Spruchbänder waren nicht zu entdecken. Auf die gleiche konspirative Art gelangten sie dann wieder in die Redaktion.
Conrad war unruhig geworden, seine Frau machte sich gewiss Sorgen, weil er längst überfällig war. Er verfluchte dieses verlotterte Telefonsystem, das ihm den Anschluss seit vielen Jahren vorenthielt. Wie hatte der Postminister gesagt?: Wir haben ein Wohnungsbauprogramm und kein Telefonbauprogramm. Und Conrad gehörte nicht zu den Privilegierten, die ganz überraschend einen Anschluss oder sogar vor der üblichen Zeit ein Auto bekamen. So bat Conrad seinen Kollegen, die Filme für ihn mit zu entwickeln, während er schnell nach Hause fuhr, um Bescheid zu sagen.
„Du kommst aber spät“, wurde er von Erika begrüßt.
„Ja, und ich muss gleich wieder weg, mach mir schnell ein paar Brote.“ Während sie einige Schnitten schmierte, auch für seinen Kollegen, erzählte Conrad, was sich in der Stadt ereignet hatte.
„Das musste so kommen“, sagte sie, „da ist die Rechnung der alten Männer im Politbüro nicht aufgegangen, von wegen: Solange wir leben, wird es schon noch gehen und nach uns die Sündflut.“ Erika entließ ihren Mann mit der Mahnung aufzupassen, dass er nicht zwischen die Fronten gerate.
Die Filme waren bereits trocken und die Bildreporter vergrößerten, was sie für wichtig hielten, während der Fahrer aus der Bezirksleitung ungeduldig wartete. Sie banden ihm nicht auf die Nase, dass sie alles dreimal vergrößerten, einmal für seinen Chef, einmal für die Redaktion und einmal für das persönliche Archiv. Seine Filme aber nahm Conrad mit und versteckte sie zu Hause.
Diese Vorsicht war nicht unbegründet. Einige Tage später kam ein Mann zu ihm in die Redaktion, klappte seinen Ausweis auf: Ministerium für Staatssicherheit, also ein Offizier der „Firma“. Der Mann sagte, er hätte mit Conrads Chef gesprochen, er dürfe sich die Filme vom 7. Oktober einmal ausleihen, interessehalber, sie müssten einigen Anzeigen nachgehen. Doch Conrad weigerte sich. Drei Wochen zuvor hätte er sich das nicht gewagt.
Daraufhin war der Offizier wutentbrannt wieder zum Chef gelaufen und seine Sekretärin hatte dessen letzte Worte noch gehört: „Wenn alle so handeln würden, dann könnten wir ja einpacken.“ Dem wäre nichts hinzuzufügen gewesen. Kurz darauf wurde Conrad zum Chef gerufen. Der wand sich ein wenig hin und her, er verstehe schon, dass Conrad die Filme nicht herausgeben könne, wir würden ja die Leser verraten. Aber vielleicht hätte er wenigstens einige unscharfe Negative?
„Nein“, sagte Conrad, „meine Negative sind alle scharf“, und dachte sich, bis auf das eine, auf dem fünf Polizisten einen Mann zusammenschlagen. Aber gerade das, bei dem er vor lauter Angst vergessen hatte, scharf zu stellen, würde er nicht ausliefern. Doch der Chef hätte ihn zwingen können; dem wollte Conrad zuvorkommen und so griff er zu dem Mittel der Erpressung: „Du könnest darauf bestehen, aber das bliebe dann nicht im Haus, ebenso würde auch nicht im Haus bleiben, wenn du dich hinter mich stellst.“
Der Chef stellte sich hinter ihn und Conrad konnte sich revanchieren und später dem Bürgerkomitee sagen, dass auch der Chefredakteur die Herausgabe der Filme verhindert habe. Aber da war er bereits kein Chefredakteur mehr.
Und noch viel später erfuhr Conrad, dass der Stasichef, Generalleutnant Hummitsch, persönlich beim Chef seiner Zeitung protestierte, wieso sich der Fotograf weigere, die Filme herauszugeben? Und noch später erfuhr Conrad, dass daraufhin ein lieber Kollege von der Stasi auf ihn angesetzt wurde, aber die Ereignisse waren schneller als irgendwelche Maßnahmen.
Nach einiger Zeit interessierte sich noch einmal jemand für diese Fotos. Da kam ein Abgesandter des Generalstaatsanwaltes der DDR und wollte sie haben, Material für einen geplanten Hochverratsprozess gegen Honecker. Da hatte sich der Mann aber auch mächtig wenden müssen. Sicher hing lange Zeit das Bild von Honecker hinter seinem Schreibtisch und nun wollte er ihm den Prozess machen.
Conrad erzählte von den versteckten Filmen. „Oh, welche Naivität“, sagte der Mann, „im Haus versteckt? Die hätten angefangen, Ihr Haus auseinander zu nehmen, lange hätten Sie da nicht zugesehen.“