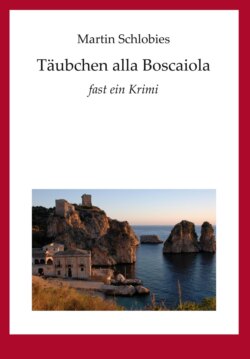Читать книгу Täubchen alla Boscaiola - Martin Schlobies - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Kapitel
ОглавлениеPauline war mit ihrem Malgerät auf dem Rücken aufs geratewohl in die Landschaft gelaufen, war über einen Weidezaun geklettert, um eine geeignete Aussicht zu finden, ein schönes Motiv zum Malen, hatte ihre Staffelei aufgestellt, die Palette ausgepackt, die Pinsel bereit gelegt, und wollte nun diese Bergkette vor ihren Augen malen, die nördlichen Ausläufer der Monti Nebrodici, sie in ihrer eigentümlichen Gestalt und Färbung erfassen, - bläuliche Hügelketten unter einem blaugrauen Himmel, - doch die Berge schienen sich dagegen zu sträuben, von ihr erfaßt zu werden, und weil sie abgelenkt war mit ihren Gedanken, wollte ihr nichts gelingen.
Schließlich war sie so durcheinander und verärgert, daß es überhaupt nicht mehr ging, also packte sie alles wieder zusammen, lief zurück zum Hof, in ihr Zimmer, stellte ihre Staffelei und Palette in eine Ecke, warf die beiden Skizzen, die sie gemacht hatte, auf den Boden, hockte sich auf die Bettkante, wie auf dem Sprung, - und kaute an ihren Nägeln.
Plötzlich fragte sie sich, ob Raphael sie überhaupt attraktiv finden könne, - sein Blick mit diesem häufigen, spöttischen Lächeln fiel ihr ein. Dann überlegte sie, ob er das bewußt so angestellt hatte, mit dieser Ölspur, stellte sich einen Moment lang vor, daß er mit Absicht über einen großen Stein am Rande der Straße gefahren sei, um die Ölwanne zu beschädigen und so aufzufallen, einen Vorwand zu haben, sich einfach zu ihr, einer fremden Frau, an den Tisch zu setzen. -
Bei diesem Gedanken lachte sie hell auf, stieß ihre Zeichnungen mit dem Fuß beiseite, diese rutschten halb unter das Bett, - sprang auf, zog sich aus, zog den blauen Hosenanzug an, - und eine frische geblümte Bluse! - nahm ihr Bildhauerwerkzeug, den großen Klöpfel aus Holz und die verschiedenen Meißel, ging nach draußen, dorthin, wo ihre Skulpturen im Gras lagen, und begann, an einem ihrer Steine weiterzuarbeiten. Es war ein großer Kopf, ein Männerkopf, mit einem Haarschopf, der wie eine Mütze aussah, - alles noch unfertig und roh, die Massen nur angelegt, die Formen bisher nur angedeutet.
Hier, im Freien, bemerkte sie erst, wie warm es immer noch war, verspürte heftigen Durst und holte sich eine Karaffe mit Wasser und ein Glas. Endlich waren ihre Vorbereitungen abgeschlossen und sie konnte anfangen zu arbeiten. Verbissen hämmerte sie an dem Stein herum, war bald mit Staub bedeckt und geschwitzt. Ab und zu mußte sie sich mit schmerzendem Rücken aufrichten, - und kam sich dabei vor wie auf der Fron, wie eine Sklavin, die - für wen eigentlich? - in ihren Ferien, hier in der Hitze schuften mußte, während andere Menschen jetzt in einem Liegestuhl lagen, - an einem schönen Strand, auf das Meer schauen durften, und, wenn es ihnen zu heiß wurde, schwimmen gingen, - als Raphael plötzlich neben ihr stand; und sie hatte nicht bemerkt, wie er gekommen war, hatte über ihrem Hämmern nicht einmal seinen Wagen gehört.
Raphael musterte sie amüsiert, „Der einzige Mensch, der auf dieser Insel jetzt wirklich fleißig ist,“, sagte er, „sind wahrscheinlich Sie! - Was soll das für ein Tier werden?“ Warum duzte er sie nicht einfach?, wunderte sich Pauline.
„Kein Tier,“, sagte sie wütend, „sondern ein Männerkopf, - ich dachte dabei ein wenig an Ihren!“ Wieder lächelte er.
Vor diesem Mann hier, der sie so offen mit seinen hellen blauen Augen ansah, mit diesen freundlichen warmen Augen, zerfiel ihre Wut und Empörung zu nichts. Sie fühlte sich nur noch hilflos. Sie schämte sich, in Arbeitskleidung vor ihm zu stehen, verschwitzt und mit Staub überpudert; - und sie wollte ihm doch gefallen! -
Raphael tat jetzt etwas Unerwartetes. Er nahm ihre Hand in seine und hielt sie fest. Sie spürte, daß er sogar mit seinen Fingern ganz behutsam ihren Handrücken streichelte. Sie hielt still, schaute ihn mit offenem Mund an, seine Berührungen hatten etwas Beruhigendes, Tröstliches. - Er will mich trösten!, dachte sie verblüfft. - Warum nur?
Sie machte ihre Hand vorsichtig los, nahm ihr Glas, trank es leer und wartete. „Kommen Sie mit,“, sagte er, „ein kleiner Ausflug in die Berge. Ich möchte Ihnen zeigen, was ich dort gefunden habe, und weshalb ich immer dorthin fahre.“ - Einmal etwas anderes! Es wäre ja noch früh am Nachmittag. Sie hätten Zeit genug.
Sie nickte nicht, sie reagierte überhaupt nicht. Irgendetwas war geschehen, - oder geschah gerade jetzt, - was etwas Neues in ihr Leben brachte, ganz überraschend. Einen Moment überlegte sie , was sie ihm mitteilen könnte, und sagte dann nur etwas sehr triviales: „Ja! - Ich muß mich nur noch frisch umziehen.“
Als sie ins Bad ging, war sie erschrocken, wie häßlich sie aussah, häßlich und müde! Sie war tatsächlich über und über mit Staub bedeckt, mußte erst einmal duschen, die Haare waschen, - fühlte sich gehetzt, - mußte plötzlich noch soviel erledigen, daß die Zeit nie reichen konnte für alles.
Endlich langte Pauline an seinem Wagen an, mit nassen Haaren, verschmiertem Lippenstift, unordentlich angezogen, - er saß auf dem Fahrersitz, las eine Zeitung. „Ich hasse es, jemanden warten zu lassen!“ murmelte sie, ließ sich auf den Sitz fallen.
„Nicht so schlimm!“, sagte er, ohne hochzublicken und faltete die Zeitung zusammen. War er verstimmt? Dann legte er vertraulich den Arm um ihre Schulter, ihr wurde es heiß, sie atmete tief durch, hoffentlich würde er jetzt nicht versuchen, sie zu küssen! Nein! Er sah sie nur an, strahlte, „Schön, daß wir diesen Ausflug machen!“
Raphael setzte sich seine Schirm-Mütze auf, hatte auch eine für sie, startete, fuhr los, sie winkten Maria und Antonio zu, dem Hauswarts-Ehepaar, das am Restauranthaus stand, wie früher die Dienstboten.
Unten auf der Küstenstraße wirkte Raphael auf einmal unsicher, hatte er nicht behauptet, die Strecke zu kennen? Nahm er eine andere Straße als gewohnt? Pauline wollte ihm helfen, bestand darauf, die Karte zu lesen, die gerade in diesem Küstenabschnitt nicht stimmte, was er wiederum nicht glauben wollte. Um auch in die Karte schauen zu können, lenkte er den Wagen mit der linken Hand und neigte sich dabei gefährlich zu ihr herüber.
Plötzlich fing der Wagen an zu stottern, Raphael bückte sich nach unten, fingerte unter dem Armaturenbrett herum, dann sogar im Pedalraum.
„Was machst du da?“, fragte sie ängstlich.
„Ich suche den 'Secret switch'; den Schalter für die Benzinpumpe, - eine Sicherung gegen Diebstahl.“
„Achtung!“, schrie sie, denn beinahe wäre er bei diesem Manöver in den Straßengraben getrudelt. Er richtete sich auf, lenkte den Wagen gerade, lachte,
„Keine Angst, you secret witch!, denn das sind Sie doch, eine geheime Hexe, oder?“
„Warum Männer ausgerechnet beim Autofahren plötzlich vertraulich werden,“, sagte sie, „Das werde ich nie begreifen. Wahrscheinlich liegt es daran, daß die Frauen sich dann nicht wehren oder nicht einfach aussteigen können, - denn das wäre bei dieser Geschwindigkeit lebensgefährlich.“ Er lächelte in sich hinein und sagte nur,
„Verzeihung! - Aber das mit der Hexe werde ich Ihnen später einmal erklären. - Es ist ein großes Kompliment.“
„Danke für solch verschlüsselte Komplimente.“
Eigentlich hatte sie nur darauf zu achten, daß sie eine kleine, nicht beschilderte Abzweigung fanden, auf sonst nichts, dennoch mußte sie sich zusammennehmen, denn selbst wenn sie diese Abzweigung finden würden, war er immer noch da und sie neben ihm und das ganze war jetzt und heute und nicht im Nirgendwo!
Es gelang ihr sogar ab und zu, die Landschaft, durch die sie fuhren, zu betrachten; es gab die Flanken steiler Hügelzüge, von hohen Mauern umschlossene Villen, und wenn die Straße sich hochwand, sahen sie tief unten Klippen oder zugangslose Strände, plötzlich auf der anderen Straßenseite ein Stückchen überraschend dichter Wald, - doch diese Abzweigung in die Berge wollte einfach nicht kommen, so angestrengt sie auch nach links und nach rechts starrte. „Wir müssen eben zurück, wenn wir es nicht mehr finden!“, sagte er. Anscheinend war er schon bereit, aufzugeben.
Kurz danach rief sie, „Da könnte es sein!“, denn sie hatte eine Tafel gesehen. - Doch es war nur die Zufahrt zu einem Hotel, einem trostlosen Betonkasten an einem dunklen, verdreckten Strand, und dann war rechts plötzlich nur noch das Meer zu sehen und links nur noch Fels und Geröll, und dazwischen die Straße, und nach ein paar hundert Metern sah sie mittendrin im Geröll ein unleserliches Schild, verrostet, zerschossen und verbeult, und weil es das einzige war, glaubte sie, daß es das endlich sein müßte.
„Links jetzt, bitte links!“, schrie sie auf, aber zu spät, denn sie waren schon daran vorbei gefahren, „Das muß es sein, hier gibt es sonst nichts. Glaub mir, links war richtig! Ich schwöre es dir!“ Sie duzte ihn plötzlich, und es war ganz selbstverständlich.
„Ja, du hast recht,“, sagte er, „ich erkenne es wieder!“ Er wendete direkt auf der Straße, und fuhr zurück. Ja, es war wirklich diese Abzweigung, die sie gesucht hatten, jetzt auf der rechten Straßenseite, die in die Berge führte. Gezwungen ruhig sagte sie,
„Dort hinauf geht es also!?“
Doch als sie die schräge, entsetzlich steile Geröllfläche in der ganzen Ausdehnung überblickte, durch die sich die Straße nach oben wand, rief sie, „Doch nicht da hinauf! Nein, das will ich nicht!“ Er lachte einfach, dieser ahnungslose Junge!
Je höher sie fuhren, desto kahler wurde der Berg, desto feiner die Luft, desto durchsichtiger der Himmel. Das Meer erschien manchmal nah, manchmal weit weg, wie in manchen Reisen ihrer Träume. Schließlich war die Straße nur noch eine Geröllpiste, und ab und zu flogen kleine Steine gegen den Boden des Wagens.
Bei einer Kehre sah sie das Meer unter sich, unvermittelt zu Füßen eines lotrecht abfallenden Felsens, wie aus der Höhe eines riesigen Turms, der nur Stein war, nackt und riesig, und vom kürzlichen Regen sauber gewaschen. Endlich waren sie daran vorbei!
Abergläubisch zählte sie die Kehren. An der dreizehnten Steilkehre begann es. Sie spürte es kommen, machte sich steif, stemmte sich ab, drückte sich mit den Füßen gegen das Bodenblech des Wagens, mit solcher Kraft, daß sie befürchtete, eine Beule in das Blech des alten Autos zu treten.
„Nicht so schnell!“, flüsterte sie.
„Der Wagen kann noch schneller . . . “ und er lachte, legte sogar seine Hand auf ihre Knie, „Du brauchst nicht mitzubremsen!“ So versteinert war sie vor Angst, daß sie nichts mehr zu sagen wagte. Es ist mein Ende, dachte sie, ich vergehe, ich löse mich auf, wenn er weiter hoch fährt!
Bei jeder Kehre verging sie von neuem.
„Herrlich . . . ,“, sagte er, „obwohl unpraktisch, mit einem solchen Wagen!“ Er bremste, kuppelte aus, weil er einen niedrigeren Gang einlegen mußte. Sie litt - und er genoß es! Wie ungerecht! -
Wie konnte man nur eine derartige Straße fahren? Und diese ständigen Steilkurven an Abhängen, wo nur Wahnsinnige so schnell hindurchrasen konnten. - Warum hatte sie nicht gleich gemerkt, daß etwas mit ihm nicht stimmte?
„Wie soll denn da oben noch ein Dorf sein?“ Hier oben konnte es überhaupt kein Dorf geben, hier war nur noch Wind und eine steile Straße, die sich den Berg hinaufquälte, mit diesem gelben Auto, das jeden Moment mit ihnen beiden den Abhang hinabstürzen mußte.
Er verstand natürlich nichts. Männer begreifen nie, was in Frauen vorgeht. - Er erzählte ihr etwas von Dörfern, die man aus Angst vor arabischen Korsaren so hoch in die Berge gebaut hatte, selbst noch zu Schinkels Zeiten hatte es sie gegeben, und daß die Amerikaner damals ein Kriegsschiff ins Mittelmeer geschickt hatten, um diesem Piraterie-Unwesen ein Ende zu bereiten, - wie sie so oft einem Unwesen endlich ein Ende machen wollten, doch damals wie heute meist völlig erfolglos.
Gut, diese Korsaren, dachte sie, die alten waren doch aber seit zweihundert Jahren fort, vertrieben, und die neuen hatten anderen Methoden. Da reichte ein Tapetenmesser. Die Zeit gebärdete sich doch so modern! Warum konnte man die Dörfer nicht nach unten verlegen, ihr zuliebe?
„Und die Silbermine?“, fragte er.
„Die auch!“, murmelte sie verstört. Er lachte. Wieder eine Kehre, bei der alles neben ihr wegsackte, um dann plötzlich als riesige Wand neben ihr wieder aufzutauchen und sie zu erschlagen. Nur Geröll, Gesteinsbrocken, schwarz und braun, dazwischen wuchsen weiße Kerzen. Asphodelos, Affodil, die Totenblume, ein Totenacker am Hang, ein rhythmisch aufheulender Motor. -
'Eine Silbermine?' - Jetzt war das Wort bei ihr angekommen, in seiner Bedeutung. Er suchte also eine Silbermine! - Wirklich, einem Wahnsinnigen war sie in die Hände gefallen, einem Phantasten! - Obgleich er eigentlich, rein äußerlich, mit seinem hohen, knochigen Wuchs, mit seinem roten Haar und der hellen Hautfarbe eher jenen Eroberernaturen glich, die nie fehlgehen. Sie musterte ihn mißtrauisch und genau. Wo sollte hier eine Silbermine herkommen?
Er ließ sich sogar herab, ihr alles zu erklären. Man hatte ihm gesagt, wer, spielte keine Rolle, daß am halben Hang des Monte Largo eine Grube silberhaltigen Bleis lag, eine Art Bergwerk, das aber seit einigen Jahren stillgelegt war.
Immerhin sollten der Besitzer, er sei Witwer, habe er gehört, mit einer Haushälterin oder Frau und einem Sohn und einer jungen Tochter noch dort oben in dem Haus wohnen, das die 'Direktion' gewesen war, und darauf warten, daß irgend jemand sich melde, die Abbauarbeiten wieder aufzunehmen.
Im Auftrag einer Bergbaufirma, die Gruben in ganz Europa, ja in der ganzen Welt besaß, hauptsächlich Zinngruben, sollte er, Raphael, die alte verlassene Mine erkunden. Er kam als Privatmann getarnt, um einen vernünftigen Preis zu erfahren, hätte auch Verhandlungsvollmacht, sogar für einen Kauf.
„Wie geht es dir?“, fragte er endlich. Ihr ging es so schlecht, daß seine Nachfrage höhnisch in ihren Ohren klang. Sogar immer schlechter!
„Du bist blaß!“, stellte er erschreckend nüchtern und sachlich fest.
„Nein! Ich bin gar nicht blaß!“, behauptete sie, „Schau auf die Straße!“
„Keine Angst, ich bin ja bei Dir!“, versuchte er, sie zu beruhigen.
„Es wird schon gehen!“, murmelte sie.
Sie konnte doch nicht zugeben, ihm, dem immer noch Fremden, - wie alles unter ihr, neben ihr und in ihr verrutschte, - diese wahnsinnige Straße, er, dieses Auto, - wie der Himmel schon schräg stand - und wie alles begann zu kippen, mit all ihren Plänen und seinen Plänen und dem ganzen Silberbergwerk; - wie etwas in ihrem Gehirn sich schräg legte und alles Blut in eine Ecke des Schädels rann, sich dort sammelte, sich schon einen Weg bahnte, um mit einem Mal einfach durch den Knochen zu brechen, - und dann wäre es endlich vorbei!
„Halten wir an!“, bat sie.
„Wie?“
„Bitte anhalten!“, sie konnte nur noch flüstern; doch er rief fröhlich:
„Wir sind doch gleich da!“
Waren die Kopfschmerzen nun schlimmer oder die Übelkeit? Diese Frage lenkte sie ab, doch nur kurz. - Nein, die Kopfschmerzen waren nicht das Schlimmste, - die Hilflosigkeit, das Ausgeliefertsein war ärger. Und sie war auf einmal verzweifelt, daß ihr der Name dieser Stadt da unten am Meer nicht einfallen wollte. Diese Stadt, die sich um den Normannenfelsen herum das Meer entlang drückte. Es war so wichtig, etwas zu wissen, sie war weniger verloren, wenn sie den Namen dieser verzweifelten Stadt jetzt wußte! - bis endlich die ersten runden Wachttürme sich zeigten, endlich eine Geröllhalde sichtbar wurde, die Abraumhalde, und plötzlich, bei einer neuen Biegung der Straße, das Dach eines Hauses auftauchte.
Raphael hielt den Wagen jetzt an. Eine Art natürlicher Plattform breitete sich über dem abschüssigen Felsengeröll aus, das bis hinunter zum Meer zu reichen schien. Es war Schiefergestein, dessen tausend und tausend Flimmerspiegelungen zwischen Schwarz und Silber jetzt ihren Blick wie lauter kleine bösartige Pupillen auf sich zogen. Ja, das Silber schien überall, obwohl es nur als ein ganz feines Gefunkel durchschimmerte.
Als erstes riß sie sich die Mütze vom Kopf, die Haare waren feucht, was eine angenehme Erfrischung bedeutete, endlich fand sie auch den Drücker der Wagentür, stieß die Tür auf, ließ sie weit offen, taumelte aus dem Wagen, schüttelte sich am ganzen Körper, um die durch die lange Fahrt gelähmten Glieder wieder einzurenken, und setzte sich auf einen Geröllhaufen neben der Straße,
„Geh nur! Geh nur!“, flüsterte sie.
„Du bist ja weiß wie eine Wand!“, sagte er, und seine Stimme klang ehrlich besorgt. Sie schämte sich,
„Macht nichts, es geht schon! Geh du nur! Es ist nichts schlimmes! - Seekrankheit. Nichts weiter.“ Einige Sekunden stand er kopfschüttelnd vor ihr, ging dann schließlich.
Als er fort war, legte sie sich flach auf die kantigen Steine, lag knapp unter dem niedrigen Himmel, atmete mit dem Rücken etwas Festigkeit, auf diesem trügerischen, vom ständigen Wegrutschen bedrohten Steinhaufen, atmen, ja das ging noch!
Dieser Wahnsinnige war nicht mit ihr in den Abgrund gefahren! Sie waren nicht abgestürzt! Der Haufen Steine war nicht mit ihr in die Tiefe gerast! Sie hatte noch einmal Glück gehabt. - Nie wieder! schwor sie.
Endlich gelang es ihr, sich ein wenig aufzurichten, - unten in der Tiefe bis hoch zum Horizont stand das Meer, darauf trieben einzelne Schaumkronen wie Möwen, - oder Möwen wie Schaumkronen, was kam es darauf an? - Die Böen, die die Oberfläche des Meeres fegten und kräuselten, zogen und zerrten an ihr, - sie verlor sich in diesen in die Ferne jagenden Böen. - Wie gefährlich das an ihr zog! - Und da kamen auch schon die Piratenschiffe, diese Korsaren, - sie würden sie natürlich finden, alle Verfolger fanden sie immer! - Sie mußte sich noch einmal zurücklegen, die schmerzenden spitzen Steine trösteten sie, so rieb sie ihren Rücken hin und her und hoffte auf kleine blutenden Wunden, einen kleinen Aderlaß, doch vergeblich! - nur ihre Bluse war in Gefahr.
Als sie die Augen zum Himmel hob und sah, wie die Wolken darin eine rosige Fleischfarbe annahmen, sich in Fetzen auflösten und zerstreuten, da mußte sie an den Kindesmord zu Bethlehem denken; - und wie sie so auf den scharfen Steinen lag, an einen gynäkologischen Stuhl; - ihre Abtreibung fiel ihr ein, zwei Jahre vor der Geburt ihres Kindes, - die also eingerahmt war von einer Abtreibung und einer Fehlgeburt zwei Jahre danach, - auch das hatte sie durchmachen müssen; wie fast jede erwachsene Frau ja ein totes Kind mit sich herumtrug, ein Kind noch im Werden, ohne Namen, ein kleines namenloses, noch unbenanntes Wesen. Mädchen waren es beide Male gewesen, sie hatte es wissen wollen, unbedingt, sie konnte nicht etwas ungeschlechtlichem Wesenlosen nachtrauern.
Vielleicht war es aber nicht gut gewesen, daß der Arzt ihrem Drängen nachgegeben hatte. Denn sie hatte damals sogar überlegt, den kleinen zerstückten Embryo sich geben zu lassen, konserviert, in einem Gläschen, um ihn richtig zu begraben. - Diese Abtreibung, die ihre Ehe ganz langsam zerstört hatte, wie sie dachte, langsam ihre Liebe in einen schleichenden Verfall verwandelt hatte.
Wie gut, daß Raphael, als Mann diese Seligkeiten einer Geburt und die Höllen einer Abtreibung oder Fehlgeburt, das alles, - nicht kannte, - oder kannte er es doch, wenigstens vom Hörensagen, von seiner Frau? - Denn verheiratet mußte er doch sein, das hatte sie sofort gemerkt.
Jetzt spürte Pauline einen Hauch frischen Windes, der vom Meer hochstieg, wahrscheinlich war es der Schirocco. Raphael tauchte am Rand ihres Blickfeldes auf, verzerrt, riesig, wie eine Statue von der Osterinsel, doch lebendig, - jetzt trat er vor die Sonne, blendete die Sonne aus, - jetzt trug er in seinen Haaren einen Heiligenschein, wie dieses groteske Mosaik im Dom, unten, im Normannendom, alles war dort grotesk, weil sie es nicht mehr verstehen konnten, und endlich fiel es ihr wieder ein, wie die Stadt da unten hieß, Cefalú.
In der Hand hielt Raphael einen Gesteinsbrocken, der silbrig schimmerte, - auch der aus den Wunden der Erde gerissen, in der anderen Hand eine weiße Rispe, - eine Totenblume hatte er ihr gepflückt, der Ahnungslose!
Sie sah, daß er den Mund bewegte, doch die Töne blieben bei ihm, dort oben. Sie lag unten in ihrer Gruft aus Geröll, aus Erzbrocken, aus Steinen, spitz wie Rosendornen, und wartete im Rosenhaag, wartete nun schon tausend Jahre, - und warum küßte er sie nicht wach? Küßte sie nicht lebendig? Hatten die Männer in den letzten siebenhundert Jahren denn alle Umgangsformen vergessen?
Er beugte sich jetzt über sie, - Nein, nein, nicht küssen!, - reichte ihr die Hand und zog sie hoch. Sie ließ sich gern helfen, mit einer vorsichtigen Langsamkeit stellte sie sich auf ihre eigenen Beine. Diese hielten noch stand, versagten ihr nicht den Dienst. - Mechanisch klopfte sie ihren Rock ab, kämpfte immer noch gegen die Übelkeit, gegen die Blendung aus dieser Sonne, die nun hinter seinem linken Ohr stand und es verkleinerte und verkrüppelte.
Er redete und einzelne Worte gelangten jetzt bis in ihr Bewußtsein.
„Zufrieden, so befriedigt - vielversprechend - sieh her!“
„Asphodelos,“, sagte sie, und meinte die Blume, die er ihr jetzt überreichte, „Der Proserpina geweiht.“
„Proserpina?“
„Die Schutzgöttin der Totengräber.“
„Und der Schatzgräber!“, ergänzte Raphael.
Aus dem Wagen holte er seine Thermosflasche, bot sie ihr an, gehorsam trank sie einige Schlucke. Heißer Kaffee war darin, so heiß, daß sie sich die Zunge verbrannte. „Ich möchte mich noch etwas ausruhen hier. Geh nur. Du kannst mich ruhig allein lassen.“
Raphael drang wieder auf dieser Felsen-Plattform vor, die, wie sie jetzt bemerkte, doch Spuren menschlichen Verkehrs trug, verrostete Blechdosen lagen verstreut herum, Nägel, Schrauben, der Stiel einer Hacke, leere Flaschen, verblichene, gelbe, fettige Papierbogen, hellere Zeitungsseiten anscheinend jüngeren Datums. - Alles Bewegliche und Leichte flatterte keck oder auch trostlos im Winde hin- und her, - rollte umher, aufblätternd, zuschlagend.
Irgend jemand mußte doch hier leben, zumindest ein Hund, denn ein düsteres Bellen hallte vom Echo vervielfältigt wider; dann aber schien es ihr, als ob dieses Gebell aus den Eingeweiden des Berges käme, aus einem jener niedrigen, schwarzen und bogenartigen Schachtmünder, die an die Eingänge antiker Gräber erinnerten. Ein Hund war also dort drinnen und bewachte den verborgenen Schatz. Ein Höllenhund!
Auf einmal beschlich Raphael das Gefühl, daß er beobachtet wurde. Er suchte mit den Augen die Umgebung ab, und entdeckte schließlich, daß er aus der Ferne von einer jungen Frau beobachtet wurde war; die ihn lange Zeit nicht aus den Augen ließ, und endlich aufstand und verschwand. Er entdeckte sie sogar noch einmal, während er fotografierte und maß; diesmal an einer anderen Stelle, hinter einer Pinie, an einen Felsen gelehnt, - aber wieder war sie so weit entfernt, daß er ihr Gesicht nicht erkennen konnte.
Raphael war etwas verwundert über diese Beobachtung, doch er maß ihr keine weitere Bedeutung zu und ging wieder zu Pauline,
„Ist dir nicht besser?“
„Doch!“, sagte Pauline, „Viel besser. Es war nur eine Kleinigkeit. Kein Grund zur Besorgnis.“ Hoffentlich hatte er nicht gemerkt, wie schlecht es ihr wirklich gegangen war!
„Na also!“, sagte er. - Gut!, sie ging also mit ihm. Da stand sogar ein Haus. Und Pauline mußte an den Witwer und an die Tochter, denken, von denen er gesprochen hatte, und als sie auf die Haustür blickte, war es ihr, als müßten sie dort sitzen, schwarz und traurig der Witwer, das Mädchen blaß vor Einsamkeit, mit dunklen, leuchtenden Augen, dahinter stehend der Sohn. Aber die Tür war verschlossen. Keine Menschenseele erschien.
Vorsichtig gingen sie um das Haus herum und als sie hinter das Haus gelangten, sahen sie einen großen Fleischerhund an einem roten Rolladen angebunden, der vor einem der Schachteingänge heruntergelassen war. Der Hund erhob sich beim Näherkommen der beiden Fremden mit wutenbrannten Augen auf die Hinterbeine empor, und fing an zu bellen, daraufhin trat ein alter Mann aus dem Haus und besänftigte das Tier mit leisen Worten und Streicheln.
„Sind Sie der Wächter der Grube?“, fragte Raphael. Anstatt einer Anwort machte der Alte eine zweideutige Gebärde mit der Hand. Was bedeutete das? Ja? - Nein? - Der Hund wedelte mit dem Schwanz und sah Raphael fest ins Gesicht, als ob er dessen Worte verstanden hätte. Raphael las ein Stück Schiefer auf und betrachtete es zerstreut, dann wandte er wieder seine Augen zum Wächter,
„Ist außer Ihnen niemand da?“ Der Alte sah sie mißtrauisch an, er murmelte grollend etwas Unverständliches, endlich hob er den Kopf und bequemte sich zu sagen,
„Man muß in die Ortschaft gehen, da hinten, und mit der Tochter des Besitzers reden.“ Da schien Raphael jedes weiteres Gespräch überflüssig, als aber der Alte sah, wie sie Anstalten machten, wegzugehen, hielt er ihn an,
„Sie hätten die Absicht, wegen der Grube zu verhandeln? Aber wissen Sie auch, was die Besitzer verlangen?“
„Das eben will ich gerade feststellen - und möchte mich nach ein paar anderen Dingen erkundigen.“
„Welche sind das?“
„Vor allem die gemachten Ausschachtungen, Abteufmaße, usw, - und die Resultate der Untersuchungen über die Qualität des Erzes, also des Blei- und Silbergehalts.“ Der Alte schien überrascht über die Zielsicherheit, mit der Raphael seine Fragen stellte, er sah ihn mit prüfenden Augen an, dann schnitt er eine Grimasse,
„Die Resultate?“ wiederholte er höhnisch, „Die waren so, daß der Besitzer nach kurzer Zeit ruiniert war.“
„Wann ist das gewesen?“
„Vor vierzehn Jahren.“
„Und hat sich später niemand gemeldet, um die Grube zu kaufen?“
„Erstens weiß man noch gar nicht, ob es sich um eine solche handelt, das heißt, bis zu welcher Tiefe die Ader silberhaltigen Bleis reicht.“
„Sonderbar,“, sagte Raphael, „aber ich sehe doch, daß bereits mehrere Schächte gegraben worden sind. - Und wo könnte ich den Besitzer finden?“ Der Alte brach das Gespräch mit einer raschen Gebärde ab, er bereute anscheinend, so viel gesprochen zu haben.
Er streckte den Arm gegen die Biegung eines Pfades aus, der sich in einem dunklen Eichenwäldchen verlor, und sagte,
„Die Ortschaft ist ganz in der Nähe. Gehen Sie hin und erkundigen Sie sich. Verlangen Sie nach der Familie Botello.“ Raphael versuchte eine letzte Frage,
„Sie sind nicht von hier?“ Der Alte antwortete nicht, sondern entfernte sich kopfschüttelnd und murmelte dabei etwas vor sich hin.
Raphael blickte ihm verblüfft nach, dann lachte er und sagte,
„Hier kann ich vielleicht etwas machen! Wollen wir gleich von hier aus ins Dorf gehen? Das scheint der Weg dorthin zu sein.“ und er wies mit der Hand in die Richtung, die ihnen der Alte angegeben hatte.
„Nicht heute!“ bat sie, „Bitte! Ich bin von der Fahrt noch vollkommen erschöpft! Diesen dunklen Pfad dort jetzt entlang laufen? Bitte nicht!“ - Oder etwa die Geröllpiste zum Dorf fahren!? Mit diesem niedrigen, tiefgelegten Auto? Das wollte sie auch nicht!
„Gut!“, sagte er, „Meinetwegen. Fahren wir zurück.“
„Ja!“, sagte sie, „ja, fahren wir, fahren wir!“ Wie war sie erleichtert, diesen unheimlichen Ort verlassen zu können! Und so machten sie sich auf den Rückweg zur Landstraße, wo sie das Auto hatten stehen lassen.