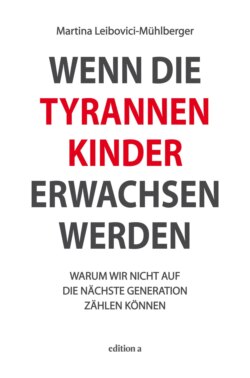Читать книгу Wenn die Tyrannenkinder erwachsen werden - Martina Leibovici-Mühlberger - Страница 8
Was heißt hier »fit for life«?
ОглавлениеWir haben einen Auftrag in Bezug auf unsere Kinder. Und auf den sollten wir uns bei aller Selbstinszenierung, eigener Bedürftigkeit nach Anerkennung und allem »modern sein Wollen« auch tunlichst besinnen. Er ist ziemlich simpel und wenn man selbst genügend erwachsen ist, auch durchwegs erfüllbar. Das Ganze basiert auf einem einfachen und grundsätzlich unauflöslichen Vertrag, der in dem Moment in Kraft tritt, in dem wir Kinder in die Welt setzen. Wir sind für sie verantwortlich und müssen sie »fit for life« machen. Wir müssen sie durch ihre Kindheit und Jugend begleiten, bis wir sie im jungen Erwachsenenalter endlich in die Unabhängigkeit entlassen können.
Das heißt, wir als Eltern, aber auch als Gesellschaft, sozialisieren das Kind durch die Vermittlung von Normen, Werten, situativen Verhaltensweisen oder Regeln und bringen ihm einen Verhaltenskodex bei, der es ihm ermöglicht, sich in die Gemeinschaft zu integrieren. Das alles unter Berücksichtigung der speziellen Talente des Kindes und seiner Individualität. Wir sprechen hier also von der Basis, dem gesellschaftlichen Alphabet, mit dem das Kind lernt, im Laufe der Zeit das Buch seines eigenen Lebens zu schreiben.
Das Ganze nannte sich früher, als man sich noch weniger darum bemühen musste, möglichst frühzeitig die beste Freundin oder der beste Freund seines Kindes zu werden, um als aufgeschlossene Mutter oder als aufgeschlossener Vater zu gelten, Erziehungsauftrag. Heute klingt das irgendwie sperrig, fast schon anrüchig, auf jeden Fall mühevoll, zäh und weniger cool, als sich den Minirock der vierzehnjährigen Tochter anzuziehen oder den Sprachstil des pubertierenden Sohnes zu übernehmen. Aber die Neuigkeit lautet: Man kommt aus diesem Vertrag nicht heraus!
Im Prinzip ist es ganz einfach: Eltern müssen kraft ihres Erfahrungsvorsprungs Führungs- und Orientierungskompetenz beweisen, also einfach Eltern sein, damit Kinder einfach Kinder sein und ihren Eltern (nach)folgen können. Das ist so simpel und hat sich über so viele Jahrtausende bis ins 21. Jahrhundert bewährt, dass man es als selbstverständliches Grundgesetz bezeichnen könnte. Die Alten geben die Regeln vor, tragen die Verantwortung für die Jungen, bringen ihnen alle Tricks und Kniffe bei und vermitteln ihnen, worauf es ankommt. Die Jungen hören zu, machen, da unsere Spezies bekanntlich höchst imitationsfreudig ist, alles nach und wachsen an der immer länger werdenden Leine der Alten immer mehr in eine schrittweise erprobte und damit auf einem soliden, selbstbewussten Fundament stehende junge erwachsene Existenz hinein. In der können sie dann von mir aus auch gerne alles umkrempeln, neu erfinden und frisch bewerten – sie sind dann ja erwachsen, sprich, mit planerischem und vorausschauendem Denken ausgerüstet und dadurch fähig, die Verantwortung für die Konsequenzen ihres Tuns zu tragen.
Bis hierher gibt es nahezu niemanden, der auch nur im Entferntesten etwas mit Kindern zu tun hat, der diese Überlegungen nicht nachvollziehen könnte. Trotzdem ist es wichtig, sich diese schlichte, allgemein verständliche Grundübereinkunft explizit vor Augen zu führen. Denn erst der Blick auf das Grundsätzliche führt zu der Einsicht, dass auch eine minimale Abweichung der Kompassnadel vom Kurs, wenn man sie lange Zeit toleriert, letztendlich zu einer ganz anderen Reiseroute und einem anderen Ziel als dem ursprünglich geplanten führt.
Obwohl so eindeutig feststeht, wie die Beziehung zwischen Eltern und Kindern beziehungsweise zwischen der Gesellschaft und der nächsten Generation aussehen soll – Eltern und Gesellschaft tragen die Verantwortung für das gedeihliche Aufwachsen der Kinder, die Kinder wiederum überlassen sich vertrauensvoll der Führung ihrer Eltern, und die liebevolle Verbundenheit, die auf unzähligen gemeinsamen Erlebnissen gründet, ist der Klebstoff für diesen nicht immer friktionsfreien Prozess –, liegt gerade hier das Problem. Denn unsere moderne Gesellschaft gibt zu diesem grundsätzlichen Auftrag nur ein Lippenbekenntnis ab und ignoriert ihn im Alltagsleben vollständig. Moderne Eltern führen ihre Kinder nicht mehr, sondern wollen Kumpel sein. Wer anderer Ansicht ist, gilt rasch als rückschrittlich oder autoritär.
Die Kinder ihrerseits rebellieren und sind ebenfalls nicht bereit, ihren Teil des Vertrags einzuhalten. Mit anderen Worten: Sie verweigern die Gefolgschaft und entwickeln stattdessen zum Teil recht obskur anmutende Wirklichkeitskonstruktionen, die für sie selber alles andere als förderlich sind.
Sabine konnte zum Beispiel nicht auf die Sportwoche ihrer Klasse mitfahren, weil es für sie einfach unvorstellbar war, ohne Kakaofläschchen einzuschlafen. Phillipps Biografie wird durch die Aktion mit dem Range Rover seiner Mutter eine nicht unerhebliche Delle abbekommen. Markus bewegt sich mit seiner konsequenten Hosenscheißerei geradewegs auf den sonderpädagogischen Schulzweig zu, in dem er dann vielleicht Georg treffen wird, der sich zu einer echten Struwwelpeter-Existenz entschlossen hat. Es gelingt dem mittlerweile Zehnjährigen seit drei Jahren, Kamm und Haarbürste seiner verzweifelten Mutter auszuweichen. Auch eine Haarwäsche kommt für ihn nicht infrage, weicht er Wasser und Seife doch grundsätzlich aus. Mit entsprechenden olfaktorischen Konsequenzen.
Diese Kinder und auch all die anderen, die für mich nach zahlreichen Fallanalysen wirken, als würden sie verwirrt und viel zu früh auf einer Lebensautobahn herumirren, die sie schwer überfordert, und die allesamt mit Recht in Form von Verhaltensauffälligkeiten, Spinnereien oder verrücktem Gehabe laut nach Orientierung schreien, nehmen eine ganze Menge in Kauf. Wir sollten ihre Botschaft endlich kapieren! Auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn es unsere Egos kränkt. Auch wenn unser Heiligenschein als berufstätige Karrierefrau und Mutter, die meint, alles unter einen Hut bringen zu können, verblasst. Auch wenn wir unsere Behauptung, dass wir im Unterschied zum eigenen Erzeuger ja ein echter Vater für unsere Kinder sind, ehrlich hinterfragen und auf den Prüfstand stellen müssen. Auch wenn wir uns fragen müssen, welche Botschaften wir unseren Kindern in dieser bequemen, hauptsächlich auf Konsumerlebnisse und Umsatz ausgerichteten Gesellschaft tagtäglich vermitteln.
Und auch wenn das alles unbequeme Stunden verspricht, so müssen wir die Botschaft trotzdem verstehen. Das schulden wir all diesen Kindern mit ihren gemarterten Seelen, die verwirrt und angstvoll nicht nur durch psychotherapeutische Sprechzimmer (oder auch nur durch ihre Klassenzimmer und Kindergartengruppen), sondern auch durch ein Universum treiben, das sie nicht verstehen und dabei ihre Kräfte aufzehren. Entwicklungsverzögert, sozial unangepasst bis schlecht integrierbar, leistungsverweigernd, wehleidig, permanent auf der Suche nach Reizen, konsumorientiert, aggressiv, depressiv und im schlimmsten Fall autodestruktiv und vor allem weit davon entfernt, ihr Potenzial zu entwickeln.
Wir schulden diesen Kindern eine genaue und unbarmherzig schonungslose Aufdeckung, was hier gesellschaftlich eigentlich schiefläuft. Auch wenn es uns danach peinlich sein sollte, unserem Spiegelbild mit seinem falschen Erfolgsgrinsen zu begegnen. Denn genau das tun unsere Kinder – sie halten uns einen Spiegel vor Augen. Dabei schreien sie, so laut sie können. Sie haben recht damit. Denn wir lassen sie jetzt, in ihren Kindertagen, im Stich. Die Rechnung dafür werden sie uns präsentieren, wenn sie erwachsen sind und sich von uns abwenden.
Und jetzt überprüfen Sie ganz schnell noch einmal, ob Sie weiter lesen wollen oder den Impuls empfinden, diesen Text einfach zuzuschlagen.