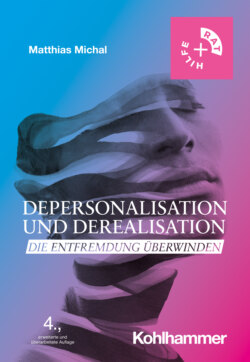Читать книгу Depersonalisation und Derealisation - Matthias Michal - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.4 Persönlichkeitsstörungen
ОглавлениеDas Wort Persönlichkeitsstörung hört sich für Laien meist schrecklich an. Aber auch viele meiner Kollegen haben aus den gleichen Gründen Probleme mit dieser Diagnose. Sie scheuen dann davor zurück, die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung zu vergeben oder Patienten über die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung aufzuklären. Das Wort Persönlichkeitsstörung kann – zu Unrecht – das demoralisierende Gefühl auslösen, bis in den Grund der Persönlichkeit »gestört« oder »kaputt« zu sein. Eigentlich steht der Begriff der Persönlichkeitsstörung aber für eine seelische Krankheit, die sich durch bestimmte, über mehrere Jahre bestehende Verhaltens-, Gefühls- und Denkmuster auszeichnet, unter denen der Betroffene leidet und die zu einer Beeinträchtigung im sozialen, beruflichen und zwischenmenschlichen Leben führt. Diese »Krankheit« ist nicht angeboren, sondern letztendlich das Ergebnis einer Anpassung des Individuums an seine frühen – meist sehr belastenden – Entwicklungsbedingungen. Auch wenn das angeborene Temperament, wie z. B. Sensibilität und Angstbereitschaft, für die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung eine Rolle spielt, sind aber die Umweltbedingungen entscheidend. Das heißt mit anderen Worten, dass die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung nicht die Natur oder das innere Wesen einer Person beschreibt, sondern etwas, das sich über die eigentliche Person darübergelegt hat. Manche Psychotherapeuten nennen dies auch ein »falsches Selbst« oder »Charakterpanzer«. Beispielsweise sind viele Persönlichkeitsstörungen durch chronische Minderwertigkeitsgefühle gekennzeichnet. Sich minderwertig zu fühlen, ist aber nicht das Wesen des Menschen, sondern eine Reaktion auf langanhaltende Erfahrungen, die den eigenen Selbstwert beschädigt haben oder besser gesagt, Mechanismen in Gang gesetzt haben, die ständig das eigene Selbstwertgefühl angreifen. Diese Minderwertigkeitsgefühle lassen sich aber durch die Bearbeitung der krankmachenden Mechanismen und neue Beziehungserfahrungen auflösen.
Persönlichkeitsstörungen sind nicht selten. In der Allgemeinbevölkerung leiden etwa 12 % an einer Persönlichkeitsstörung (Volkert et al. 2018). Patienten, die sich wegen seelischer Erkrankungen in Behandlung befinden, weisen zu 50 % und mehr die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung auf. Persönlichkeitsstörungen erfordern eine Langzeitpsychotherapie im Umfang von mindestens 50–100 Stunden über 2–3 Jahre. Persönlichkeitsstörungen haben, wenn sie nicht behandelt werden, einen relativ stabilen zeitlichen Verlauf. Vor dem 14. Lebensjahr lassen sich Persönlichkeitsstörungen nicht diagnostizieren. Die Probleme beginnen aber meistens schon in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter.
Die zentralen diagnostischen Dimensionen von Persönlichkeitsstörungen sind Beeinträchtigungen in den Bereichen der Identität, der Selbststeuerung, der Empathie und der Fähigkeit zur emotionalen Nähe (APA 2013, DSM-5). Ein gesundes Identitätsgefühl steht für ein robustes Selbstwertgefühl, eine klare Vorstellung von sich selbst, die Fähigkeit auch unter Stress mit anderen Menschen in emotionaler Verbindung zu bleiben und das gesamte Spektrum an Emotionen wahrnehmen und gesund damit umgehen zu können. Selbststeuerung betrifft die Fähigkeit, realistische Ziele längerfristig zu verfolgen, die Orientierung an klaren inneren Werten und Maßstäben, die Fähigkeit über die eigenen Gedanken, Gefühle, Wünsche und Absichten nachzudenken (ohne sich dabei von den eigenen Gefühlen abzutrennen). Empathie ist die Fähigkeit, sich auf die Gefühle und Absichten anderer einstellen zu können und dabei ein realistisches Bild vom anderen zu haben, ohne dass man dem anderen eigene Vorstellungen (Befürchtungen, Gefühle etc.) überstülpt. Dazu gehört auch die Fähigkeit, andere Sichtweisen gelten lassen zu können und die Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere abschätzen zu können. Nähe steht für die Fähigkeit, positive Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten zu können im privaten und beruflichen Bereich. Menschen sind soziale Wesen und haben von Natur aus das Bedürfnis nach Verbundenheit. Das Überleben der Menschen ist auch auf die Fähigkeit zur Kooperation angewiesen. Das heißt die Fähigkeit, den gegenseitigen Nutzen wahrnehmen und verfolgen zu können. Eine bedeutsame Beeinträchtigung in den Funktionsbereichen der Identität, Selbststeuerung, Empathie und Nähe ist das zentrale Merkmal aller Persönlichkeitsstörungen. Jeder kann sich vorstellen, dass eine relevante Beeinträchtigung in diesen Bereichen zu viel Leid führt. Die Schwere der Funktionsbeeinträchtigung in diesen vier Bereichen, und hier vor allem im Bereich der Identität, ist wichtig für die Prognose und damit für die Behandlungsplanung (Buer Christensen et al. 2020). Neben der Beeinträchtigung dieser Funktionsbereiche, liegen bei Persönlichkeitsstörungen noch andere Merkmale vor, die relativ leicht beobachtet werden können: Negative Affektivität (z. B. Nervosität, Anspannung, Trennungsängstlichkeit, Depressivität, Misstrauen, Unterwürfigkeit); Verschlossenheit (sozialer Rückzug, Vermeidung von Nähe), Antagonismus (z. B. Feindseligkeit); Enthemmtheit (Impulsivität, Perfektionismus) und Psychotizismus (Denk- und Wahrnehmungsstörungen etc.).
Nachfolgend werden auf Grundlage des ICD-10 die Kriterien derjenigen Persönlichkeitsstörungen beschrieben, die bei der DDS am häufigsten sind. Es sei aber darauf hingewiesen, die meisten Personen, die die o. g. Funktionsbeeinträchtigungen aufweisen, nicht die Schublade einer spezifischen Persönlichkeitsstörung passen. Sie werden dann als »kombinierte« oder »nicht näher bezeichnete« Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.