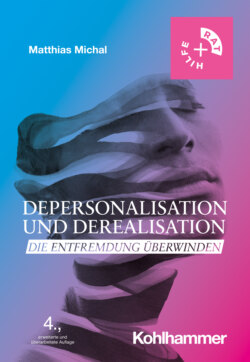Читать книгу Depersonalisation und Derealisation - Matthias Michal - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
1 Was ist Depersonalisation und Derealisation?
»Zunächst eine kurze Definition dessen, was wir als Depersonalisation bezeichnen. Ich verstehe darunter einen Zustand, in dem das Individuum sich gegenüber seinem früheren Sein durchgreifend verändert fühlt. Diese Veränderung erstreckt sich sowohl auf das Ich als auch auf die Außenwelt und führt dazu, dass das Individuum sich als Persönlichkeit nicht anerkennt. Seine Handlungen erscheinen ihm automatisch. Er beobachtet als Zuschauer sein Handeln und Tun. Die Außenwelt erscheint ihm fremd und hat ihren Realitätscharakter verloren. […] Verändert ist nicht das zentrale Ich, das Ich im eigentlichen Sinne, verändert ist vielmehr das Selbst, die Persönlichkeit, und das zentrale Ich nimmt jene Veränderung im Selbst wahr« (Schilder 1914, S. 54).
Diese treffende Definition der Depersonalisation stammt aus der Monografie »Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsbewusstsein«, die 1914 von Paul Ferdinand Schilder (* 15. Februar 1886 in Wien; † 7. Dezember 1940 in New York), einem österreichischen Psychiater, Neurologen und Psychoanalytiker veröffentlicht wurde. Paul Schilder gilt als einer der wichtigsten Depersonalisationsforscher bis in unsere Zeit.
Paul Schilder beschreibt die Depersonalisations-Derealisationsstörung als eine durchgreifende Veränderung der Wahrnehmung der eigenen Person und der Außenwelt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man in seinem Handeln und Tun nicht mehr aufgeht, sich dies nicht mehr zu eigen macht, sondern nur noch wie ein Zuschauer teilnimmt. In seinem Buch lässt er in zahlreichen Krankengeschichten nicht nur Patienten ausführlich zu Wort kommen, teilweise in direkter Rede, sondern er berichtet auch von eigenen Depersonalisationserlebnissen im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholgenuss oder Erschöpfung in einer Psychotherapiesitzung:
»In leicht berauschtem Zustand (nach reichlich Weingenuss) überkommt mich ein eigenartiges Gefühl. Die Umgebung erscheint (innerlich) fern gerückt und von einem anderen, der nicht vollständig ich ist, wahrgenommen, und ich und die Stimme dessen, der mit mir spricht, ist fremd. Der Gang ist verändert und ungewohnt. Ich komme mir leicht und schwebend vor (soweit ich weiß, waren objektive Störungen nicht vorhanden). Die Gefühle sind gleichsam ferngerückt und von mir beobachtet. Wenn ich spreche und gehe, so beobachte ich mein Sprechen und Gehen« (Schilder 1914, S. 95).
»Als ich vormittags eifrig mit Arbeit beschäftigt war, kommt mein Patient X. zu mir, […]. Er erzählt mir Dinge, die ich schon oft gehört habe. Plötzlich höre ich meine Stimme wie die eines anderen und habe nicht den Eindruck selbst zu sprechen, obwohl ich ziemlich Kompliziertes leicht und sinngemäß beantwortete. Es ist alles in eine andere Sphäre gerückt. Seine Worte stören mich und klingen mir etwas laut ins Ohr. Er selbst kommt mir eigenartig und fremd vor, etwas starr und seltsam. Bald erscheint er mir etwas größer, bald etwas kleiner, meist aber innerlich etwas ferner gerückt. Die übrigen Gegenstände des Raumes gehen nicht gleichartige Veränderungen ein. Mein Körper erscheint mir nicht verändert, ich fasse absichtlich nach meiner Hand, nur habe ich das Gefühl, dass meine Miene etwas scharf sei. Die ganze Situation ist nicht gerade angenehm. Gesamtgefühl des Unwillens und Ärgers. – Während der ganzen Beobachtung entschwindet mir durchaus nicht das Bewusstsein, dass ich es bin, der hört und spricht, wiewohl ein eigenartiges ›Als-ob-ich-es nicht-wäre‹ vorhanden ist« (Schilder 1914, S. 94).
Depersonalisation (DP) und Derealisation (DR) sind normale Reaktionsmöglichkeiten. Diese Phänomene sind genauso menschlich wie das Erleben von Fieber, Schmerz, Angst oder Wut. Diese Zugehörigkeit der Depersonalisation zu den allgemein menschlichen Erlebnismöglichkeiten zeigt sich auch in unserer Alltagssprache, wo Phänomene der Depersonalisation als Redensarten ihren Niederschlag gefunden haben. Wir sprechen vom »benebelt sein«, wenn jemand sich verwirrt oder angetrunken fühlt, oder vom »neben sich stehen«, wenn einer sich als überwältigt und fassungslos erlebt. Als Redensarten werden diese Beschreibungen meist aber nur symbolisch verwendet, ohne dass der Sprecher damit sagen will, dass er sich, wie in der Depersonalisation, tatsächlich so wahrnimmt, »als ob er neben sich stehe« oder »als ob er wie durch eine Art von Nebel oder Schleier« von seiner Umwelt abgetrennt sei.
Bevor wir aber uns eingehender mit den Ursachen der Depersonalisation (und Derealisation) beschäftigen, möchte ich genauer beschreiben, was eigentlich unter Depersonalisation und Derealisation verstanden und wie das Krankheitsbild der Depersonalisations-Derealisationsstörung definiert wird. Der Einfachheit halber verwende ich nachfolgend die Abkürzung DDS für die Depersonalisations-Derealisationsstörung bzw. das Depersonalisations-Derealisationssyndrom.
Auf welche Art und Weise ist nun in der Depersonalisation und Derealisation die Wahrnehmung des Selbst (→ Depersonalisation, DP) und der Umwelt (→ Derealisation, DR) verändert. Typischerweise finden sich Betroffene in den folgenden Aussagen wieder ( Kasten 1.1), die dem Fragebogen »Cambridge Depersonalisation Scale« entnommen sind (Michal et al. 2004, Sierra und Berrios 2000)2 .
Kasten 1.1: Items der Cambridge Depersonalization Scale (CDS)
• Aus heiterem Himmel fühle ich mich fremd, als ob ich nicht wirklich wäre oder als ob ich von der Welt abgeschnitten wäre.
• Was ich sehe, sieht »flach« oder »leblos« aus, so als ob ich ein Bild anschaue.
• Vertraute Stimmen (einschließlich meiner eigenen) klingen entfernt oder unwirklich.
• Ich erlebe mich wie abgetrennt von meiner Umgebung oder diese erscheint mir unwirklich, so als ob ein Schleier zwischen mir und der äußeren Welt wäre.
• Es kommt mir vor, als ob Dinge, die ich kürzlich getan habe, bereits lange Zeit zurücklägen. Zum Beispiel etwas, was ich heute Morgen getan habe, kommt mir vor, als ob ich es bereits vor Wochen gemacht hätte.
• Ich komme mir wie abgetrennt von Erinnerungen an Ereignisse meines Lebens vor, so als ob ich nicht daran beteiligt gewesen wäre.
• Es kommt mir vor, als ob ich mich außerhalb meines Körpers befände.
• Wenn ich mich bewege, habe ich nicht den Eindruck, dass ich meine Bewegungen steuere, sodass ich mir »automatenhaft« und mechanisch vorkomme, als ob ich ein »Roboter« wäre.
• Ich muss mich selbst anfassen, um mich zu vergewissern, dass ich einen Körper habe und wirklich existiere.
Wie man an dieser Auflistung sieht, können in der Depersonalisation sämtliche Bereiche des Selbsterlebens betroffen sein. Dabei steht Depersonalisation (DP) für die veränderte Wahrnehmung des körperlichen und seelischen Selbst, Derealisation (DR) hingegen für die veränderte Wahrnehmung der Umwelt. In der älteren psychiatrischen Literatur finden sich die Fachbegriffe autopsychische Depersonalisation, womit die veränderte Wahrnehmung der eigenen Gefühle, der Erinnerungen und des Vorstellungsvermögens gemeint ist. Somatopsychische Depersonalisation steht für die veränderte Wahrnehmung des Körpers (z. B. sich abgelöst vom Körper fühlen, wie hinter oder neben mir stehend, wie aufgelöst, so als ob ich nur noch aus Augen bestünde, hohl, nur eine Hülle, ganz federleicht usw.). Die sogenannte allopsychische Depersonalisation steht für die veränderte Wahrnehmung der äußeren Welt, die heute als Derealisation bezeichnet wird (»mir kommt alles künstlich wie ein Bild vor, unecht, zweidimensional, wie eine Kulisse«; »ich fühle mich wie in der Truman-Show«, »wie in Matrix3 «). Da Depersonalisation und Derealisation sehr eng zusammenhängen und meist auch gemeinsam auftreten, wird der Kürze halber in der Literatur, und so auch hier, Depersonalisation als der beide Phänomene umfassende Oberbegriff verwendet (Michal und Beutel 2009).
Ein weiterer Begriff, der in der Literatur oft im Zusammenhang mit der Depersonalisation auftaucht, ist derjenige der Dissoziation oder dissoziativen Störung. Man versteht darunter eine Gruppe von Erkrankungen, deren gemeinsames Kennzeichen »der teilweise oder völlige Verlust der normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der unmittelbaren Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen« ist (vgl. ICD-104 : F44). Beispiele für dissoziative Störungen sind z. B. die dissoziative Amnesie. Deren wichtigstes Kennzeichen ist »der Erinnerungsverlust für meist wichtige, kurz zurückliegende Ereignisse, der nicht durch organische psychische Störungen bedingt und zu schwerwiegend ist, um durch übliche Vergesslichkeit oder Ermüdung erklärt werden zu können. Die Amnesie zentriert sich gewöhnlich auf traumatische Ereignisse wie Unfälle oder unerwartete Trauerfälle und ist in der Regel unvollständig und selektiv. Ausmaß und Vollständigkeit der Amnesie variieren häufig von Tag zu Tag und bei verschiedenen Untersuchern« (vgl. ICD-10: F44.0). Am Beispiel der seelischen Funktion des Gedächtnisses bzw. des Erinnerns lässt sich sehr gut der Unterschied zwischen einer dissoziativen Amnesie und der Depersonalisation aufzeigen. Bei der dissoziativen Amnesie hat der Betroffene keinen Zugriff mehr auf die Informationen in seinem Gedächtnisspeicher. Er weiß z. B. nicht mehr, was er die letzten Tage gemacht hat, wohingegen bei der Depersonalisation die gefühlsmäßige Einstellung zu den Gedächtnisinhalten verändert ist. Bei einer Depersonalisations-Derealisationsstörung kann sich der Betroffene noch an die Tatsachen und Fakten erinnern, aber es kommt ihm so vor, als ob die Geschehnisse sehr weit zurückliegen, ja fast so weit, als ob das Erlebte eigentlich gar nichts mehr mit ihm selbst zu tun hätte.
2 Unter den Zusatzmaterialien finden Sie mehrere Fragebögen zur Erfassung der Depersonalisation und Derealisation.
3 Die »Truman-Show« ist ein Spielfilm, bei dem der Protagonist in einer Filmkulisse lebt, ohne es zu wissen. In dem Spielfilm »Matrix« wird u. a. die Frage nach der Wirklichkeit thematisiert.
4 Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis (2004). Bern: Huber