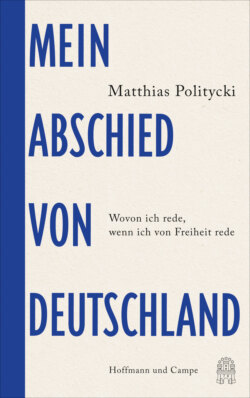Читать книгу Mein Abschied von Deutschland - Matthias Politycki - Страница 4
ОглавлениеDeutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen so gründlich zu betreiben, bis alle schlechte Laune haben. Das war schon immer so, oder jedenfalls immer mal wieder. Trotzdem war ich mein Leben lang auf eine, heute würde man vielleicht sagen: postnationale Weise gern ein Deutscher und habe mich in Deutschland zu Hause gefühlt.
Doch vor einem Jahr war das Maß dann voll. Als einer, der von der Freiheit des Gedankens und der Schönheit der Sprache als seinen täglichen Grundnahrungsmitteln lebt, hatte ich genug von kuratierter Wortwahl und vorstrukturierten Haltungsketten, wollte nicht länger zusehen, wie sich die Debattenräume Tag für Tag verengten. Und zog nach Wien. Ich wollte eine Grenze zwischen mir und all dem wissen, was mir die Freude am öffentlichen Gespräch und schließlich die am Schreiben verdorben hatte.
Wien ist freilich nicht aus der Welt, die Debatten, die ich eigentlich hatte verlassen wollen, holten mich wieder ein. Wenn es nach den Broschüren gehen sollte, die von den städtischen Behörden für ihre Mitarbeiter herausgegeben werden, will man hier sogar die Schafe gendern – als »tierische MitarbeiterInnen« –, offenbar um keine Hammel zu diskriminieren. Auf Nachfrage läßt der Bürgermeister jedoch über sein Büro versichern, daß ihm diese Broschüre nicht geläufig sei.[2] Nicht etwa »nicht bekannt«! Sondern halt »nicht geläufig«. Das ist Wien. Dieselben Themen wie in Berlin, aber kräftig abgemildert durch einen komödiantischen Einschlag und durch kultivierte Renitenz an der entscheidenden Stelle. Und ansonsten übrigens auch durch den alles beherrschenden Konjunktiv, eine Kulturerrungenschaft des gesamten deutschsprachigen Südens, die weit über das rein Sprachliche hinausgeht und manches erträglicher macht, was man in der Unerbittlichkeit indikativischer Verlautbarungen kaum auszuhalten glaubt.
Schon seit einigen Jahren fühlte ich mich in Deutschland nicht mehr wohl. Zunächst war es nichts weiter als ab und an ein plötzliches Unbehagen, und weil ich einen Großteil meiner Zeit in Asien, Afrika oder sonstwo verbrachte, vergaß ich es schnell. Nach meiner Rückkehr stellte es sich jedoch verläßlich wieder ein. Irgendwann war es dauerhaft präsent, kein vorübergehendes Unbehagen mehr, sondern schleichende Bedrückung. Erst mit Verhängung des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020, der mich in deutschem Alltag, deutscher Befindlichkeit und deutschen Diskursen festsetzte, wurde mir klar, was mir seit Jahren abhanden gekommen war: die beruhigend selbstverständliche Gewißheit, in einem der freiesten Länder zu wohnen, in das ich von jedweder Ecke der Welt immer gern zurückgekehrt war.
Kann es sein, fragte ich mich, daß die grenzenlose Freiheit, wie wir sie noch in den Debatten der Neunzigerjahre genossen, verloren gegangen ist? Damals hatte ich sie gar nicht sonderlich geschätzt, nicht einmal als solche erkannt. Die Freiheit der Meinung, die Freiheit der Sprache, die Freiheit der Kunst waren nicht nur verbürgte Grundrechte einer demokratischen Gesellschaft, sondern wurden auch lustvoll und ohne gegenseitige Verdächtigungen oder Diskreditierungen bis an Tabugrenzen und gelegentlich sogar darüber hinaus ausgeschöpft.
Heute erlebe ich immer öfter Situationen, in denen sich einer empört, weil ein anderer irgendwas gesagt hat, oder eigentlich: weil er es auf eine Weise gesagt hat, die dem einen nicht paßt, oder ganz eigentlich: weil er es vielleicht so gesagt haben könnte, wenn man den Quellen Glauben schenkt, und weil allein der Verdacht Anlaß genug ist, sich von ihm zu distanzieren. Dabei geht es oft nur um ein einziges Wort, offensichtlich ist es einem Verdikt anheimgefallen. Aber was heißt »nur«? Jedes Wort ist Teil der Sprache, in der ich schreibe. Hier verschwinden Bausteine meines Arbeitsmaterials, das macht mich umso hellhöriger. Gleichzeitig driften Teile unsrer Gesellschaft weiter und weiter auseinander, zunächst hören sie einander nicht mehr zu, irgendwann scheinen sie sich zu verachten, schließlich zu hassen. Daß einem Gemaßregelten kurzerhand das Recht abgesprochen wird, sich öffentlich zu äußern, ist inzwischen schon eine freundliche Form der Ausgrenzung. Besonders perfide, wenn sie sich als Ratschlag tarnt und pastorenhaft vorgibt, sie wolle eine arme Seele von ihrem schlechteren Selbst erretten, wo sie sie doch in Wirklichkeit verdammt.
Nachdem ich meinen Abschied von Deutschland in der FAZ begründet hatte,[3] meldeten sich auch bei mir ein paar Wokisten und versuchten, mich gönnerhaft über meine neue Heimat zu belehren (»fast schon sowas wie Ungarn«) und dabei nonchalant auszugrenzen. Offenbar wußten sie nicht, daß »das Rote Wien« auch nach 1945 ununterbrochen von der SPÖ regiert wurde. Ihre Mails machten mir noch einmal klar, wie richtig es war, dem deutschen Debattensumpf zu entfliehen: nicht nur den Scharfmachern, sondern auch den opportunistischen Mitläufern. Letztere sind im Grunde nichts weiter als eine neue Version des Spießers. In ihrem permanenten Pochen auf Moral und Anstand ähneln sie den Sittenwächtern der Nachkriegszeit, auch wenn sie sich in ihrer Selbsteinschätzung als deren »linkes« Gegenteil wahrnehmen.
Wenn es demnächst vielleicht auch eine »MeToo«-Bewegung gibt, in der sich Opfer von Stigmatisierung und Ausgrenzung melden, so ist dies schon mal mein Beitrag. J’accuse …? Eher: Ab dafür!