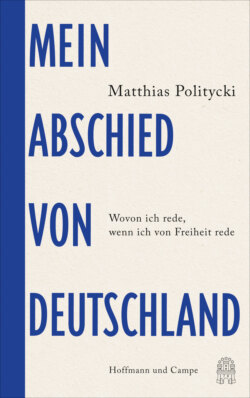Читать книгу Mein Abschied von Deutschland - Matthias Politycki - Страница 9
»Bleib erschütterbar und widersteh« –
Оглавление– so heißt eines der bekanntesten Gedichte von Peter Rühmkorf,[13] der sich immer auch als politischer Dichter begriff. Das Gedicht, das er in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts schrieb, betont – bei aller grundsätzlichen Widerstandskraft – das Verletzbare einer jeden Haltung, sofern sie offen für die Haltung eines anderen ist. Die Überschrift des Gedichts ist im Lauf der Jahre eine Art Credo für mich geworden, die kürzeste Zusammenfassung meiner politischen Selbstverortung.
Heute hätte Rühmkorfs Botschaft keine Chance mehr, heute herrscht die Devise: »Zeig bei jeder Gelegenheit Erschütterung und empör dich.« Haltung zu zeigen dient nicht mehr nur der Markierung einer Demarkationslinie, die im Lauf einer Diskussion in beide Richtungen wieder durchlässig werden kann. Haltung zu zeigen meint allzuoft leider nichts als bloß, »klare Kante« zu zeigen, und dient der Abschottung des eigenen Terrains, von dem aus die Gegenseite unter Dauerfeuer gehalten wird.
Die allzeit bereite und bei kleinstem Anlaß aufbrausende Empörungslust erscheint mir als überaus bequeme Methode, sich all dessen zu entledigen, was nicht ins eigne Weltbild paßt und über das man nicht neu nachdenken will. Beglaubigt wird die Empörung durch zur Schau gestellte Scham, es ist die deutsche Form der Selbstgefälligkeit. Empörung und Scham sind die großen Vereinfacher des Diskurses, des Weltbilds, des Alltags.
Direkte Auseinandersetzungen mit Wokisten, etwa in Podiumsdiskussionen, verlaufen in der Regel wie Dialoge des absurden Theaters. Konfrontiert man sie mit Fakten, streiten sie diese rundheraus ab und präsentieren ihre alternativen Fakten. Im Namen der »Diversität« stellen sie Meinungen, die im Vergleich zu den ihren tatsächlich divers ausfallen, grundsätzlich in Frage und diskreditieren sie mit der drolligen Standardreplik, man habe das Problem offensichtlich nicht verstanden. Oder mit der Standarddiagnose, man sei »strukturell« vorbelastet qua Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, Alter. Man ängstige sich offenbar vor Neuerungen; ärgere sich darüber, daß man Privilegien preisgeben oder Sprachroutinen aufgeben müsse; man sei halt »noch nicht so weit«. Damit verlagern sie die Auseinandersetzung von der sachlichen auf die emotionale Ebene, wo man Gegenargumente als bloßen Reflex abtun kann. Oder sogar als Symptom einer psychischen Störung, als Transphobie, Islamophobie, Xenophobie, Misogynie.
Ob die Parteigänger der neuen Erregungskultur zurückfinden werden zur Streitkultur? So, wie sie sich derzeit in öffentlichen Veranstaltungen geben, interessiert sie eine intellektuelle Auseinandersetzung nicht, sie sind mit sich und ihresgleichen im Reinen. Immanuel Kant geht mit diesem Typus Mensch hart ins Gericht. In seinen »Zerstreuten Anmerkungen« zu den Gemütskrankheiten beschäftigt er sich mit den Formen der Unvernunft und dem »Verdacht: daß es mit jemandes Kopf nicht richtig sei«. Er kommt zu dem Schluß:
Das einzige allgemeine Merkmal der Verrücktheit ist der Verlust des Gemeinsinnes (sensus communis) und der dagegen eintretende logische Eigensinn (sensus privatus) […]. Denn es ist ein subjektivnotwendiger Probierstein der Richtigkeit unserer Urteile überhaupt und also auch der Gesundheit unseres Verstandes: daß wir diesen auch an den Verstand anderer halten, nicht aber uns mit dem unsrigen isolieren, und mit unserer Privatvorstellung doch gleichsam öffentlich urteilen.[14]
Wie zum Beleg dieses Zitats versichern Wokisten gern, sie verstünden die ganze Aufregung in diesem Lande nicht; es seien ja nicht sie, die anderen etwas verbieten und sie mundtot machen wollten, im Gegenteil, es sei genau andersherum. Jeder solle so leben, wie er möge, jeder so sprechen, wie er wolle, niemand habe die Absicht, eine Sprachregelung zu erlassen. In ihrem postintellektuellen Narzißmus sind sie über jeden Selbstzweifel erhaben.
Manche von ihnen, ebensowenig neugierig auf die Meinung von anderen, gehen aggressiver vor. Von Anfang an bringen sie ihre Gesprächspartner oder eigentlich -gegner in eine Verteidigungshaltung und versuchen, sich so die Diskurshoheit zu sichern. Etwas Halbherziges wie ein Kompromiß ist damit ausgeschlossen, es geht um Vernichtung oder Unterwerfung. Die Unterwerfung beginnt damit, daß der Gegner das korrekte »Wording« benutzen soll, um überhaupt mitreden zu können. Permanent mit der Abwehr von Vorwürfen beschäftigt und in Rechtfertigungsnöten formalistischer Art gehalten, ist eine Auseinandersetzung in der Sache nicht möglich.
Die Strategie erinnert mich an die der maoistischen K-Gruppen im Gefolge der 68er-Revolution, deren späte Nachfahren ich während meiner kurzen Zeit als Assistent an der Münchener Universität noch erlebt habe. Weil zum ersten Mal seit Jahrzehnten Nietzsche auf dem Lehrplan der Germanistik stand, war der Andrang so groß, daß aus einem Seminar eine Vorlesung gemacht werden mußte. Mitglieder der vielleicht allerletzten K-Gruppe reisten dazu extra aus Stuttgart an. Jedes Mal stand nach wenigen Minuten einer auf und monologisierte lautstark. Um ein Gespräch ging es zu keinem Zeitpunkt, sie wollten nur ihre Gruppenperformance darbieten, indem sich einer nach dem andern erhob und seinen Redeteil abspulte. Dabei verwandten sie ihr eigenes Vokabular und räsonierten auf eine Weise, der man nicht beikommen konnte, weil ihre Argumente nicht der herkömmlichen Logik folgten. Das Weltbild der K-Gruppe war ein in sich geschlossenes System, das man nur ganz zu fassen bekam oder gar nicht. Im Grunde war es den Stuttgarter Kadern völlig egal, was ich ihren rhetorischen Pirouetten entgegenhielt. Sie waren als Instruktoren gekommen, nicht als Diskutanten. Und obwohl an die hundertfünfzig Studenten sichtlich genervt davon waren, wagte keiner, das Wort gegen sie zu erheben. »Es wird Zeit, daß ihr verschwindet«, raunzte ich sie schließlich selber an, als ich sie vor der dritten Vorlesung an der Eingangstür stellen konnte. Erstaunlicherweise sicherten sie mir sofort zu, es mit diesem Besuch auf sich bewenden zu lassen.
Vielleicht erleben wir ja gerade die Anfänge eines neuen, woken 68. Diskussionen mit Vertretern von Identitätspolitik, Gendergerechtigkeit und politischer Korrektheit, soweit ich sie bislang verfolgt habe, verlaufen jedenfalls meist nach ähnlich selbstreferentiellem Grundmuster: Sofern man sich durch Argumentation widersetzt, wird nicht etwa mit Gegenargumenten gekontert, sondern mit Varianten der immergleichen Zurechtweisungen. Wer Meinungskorridore beklagt, wird bezichtigt, Verschwörungstheorien zu verbreiten; wer sich besorgt über unkontrollierte Migration äußert, wird als Rassist in die rechte Ecke geschoben; wer die Frauenquote ablehnt, als frauenfeindlich.
Beschimpfungen kenne ich auch von früher. Das Besserwisserische, Überhebliche, Hochfahrende bei jeder Gelegenheit ist neu. Damals reichte es, sich im Recht zu wissen. Heute soll der andere als schlechter Mensch enttarnt werden – Burkhard Spinnen spricht von »moralischer Habgier«.[15] Damit verschreckt man gerade die intellektuell differenzierten und womöglich wichtigsten Gesprächspartner. Auch diese machen eine Gesellschaft »bunt«, die Denker zwischen den sattsam bekannten Positionen, die Schrägen, die auch mal was raushauen, das noch nicht total abgehangen ist und das dann vielleicht auch mal daneben geht.
Ausgegrenzt wird fast bei jeder Gelegenheit, und stets mit dem Bekenntnis zur offenen Gesellschaft. Damit Freund und Feind schnell zu unterscheiden sind, werden komplexe Sachverhalte für den Alltagsgebrauch emotionalisiert und auf wohlfeile moralische Bekenntnisse reduziert. Und diese wiederum in alle möglichen Entscheidungen hineininterpretiert, die wir im Verlauf eines Tages en passant treffen. In den Augen eines kritischen Beobachters entscheiden wir uns jedes Mal nicht nur für, sondern damit auch immer gegen etwas. Und eben nicht erst mit unseren Handlungen, sondern schon mit der Wahl unsrer Worte: Wer eine Veggie Bowl bestellt, hat das Gegenteil eines Steaks geordert; wer Old-School-mäßig von »Rücksicht auf unsre Mitmenschen« spricht, vermeidet offensichtlich ein Bekenntnis zur »Achtsamkeit«.
Daß nun auch die beiläufigsten Aspekte unsres Lebens wohlüberlegt werden wollen, ist das eine. Daß die Sprache, derart aufgeladen, ihre wichtigste Funktion nicht mehr erfüllen kann – ein halbwegs neutrales Verständigungsmittel für alle zu sein –, das andre. Den Verfechtern der Wokeness ist es egal. Ja mehr noch, sie behaupten, daß die Sprache durch ihre Eingriffe von versteckt sexistischen oder rassistischen Subtexten gereinigt und entideologisiert werde. Sie verschweigen, daß die Alternativen, die sie bezüglich Wortschatz und Grammatik anbieten, keineswegs gereinigt, sondern mit einer neuen Ideologie aufgeladen sind. Daß sprachliche Klarheit und Schönheit zugunsten politischer Korrektheit geopfert werden, gilt dabei als Kollateralschaden, an den wir uns der guten Sache wegen schon gewöhnen werden.