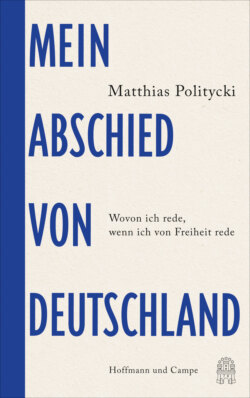Читать книгу Mein Abschied von Deutschland - Matthias Politycki - Страница 5
Freiheit
ОглавлениеJede Zeit frönt ihren speziellen Irrtümern, in manchen Zeiten scheinen sie sich zum allgemeinen Irrsinn zu ballen. Momentan ist die Intoleranz auf dem Vormarsch, freilich im Zeichen der Toleranz. An den Rändern der Gesellschaft herrscht eine große Gereiztheit, in ihrer Mitte eine große Verunsicherung. Mit jeder öffentlichen Äußerung riskieren wir, daß jemand einen Halbsatz aufschnappt, ihn auf seine Weise versteht oder gezielt mißversteht und über die sozialen Medien verbreitet. Gedanken werden aus dem Zusammenhang gelöst, damit sie knallen – und Klicks generieren, Quote machen, Auflage. Und das keineswegs nur bei Personen des öffentlichen Lebens, sondern bei allen, die in kleineren oder größeren Gruppen kommunizieren. Oft kommt Haß von rechts, keine Frage. Aber leider auch von links,[4] dazu ein gut organisiertes Mißtrauen gegen alles, was nicht exakt auf der eigenen Linie liegt. Immer wieder wird jemand erst durchs mediale Dorf getrieben und am Ende geschlachtet für etwas, das mißverständlich war oder schlicht »politisch inkorrekt«. Das bringt Menschen zum Schweigen, ob in der Wissenschaft, im Kulturbetrieb, im Alltag.
Mit unsrer Streitkultur, auf die wir so stolz sind, ist es offensichtlich nicht mehr weit her. Das geistige Klima hat sich in Deutschland im Verlauf der letzten Jahre auf paradoxe Weise verschlechtert, die Sichtweise auf Probleme verengt, die Positionen polarisiert. Beides, die Belehrungsimpertinenz von links wie die Pöbelei von rechts, sind zwei Seiten ein und derselben Bankrotterklärung. Der Überdruß an unserem öffentlichen Gespräch scheint inzwischen weite Teile der Bevölkerung erfaßt zu haben, vor allem das, was wir »die Mitte der Gesellschaft« nennen. Wir halten uns selbst nicht mehr aus.
Zumindest einen Teil unsrer Freiheit haben wir dadurch verloren: die Freiheit, so offen miteinander zu reden und zu diskutieren, wie ich es in meiner Jugend als urdemokratische Tugend beigebracht bekam. Eine Freiheit, die an keine Vorbedingung geknüpft und schlechthin unlimitierbar ist, abgesehen davon, daß sie dort aufhört, wo die Freiheit des anderen beginnt. Sie beinhaltet die Verpflichtung, sich redlich und respektvoll auseinanderzusetzen, andererseits auch das Recht, sich nicht auf die Art und Weise äußern zu müssen, die der Gesprächspartner erwartet.
Gerade auch dann, wenn zu einer gewissen Zeit in den herrschenden Kreisen Konsens zu bestehen scheint, auf welche Weise gelebt, miteinander gesprochen und am Ende auch gedacht werden sollte. Zu einer anderen Zeit wird es einen anderen, davon abweichenden Konsens geben – darin besteht Geistesgeschichte und, wenn man so will, Kultur. Gemeinschaften zeichnen sich nicht zuletzt dadurch aus, daß sie abweichende Meinungen – und eine abweichende Art und Weise, sie in Worte zu fassen – aushalten, solange sich diese im Rahmen der Gesetze verorten. Selbstredend auch Meinungen und Formulierungen, die aus der Vergangenheit überliefert und jetzt Teil unsres kulturellen Erbes sind. Sie mit eigenen Ansichten und Formulierungen kritisch zu konterkarieren, steht jedem frei. Ist eine demokratische Gesellschaft nicht willens, diese grundsätzliche Toleranz zu leben, drängt sie jede nichtkonforme Äußerung hinter vorgehaltene Hand und die wichtigen, die kontroversen Debatten vom öffentlichen in den vermeintlich geschützten privaten Raum. Spätestens dann ist ihr Fundament erschüttert, ihr Fortbestand gefährdet.
Davon rede ich, wenn ich von Freiheit rede und wie sie sich derzeit – absurderweise unter dem Versprechen, es ginge um die Befreiung der Menschheit schlechthin – zunehmend in Unfreiheit verwandelt. Nichts Geringeres wird gerade in der westlichen Welt verhandelt als unser Begriff von Freiheit. Wo manche noch glauben, es ginge lediglich um die Verbannung gewisser Wörter und Formulierungen, geht es in Wirklichkeit um die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben wollen. Allerdings befindet darüber nur eine kleine Elite. Für die überwiegende Mehrheit ist es rabulistisches Geplänkel, weil sie sich von den Vorgaben eines politisch korrekten Sprachgebrauchs (noch) nicht persönlich betroffen fühlt. Als ob mit der Maßregelung der Sprache nicht auch eine Maßregelung der Gedanken einherginge. Wer hier einfach nur »auf die Sprache vertrauen« will, die derlei Vorgaben im Lauf der Zeit schon von alleine abschleifen werde, verharmlost das Problem.