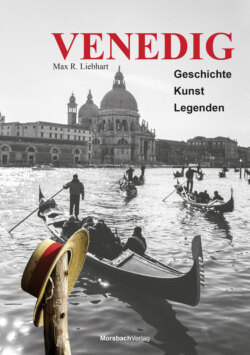Читать книгу Venedig. Geschichte – Kunst – Legenden - Max R. Liebhart - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSestiere di San Marco
Dieser Bezirk ist sicher der „feinste“ der Stadt, was dadurch bedingt ist, dass er sich zwischen der Piazza als ihrem geistigen und politischen Zentrum und dem Rialto erstreckt, dem Mittelpunkt des Geld- und Handelswesens – schließlich sagt man mit Recht, Rialto sei die „Wallstreet“ der damaligen Zeit gewesen. Nicht ohne Grund lässt Shakespeare Shylock im Kaufmann von Venedig fragen: „Was hört man Neues vom Rialto?“ und betont damit dessen überragende wirtschaftliche Bedeutung. Zudem besitzt der Sestiere eine lange Wasserfront am Canal Grande, die reichlich Platz für repräsentativ gelegene Palastbauten bot. Zu Zeiten der Republik gab es hier noch weitere Attraktionen in Form von mehreren Theatern und Spielcasinos, so z. B. den berühmten Ridotto in unmittelbarer Nachbarschaft zur Piazza in der Calle Vallaresso. Heute ist vieles vollkommen anders geworden: Entgegen der ursprünglichen politischen Bedeutung ist S. Marco heute Bischofskirche des Patriarchen. Rialto spielt nur mehr eine Rolle als der größte Markt der Stadt. Die Paläste sind fast ausschließlich zweckentfremdet und dienen allenfalls vereinzelt noch als Wohngebäude, und dann in der Regel nicht mehr für einzelne Familien, sondern aufgeteilt in viele kleinere Wohneinheiten. Die dominierende Rolle spielt heute der Tourismus in allen seinen Formen. Im Übrigen hat gerade dieser Stadtbezirk in der Zeit nach dem Untergang der Republik einschneidende bauliche Veränderungen erlitten. So wurden grobe Schneisen durch die Stadt geschlagen, z. B. die Calle Larga del XXII Marzo oder die Verbindung zwischen S. Salvatore und dem Campo S. Bartolomeo, die völlig unvenezianisch breit und gerade verlaufen und einen pompösen, in keiner Weise autochthonen Baustil aufweisen. Von dem, was einst war, können nur mehr die zahlreichen feinen Adressen eine Ahnung vermitteln, seien es die Hotels, die Restaurants oder die exklusiven Geschäfte. Im Gegensatz zu eleganten Geschäftsstraßen in Florenz oder Rom sieht hier von außen vieles zunächst eher kleinteilig und zurückhaltend aus. Bei näherer Betrachtung ist aber durchaus noch ein Abglanz von der Zeit zu erkennen, in der Venedig die Hauptstadt des Luxus und des Überflusses war.
Immer sind Gassen und Plätze ebenso wie die Piazza voll von Menschen, und in den Zeiten eines großen Besucherandrangs ist da manchmal kaum noch ein Durchkommen, es sei denn, man kennt die verborgen gelegenen Umgehungspfade. Der nämlich, dem die Stadt vertrauter ist und der es wagt, auch einmal von den Trampelpfaden abzuweichen, selbst auf die Gefahr hin, dass er sich verliefe, wird leicht Ecken und Wege finden, wo er ungestört ist und wo ihn die unvergleichliche Ruhe und Stille umgibt, wie sie als Stadt wohl nur Venedig bieten kann. Dabei sollten die Menschenmengen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Sestiere von San Marco recht weitgehend entvölkert ist, da durch die exorbitanten Preise für Miete und Kauf von Wohnraum die Gebäude fast nur noch kommerziell genutzt werden können.
► Rundgang
Piazza San Marco – Mercerie – S. Zulian – S. Salvatore – Campo S. Bartolomeo –
Rialto – Campo Manin – Campo S. Stefano – S. Zobenigo – La Fenice – S. Moisè
Der hier beschriebene Rundgang weist auf das Wesentliche dieses Stadtteils hin und ist als Anregung für die schönsten Wege gedacht. Doch sei betont, dass sich überall weitere, ähnlich faszinierende Wege öffnen, und es kann gar nicht genug empfohlen werden, sich durch sie verlocken zu lassen.
Man verlässt die Piazza unter dem Uhrturm und geht durch die Mercerie. Hier lagen die Läden der kleinen Händler, deren Waren am Markusplatz angelandet wurden, und noch heute gehören die Straßen der Mercerie zu den belebtesten und exklusivsten Geschäftsstraßen der Stadt. Gleich nach dem Uhrturm ist links oben an einer Hauswand die Büste einer Frau zu sehen, die mit einem Mörser hantiert. In den Boden darunter ist eine kleine weiße Marmorplatte mit dem Datum „15. Juni 1310“ eingelassen. An diesem Tag wurde ein Staatsstreich versucht, der sich zum Ziel gesetzt hatte, das sich immer stabiler verankernde oligarchisch-republikanische Regierungssystem zu stürzen. Geputscht haben Angehörige des Adels unter der Führung eines Bajamonte Tiepolo (ein Urenkel des Dogen Lorenzo Tiepolo, 1268–75) und seines Schwiegervaters Marco Querini. Es waren aber auch die Familien Badoer, Barozzi, Baseggio, Doro und Orio beteiligt, „allesamt ganz große Namen und alles unzufriedene Nobili, die sich vom Sturz der Regierung gesteigerten Einfluss und persönliche Pfründen versprachen.“ (Lebe) Um das zu erreichen, war eine radikale Veränderung der Verfassung geplant gemäß den „Vorbildern“, wie sie andere italienische Städte bzw. Stadtstaaten zuhauf boten. In dem geplanten Staatswesen sollte Bajamonte Tiepolo künftig als „Tyrann“ herrschen. Der Putsch scheiterte jedoch, weil die Verschwörung verraten worden war, so dass die Machthaber entsprechende Abwehrmaßnahmen vorbereiten konnten. Aus diesem Grunde war es den Aufständischen nicht möglich, die Piazza zu erstürmen, und ihr Vormarsch kam an der Stelle des heutigen Uhrturmes zum Stehen.
Gewissermaßen den Rest aber gab ihnen eine brave Bürgersfrau mit Namen Giustina (oder Lucia) Rossi. Die hatte mit ihrer Handlungsweise sicher nicht die Erhaltung der Republik im Sinne, sondern war vermutlich eher verärgert über den Lärm, der da vor ihrem Fenster herrschte. Offenbar sehr resolut, drückte sie ihr Missfallen dadurch aus, dass sie einen Mörser aus dem Fenster warf. Der traf ausgerechnet den im Kampfgetümmel hierher abgedrängten Fahnenträger der Rebellen und streckte ihn auf der Stelle nieder – und mit ihm sank das Feldzeichen zu Boden, was die Rebellen veranlasste, die Flucht zu ergreifen. Die Republik hat sich bei der Frau großzügig bedankt. Sie erhielt gemäß ihrem Wunsch das Recht, an Feiertagen die Fahne des hl. Markus an ihrem Balkon aufzuhängen. Außerdem durfte die Miete, die sie für ihren Laden und ihre Wohnung zu zahlen hatte, nicht mehr erhöht werden, was auch für alle ihre Nachkommen galt. Die Republik hat sich an diese Vereinbarung bis zu ihrem Ende gehalten und die Jahresmiete bis 1797 auf 15 Dukaten festgeschrieben.
Am Ende der Gasse biegt diese nach rechts ab und führt nach ein paar Metern auf den kleinen Campo San Zulian, an dem die gleichnamige
► Kirche S. Giuliano (S. Zulian)
liegt, deren mächtige Fassade der ravennatische Arzt und Humanist Tommaso Rangone finanziert hat. Sie wurde nach Plänen von Sansovino in den Jahren 1553–55 errichtet. Rangone ließ sich in der Fassade mit Sansovinos qualitätvoller Sitzstatue ein Denkmal errichten, das in edler Bronze ausgeführt ist und ursprünglich vergoldet war. Die Figur ist im Gestus antiker Philosophen über ihrem Sarkophag aufgestellt, ein Denkmaltypus, auf den auch Päpste für ihre Grabmäler zurückgegriffen haben (z. B. Urban VIII. in St. Peter, Rom). Es war das erste Mal, dass die Republik einer Privatperson erlaubte, sich in einer Kirchenfassade ein Denkmal zu errichten.
Dieser Mann Tommaso Rangone, dem es mittels zahlreicher Gesuche und großer Spenden gelungen war, eine solche Genehmigung zu erreichen, war eine in jeder Beziehung schillernde Persönlichkeit, auch was sein berufliches Spektrum anbetrifft, denn er war Arzt, Humanist und Astrologe. Zu Rangones Arztberuf meint Kretschmayr etwas spitz, die Medizin dieser Zeit habe sich „nur allzusehr in der Mitte zwischen Wissenschaft und Scharlatanerie“ bewegt, „und vielleicht hat sie gerade deshalb ihre seit 1515 zu einem Kollegium zusammengefassten Leute so gut ernährt wie jenen Giovanni da Ravenna, genannt ‚il Rangone‘, der sich von Sansovino ein Denkmal setzen lassen konnte“ und dessen Portraitstatue im Übrigen zum „Vorbild für unzählige Nachfolgerinnen“ wurde. Dabei hatte Rangone noch deutlich hochfahrendere Vorstellungen für seine Verewigung, da er ursprünglich bestrebt war, sich ein Standbild errichten zu lassen, nicht irgendwo, sondern auf der Piazza selbst und zwar vor San Geminiano. Erst ein Veto der Aufsichtsbehörde bereitete diesen Plänen ein Ende. Doch sein Standbild in einer Kirchenfassade war ihm noch nicht genug. Denn als er 1562 Vorsteher der Scuola Grande di San Marco wurde, beantragte er, auch in der Fassade dieser scuola ein Denkmal für sich errichten zu dürfen, was jedoch abgelehnt wurde. Auch später noch tat Rangone wirklich alles, was in seiner Macht stand, um „unsterblich“ zu werden. So hat er, uralt geworden, seine Funeralien bis ins kleinste Detail arrangiert. Da gab es dann einen pompösen Trauerzug, und zwar nicht direkt von der Piazza, an der er wohnte, nach San Zulian, sondern auf weiten Wegen durch die ganze Stadt. Die Glocken jeder Kirche, an denen der Sarg vorbeikam, läuteten und die Priester traten aus ihren Kirchen mit Kreuz und Weihwasser heraus, um ihn zu segnen. Sein Grab erhielt er, wie er es gewünscht hatte, im Chor von San Zulian.
Fassade: Diese hat zwei Stockwerke, die von einem Dreiecksgiebel mit zentraler Serliana überfangen werden. Vertikal ist sie in drei Abschnitte unterteilt. Das Untergeschoss gliedern kraftvoll zwei kannelierte Freisäulen zu Seiten des Portals, über dem die Statue Rangones auf dem Sarkophag sitzt. Die Gliederung im Obergeschoss erfolgt in analoger Weise, jedoch durch Pilaster. Das Innere stellt sich als Saalbau mit einfacher horizontaler Gliederung dar, dem sich dem Eingang gegenüber ein dreiteiliges Presbyterium anschließt. Besonders schön ist der geschnitzte und vergoldete Soffitto, der 1585 entstand und eine interessante Ecklösung aufweist. Er gibt gegenüber den Soffitti im Dogenpalast eine Vorahnung des nahenden Barock. Das Mittelbild mit der „Glorie des Titelheiligen“ stammt vom jüngeren Palma.
Ausstattung: Das erste Altarbild rechts Christus wird von den Engeln in den Himmel getragen malte Paolo Veronese. Interessant ist die Architektur des zweiten Altares rechts, der einer scuola gehörte und nach einem Entwurf Alessandro Vittorias gearbeitet wurde. Die Formensprache der Renaissance ist hier ins Üppige, Dekorative abgewandelt, und auch hier sind erste Anklänge des Barock zu spüren. Die sich anbahnende Veränderung wird am leichtesten im direkten Vergleich mit dem ihm an der linken Seitenwand gegenüberliegenden Altar verständlich. Ist dort alles klar und schlicht, so herrscht hier Vielfalt, sowohl was die Linienführung (siehe die eigenartige Schwingung des Rundgiebels) als auch die Vielschichtigkeit (starke Verkröpfung der Bekrönung) betrifft. Es ist nicht ganz einfach, den Altaraufbau als Ganzes, als Einheit zu begreifen, da das Auge keinen rechten Ruhepunkt findet und beständig abgelenkt wird. Die zum Altar gehörenden Figuren – besonders schön ist der David rechts, der an die Gestaltungsweise Michelangelos denken lässt – und das Antependium sind eigenhändige Werke Vittorias aus den Jahren 1583/84. Das Altarbild malte der jüngere Palma, ebenso das des Altares in der rechten Trabantenkapelle des Presbyteriums. Dieser Altar zeigt, ebenso wie das Hochaltarretabel, eine architektonische Modifikation des zweiten Seitenaltars. Es wurde hier das übliche Ädikulaschema im Sinne eines „Protobarocks“ verändert, der typisch ist für die Gestaltungsweise der venezianischen Baukunst kurz vor dem Ende des 16. Jahrhunderts und in dem sich Formen der Renaissance mit denen des Manierismus verbinden. Das Gewölbe der linken Seitenkapelle des Presbyteriums ist mit schönem Stuck aus der Werkstatt Vittorias geschmückt. Das Pietà-Relief auf dem Altar wurde von Girolamo Campagna gearbeitet, während die seitlichen Terrakottafiguren von Vittoria geschaffen wurden.
Hinter der Kirche liegt der Campo della Guerra. Dieser Name rührt angeblich von einem Kampf her, der hier gegen eine Kolonne von Aufständischen bei der Tiepolo-Verschwörung stattgefunden habe. Später gab es hier dann Stock- und Faustkämpfe – wie auch an anderen Stellen der Stadt, so auf den Ponti della Guerra, die bei Gesuati, bei S. Marziale, bei S. Fosca und bei S. Barnabà liegen.
Von der Kirchenfassade aus gesehen weiter nach rechts durch die Mercerie gehend, gelangt man zu dem breiten Ponte dei Bareteri. Diese Brücke hat ihren Namen von den bareteri, den Mützenmachern (ital. berretta, die Mütze). Das Handwerk war weit verbreitet und das Produkt wurde wegen seiner Feinheit und der Dauerhaftigkeit der Farben überallhin exportiert. In der Nähe der Brücke lagen mehrere Geschäfte, in denen die Mützen angeboten wurden.
Steigt man von der Brücke gleich wieder rechts über einige Stufen zu einem Sottoportico hinunter, so kommt man zum Corte Lucatello. Der pozzo dieses Hofes wäre nicht weiter beachtenswert, wäre mit ihm nicht eine Legende verbunden, die der „Dame im weißen Kleide“: In einem Jahr mit ungewöhnlicher Trockenheit begann der Brunnen zu versiegen, was die Anwohner des Hofes mit großer Sorge verfolgten. Sie sahen sich veranlasst, sich Wasser heimlich zu besorgen, womit sie sich natürlich einigen Ärger einhandelten. Eines Abends, schon sehr spät, begab sich ein Schiffer, mit einem Kupfereimer versehen, zu dem Brunnen, wo er eine Frau fand, die ganz in Weiß gekleidet war. Überrascht wie er war, überliefen den armen Mann Schauer der Angst, da zu dieser Zeit Geschichten in der Stadt kursierten, dass zu einer bestimmten Stunde in dunklen Nächten die Gassen von bösartigen Hexen bevölkert seien. Die Frau erriet die Ängste des Mannes und sagte zu ihm: „Vor mir musst du keine Angst haben. Aber es könnte passieren, dass dein Blut auf diesem Boden fließt, wenn du nicht rasch nach Hause gehst.“ Der Schiffer, immer erstaunter, nahm sie nicht ernst und wollte sie wegschicken. Darauf begann sie, ihn anzuflehen, doch unbedingt ihrem Rat zu folgen. Während dieses Zwiegesprächs und während der Schiffer sich dem Brunnen nähern wollte, sprang plötzlich ein anderer Mann aus der Dunkelheit hervor und überfiel den Schiffer mit einem Messer in der Hand. Der Kampf dauerte nur kurz und der Schiffer fiel schwer verwundet zu Boden. Nun plötzlich besann sich der Attentäter, fiel wegen seiner Mordtat in Verzweiflung und flehte alle Heiligen um Hilfe an. Die weiß gekleidete Frau hingegen nahm das Messer und ließ von der noch verschmierten Klinge drei Blutstropfen in den Brunnen fallen. Im gleichen Augenblick füllte sich die Zisterne mit so viel Wasser, dass sie überfloss. Dann nahm die Frau ihr Taschentuch, tauchte es ins Wasser und wusch damit die Wunden des Schiffers, die sich sofort verschlossen und vernarbten. Darauf befahl sie den beiden Männern, nach Hause zu gehen, und versicherte ihnen, dass der Brunnen künftig Wasser im Überfluss haben werde. Im Gehen wollten die beiden der Frau danken, doch die hatte sich in Nichts aufgelöst. Auch heute noch, in dunklen Neumondnächten, erscheint die Dame in Weiß manchmal ganz flüchtig in dem Hof. Es heißt, dass ihr Körper dort begraben liege. Er sei in die Wände des pozzo eingemauert worden, als die zugehörige Zisterne angelegt wurde. Auf diese Weise sollte ein Mord verschleiert werden, den ein Adeliger, der Geliebte der Frau, an ihr begangen hatte.
Am jenseitigen Fuß des Ponte dei Bareteri, etwas verborgen unter einer Arkadenstellung, liegt das Französische Kulturinstitut. Es ist in einem Casino aus der Zeit des Rokoko untergebracht, das im Grundriss einem Palazzo en miniature gleicht und kostbar ausgestattet ist. Zu diesem Casino gehört auch ein sogenannter liagò, ein erkerähnliches Gebilde, von denen es früher recht viele in der Stadt gab. Heute sind sie fast nur mehr an Gebäuden zu sehen, die am Canal Grande stehen. Solche casini wurden als Absteige benützt, u. a. um sich dort vor Ratssitzungen umzukleiden, aber auch um den gewaltigen Dimensionen der eigentlichen Paläste einmal entkommen zu können. Sie schossen nach 1774, als die Republik den Ridotto, das berühmte Spielcasino in der Calle Vallaresso schloss, wie Pilze aus dem Boden. 1797 gab es davon etwa 136, sie waren gewissermaßen Statussymbole geworden, und in manchen Familien besaßen die Ehepartner jeweils ein eigenes. Daneben dienten sie sicher auch noch anderen Zwecken – Corto Maltese bezeichnet sie als „luogi più frivoli“, geht dabei aber nur auf das Glücksspiel ein, dem man hier frönte. Doch trafen sich die Damen hier auch, um Konversation zu machen, die Leute auszurichten, sich die Zeit zu vertreiben – und natürlich, um Liebeshändel anzuzetteln. Denn hier war man weit weg von den ehelichen Verpflichtungen und außerdem geschützt vor indiskreten Blicken. Unliebsame Überraschungen brauchte die Besitzerin dieses Casinos nicht zu befürchten. Es gab nämlich ein Loch im Boden (es existiert heute noch), durch das man sehen konnte, wer am Tor Einlass begehrte. Daneben wird überliefert, dass das Casino einen geheimen Ausgang besessen haben soll, der sich unter der nahen Brücke mit einer versteckten Pforte zum Wasser öffnete.
Geht man geradeaus bis zum Ende der calle, so bildet diese dort eine Nische, an deren Ende die Mauer einen sogenannten capitello, eine Art Tabernakel trägt. Er birgt, wie viele solcher capitelli, die überall in der Stadt anzutreffen sind, eine Madonna mit Kind.
Der Capitello in der Merceria gilt seit langem als wundertätig, genauer seit dem Jahre 1492, als in der Nähe der Kirche San Giuliano ein riesiger Brand ausbrach. Der breitete sich mit rasender Geschwindigkeit in Richtung Rialto aus, und es wurde schon befürchtet, dass sich ein Großbrand wie im Jahre 1105 wiederholen könnte, durch den damals ein Drittel der Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Doch die lodernden Flammen, die scheinbar bereits die Herrschaft über alles gewonnen hatten, sanken in dem Augenblick, in dem sie den capitello erreicht hatten, plötzlich in sich zusammen und verloschen binnen kurzer Zeit vollkommen. Die Volksmeinung führte dieses rätselhafte Ereignis auf die göttliche Gnade zurück.
Die Gasse biegt nun zuerst nach rechts und gleich wieder nach links, um sich nach etwa fünfzig Metern links in den Campo S. Salvatore zu öffnen. Die gleichnamige
► Kirche S. Salvatore
ist mit Ausnahme ihrer Fassade vollständig von Gebäuden umgeben. Ein erster Kirchenbau entstand an dieser Stelle, die als humbilicus, als „Nabel“ der Stadt angesehen wurde, schon im 7. Jahrhundert (der Legende nach wurde sie vom hl. Magnus gegründet, nachdem diesem Christus selbst erschienen war und die Errichtung der Kirche von ihm gefordert hatte) und besaß möglicherweise stilistische Züge des Heiligen Grabes in Jerusalem. Im 12. Jahrhundert entstand eine erste Klosterkirche. 1257 wurden die Reliquien des hl. Theodor, des ersten Patrons der Stadt und somit des „Vorgängers“ des hl. Markus, hierher überführt, was für die Kirche eine starke Aufwertung bedeutete. Das jetzige Bauwerk entstand 1507–34. Die Grundsteinlegung erfolgte an einem hochbedeutenden Datum, nämlich am 25. März. Das war „der Tag der Verkündigung Mariä, des Heiles der Menschheit, der Erschaffung der Welt, der Kreuzigung Christi und zugleich der Gründungstag Venedigs.“ (Concina) Die Bauleitung lag zunächst bei Giorgio Spavento, eigentlicher Architekt war aber Tullio Lombardo, in der Schlussphase betreute dann Sansovino den Bau.
Fassade: Diese entstand erst in den Jahren 1663–1700, was für italienische Kirchen nicht ungewöhnlich ist: Die Kirchenfassade wurde immer zuletzt gebaut – falls die Gemeinde noch oder wieder genug Geld zur Verfügung hatte – selbst wenn sie dann in einem völlig anderen Baustil entstand. Man findet aber auch viele Kirchen, die ohne Schaufassade geblieben sind. Vom campo aus ist die barocke Fassade nur im steilen Aufblick zu betrachten und deshalb schwer zu erfassen. Sie ist horizontal zweigeteilt, wobei der untere Abschnitt doppelt so hoch ist wie der obere, vertikal ist sie in drei Abschnitte gegliedert. Das Mittelintervall wird von einem kleinen Dreiecksgiebel überfangen. Im Erdgeschoss stehen in der Mitte auf hohen Sockeln Säulen, die ein kräftiges Gebälk tragen, ein Motiv, das im Innenraum in modifizierter Form aufgegriffen und weiterentwickelt wird. Das Obergeschoss wird dagegen durch Pilaster gegliedert. Dem von einer Säulenädikula gefassten Portal antwortet oben ein Fenster mit einem Doppelbogen.
Inneres: „Das Innere ist von großartiger und freier Wirkung, von monumentaler Ruhe und Klarheit des Aufbaus, von schönen, unmittelbar wirksamen Proportionen und einer Lichtsituation, die in Venedig einzig dasteht.“ (Hubala) Wesentlichen Anteil an der Lichtfülle haben die Laternen der drei großen Kuppeln, die erst 1574 unter Scamozzi dazukamen. Es wird in diesem Bauwerk das Lieblingsthema der venezianischen Sakralarchitektur, das des Zentralkuppelraumes, erneut vorgetragen. Dabei ist S. Salvatore nichts anderes als die Übersetzung der Architektur von S. Marco in die Formensprache der Renaissance, worauf schon Francesco Sansovino, der Sohn des großen Architekten und Bildhauers hingewiesen hat. Ungewöhnlich für Venedig war bei dieser Neuinterpretation des Innenraumes von S. Marco die Gliederung der weißen Flächen und Gewölbe mit Architekturelementen aus grauem Gestein, ein Motiv, das aus der Toskana stammt. Der grundlegende architektonische Gedanke ist der einer Kuppel über quadratischem Grundriss mit vier kleinen seitlichen Kuppelräumen, die wie die „5“ des Spielwürfels (quincunx) angeordnet sind, wobei weitgespannte Tonnen den Raum zwischen den kleinen Kuppeln übergreifen, diese verbinden und gleichzeitig die Zentralkuppel an vier Seiten flankieren. Hier sind – wie in S. Marco – drei dieser Systeme so ineinander gehängt, dass eine Tonne zwischen zwei Hauptkuppeln zu jeweils zwei Systemen gehört. In der Längsachse wird der Raum durch die Dreiergruppe der Apsiden abgeschlossen. Das Querhaus lädt nur wenig aus und ist glatt geschlossen. Wesentlich für die Raumwirkung ist die horizontale Gliederung durch die gleichgeformten Sockel der Pfeiler und insbesondere durch die mächtige Attikazone, die über den ganzen Raum rundum hinwegläuft und ihn so wie ein Gürtel zusammenfasst. Der Fußboden wiederholt und erklärt den Grundriss des Bauwerks und bringt gleichzeitig Farbe und Wärme in den Raum.
Ausstattung: Im ersten weiten Intervall rechts steht das Grabmal für den Prokurator Andrea Dolfin und dessen Ehefrau Benedetta (um 1600), deren Portraitbüsten Campagna schuf. Von ihm stammen auch die Skulpturen (Muttergottes mit Kind und Engeln) auf dem zweiten Seitenaltar. Rechts neben der zweiten Hauptkuppel befindet sich das Grabmal des Dogen Francesco Venier (1554–56), der ursprünglich in S. Francesco della Vigna „con poca pompa“ („mit geringem Pomp“) bestattet werden wollte. Doch hat er später dann doch den Wunsch nach einem repräsentativen Grabmal in San Salvatore geäußert. Seine Familie hat Sansovino, den in dieser Zeit sicherlich bedeutendsten Architekten der Stadt, mit der Ausführung beauftragt. Es wurde eines seiner Hauptwerke, das er in den Jahren 1557/58 schuf. Sansovino griff hier auf Tullio Lombardos Architekturgedanken des Grabmals für Giovanni Mocenigo in SS. Giovanni e Paolo (venezianisch Zanipolo) zurück und entwickelte ihn weiter. Die Architektur leitet sich vom Triumphbogen-Schema ab und ist hier in ein vollkommenes Gleichgewicht gebracht. Das Grabmal ist zwischen die seitlich angrenzenden Nebenkuppeljoche gespannt und steht mit seiner schlichten Sockelzone fest auf dem Boden des Kuppeljoches – eine Beobachtung, die relativiert wird durch die von zierlichen Konsolen getragenen Sitzbank, wodurch der Eindruck eines „Schwebens“ entsteht. Die Gliederung des Grabmals ist an die Raumarchitektur angepasst, sie berücksichtigt sowohl die Höhe der Piedestale der Raumpfeiler als auch die der Attika. Die Architektur erscheint durch die Säulenstellung (das mittlere Interkolumnium hat dieselbe Breite wie das Fenster über dem Grabmal) und die leicht vorspringende Bogenstellung elastisch, atmend, fast lebendig. Sie ist in verschiedenfarbigen Marmorsorten ausgeführt, wodurch das Werk, das außerdem reich mit Ornamenten versehen ist, polychrom wirkt. Das Figurenprogramm ist dagegen relativ sparsam. Es beschränkt sich auf die Liegefigur des Dogen, auf zwei Tugendpersonifikationen (Caritas und Glaube) in den seitlichen Interkolumnien sowie auf die Pietà in der Lünette, die von Vittoria gearbeitet wurde und ein fast wörtliches Zitat von Michelangelos Pietà in Sankt Peter in Rom ist. Eigenhändig hat Sansovino die Statue „Glaube“ rechts ausgeführt, deren Gestaltung unmittelbar von antiken römischen Gewandfiguren abgeleitet ist, „vielleicht die schönste Frauenstatue der venezianischen Renaissance-Skulptur“ (Hubala).
Einen absoluten Höhepunkt, – dies betrifft nicht nur die Kirche, sondern die Kunst der Stadt insgesamt – stellt die Verkündigung dar, ein Spätwerk Tizians aus den Jahren 1560–66, das über dem nächsten Altar im originalen, herrlichen Rahmen hängt, den Sansovino selbst gearbeitet hat. Es fällt auf, dass das Geschehen auf einer um zwei Stufen erhöhten Fläche stattfindet. Diese Stufen beziehen sich exakt auf die Architektur des umgebenden Raumes (die erste Stufe entspricht der Oberkante des Postaments der Pilaster, die zweite Stufe deren Basis). Es ist nicht ganz einfach, sich mit diesem Bild zu arrangieren und sich in ihm zurechtzufinden, da das Auge keinen rechten Ruhepunkt findet und unstet zwischen den beiden Protagonisten und der Wolke der Engel hin und her wandert. Alles ist so geheimnisvoll dargestellt, wie es das Thema selbst ist. Die Figuren treten aus einem dichten Geflecht von Farben hervor, sind eingetaucht in helles Licht, das vom Himmel niederschießt gleich der Taube, die sich Maria nähert. Diese sitzt rechts und weicht vor dem Sturm, der da auf sie zubraust, etwas zur Seite hin aus. Farblich ist Maria stark zurückgenommen und in das traditionelle Rot und Blau gekleidet. Sie lüftet mit ihrer rechten Hand einen hauchzarten Schleier, „denn es geschah – nach Gregorios von Nyssa, der das Mysterium der Inkarnation verständlich zu machen suchte – durch das Wort, dass Gott durch das Gehör in den Mutterleib eindrang, aus dem sodann in Reinheit der Sohn Gottes hervorging.“ (Pedrocco) Freudigkeit und Bereitschaft liegen in Miene und Haltung Marias. In ihrer Linken hält sie ein halb geöffnetes Buch, in dem man das Wort „signu(m)“ erkennen kann, ein Hinweis auf Jesaja 7,14, wo es heißt: „Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.“ Gabriel dagegen tritt mit schimmernden Flügeln und wie von Licht erfüllt auf, von dem unklar ist, wovon es ausgeht (es scheint von vorne und links zu kommen). Er hält die Arme gekreuzt, was als Zeichen der Anbetung zu verstehen ist, und schreitet kraftvoll und gleichzeitig werbend auf Maria zu, um unwiderstehlich vom Willen Gottes und dessen Beschluss zu künden. Schräg rechts oben findet sich die wesentliche Lichtquelle in diesem Bild, die noch heller leuchtet als Gabriel. Es ist die Taube, von der die Gloriole der Engel, die den Himmel über dem Geschehen erfüllt, ihr Licht erhält. Alles außerhalb dieser Lichtpunkte ist undeutlich, ist erfüllt von webenden Farben und Farbnebeln (wobei dieser Eindruck durch die Maltechnik von Tizians Spätstil, in dem er pastose Farbe in immer neuen Lagen über- und gegeneinandersetzt, noch zusätzlich verstärkt wird). Rätselhaft ist das glühende Rot im Hintergrund neben der Säulenstellung, das als brennender Dornbusch gedeutet wird, auf den sich auch die Worte beziehen, die rechts auf der zweiten Treppenstufe stehen: „IGNIS ARDENS NON COMBURENS – Feuer, das brennt, aber nicht verzehrt“. Ein schönes Detail ist die Vase am rechten unteren Bildrand mit einem trockenen Zweig, der durch göttliche Intervention aufblüht – ein Symbol für die ewige Jungfräulichkeit. Das Bild hat weit über seine Zeit hinaus gewirkt und den Barock beeinflusst.
Es bleibt zu erwähnen, dass einigen Zeitgenossen der Stil von Tizians Verkündigung etwas zu unkonventionell erschien, dies so sehr, dass sie es einfach für unvollendet erklärten und sogar die Autorschaft Tizians in Zweifel zogen. Diesbezüglich berichtete 1648 Ridolfi, dass der alte Künstler darüber beträchtlich verstimmt gewesen sei und deswegen seine Signatur„Tizianus fecit“ mit einem zweiten „fecit“ ergänzt habe, um die Eigenhändigkeit zu betonen. Diese Interpretation ist praktisch in allen Werken zu lesen. Allerdings ergab sich bei einer 1988/89 durchgeführten Restaurierung des Bildes, dass diese These nicht haltbar ist. Es ließ sich nämlich beweisen, dass das zweite „fecit“ nicht von Tizian stammt, sondern Zutat einer früheren Restaurierung ist.
An der Stirnwand des rechten Querhausarmes ist seit dem Ende des 16. Jahrhunderts Catarina Cornaro beigesetzt, die zuvor ihr Grab in SS. Apostoli hatte.
Sie hatte den Titel einer „Tochter der Republik“ erhalten, damit sie Königin von Zypern werden konnte. Als solche durfte sie diese Insel dann der Republik schenken, nachdem ihr Ehemann überraschend in noch jugendlichem Alter gestorben war. Das Kind, das aus dieser Ehe stammte, starb nur wenig später, und beide Todesfälle geschahen unter so dubiosen Umständen, dass prompt der Verdacht auf Giftmorde geäußert wurde. In jedem Fall aber kamen sie der Republik durchaus gelegen.
Auf dem Hochaltar steht ein weiteres Gemälde Tizians, das meist als Himmelfahrt Christi bezeichnet wird und aus den Jahren 1560–65 stammt. Das Thema, eigentlich eine trasfigurazione, ist dargestellt als ein stilles Schweben in blendendem Licht, in dem Christus von Aposteln und Propheten umgeben ist. (Hubala hat auf die kompositorische Nähe zu Raffaels Interpretation des gleichen Themas, heute in der Vatikanischen Pinakothek, hingewiesen.) Das Bild war früher nur vom 3. bis 15. August und an hohen Feiertagen zu sehen, während sonst ein Paliotto aus dem 14. Jahrhundert gezeigt wurde, ein Altaraufsatz, der aus getriebenem Silber und Niello gefertigt ist. Um diesen heute zu sehen, muss man sich an den Mesner wenden, ansonsten wird er nur in der Karwoche und an Christi Himmelfahrt gezeigt. Auch auf ihm ist die Transfiguration dargestellt, und zwar in der Mitte der Tafel. Dort wird Christus von Aposteln flankiert, während in drei weiteren Reihen Heilige in Nischen und Evangelisten mit ihren Symbolen zu sehen sind.
An der Wand der linken Trabantenkapelle hängt das Bild Christus in Emmaus, dessen Zuschreibung unsicher ist. Die örtliche Beschriftung lässt offen, ob es von Bellini oder von Carpaccio oder möglicherweise auch von einem Nachfolger Bellinis gemalt wurde. Die Skulpturen des ersten Seitenaltares im linken Seitenschiff stammen von Vittoria. Besonders schön ist der Sebastian, ein Spätwerk des Künstlers. Es verzichtet auf die häufig anzutreffende Darstellungsweise, bei der Sebastian gewissermaßen unbeteiligt und unbeeindruckt von den Pfeilen sein Martyrium erleidet. Hier wird vielmehr mit allem Realismus gezeigt, wie qualvoll es für einen Menschen ist, von einem Pfeil in die Brust getroffen zu werden. Die Architektur des anschließenden Seitenportals sowie der Orgelprospekt darüber stammen von Sansovino. Die großen Flügel des Orgelprospektes malte 1530 Francesco Vecellio, der Bruder Tizians.
An der Wand links neben dem hinteren Kuppelraum befindet sich ein Grabmal für zwei Dogen, die Brüder Lorenzo (1556–59) und Girolamo (1559–67) Priuli. Sie regierten somit unmittelbar nach Francesco Venier, dessen Grabmal schräg gegenüber steht. Dem Künstler (Cesare Franco) standen gleiche räumliche Voraussetzungen zur Verfügung, so dass sich ein Vergleich mit Sansovinos Werk anbietet. Ist bei diesem das Verhältnis zwischen Architektur und Skulpturenschmuck ausgewogen, so besitzt die Architektur beim Priuli-Monument ein deutliches Übergewicht. Außerdem ist hier der Reichtum der Farben des Materials zugunsten der Wirkung von grauem und schwarzem Marmor aufgegeben. Durch die Notwendigkeit, zwei gleichwertige Achsen zu gestalten, erhält das Monument eine entschiedene Betonung der Vertikale. Sie wird durch vierzehn kraftvolle Säulen bestimmt, die in zwei räumlich voneinander abgesetzten Ordnungen stehen. In den unteren Interkolumnien sieht man die Liegefiguren der Dogen in fast identischer Gestaltung. Oberhalb des kräftigen Architravs stehen die Figuren der Namenspatrone Laurentius links und Hieronymus rechts. Bei der Gestaltung des Grabmals konnte sich Franco auf keine architektonischen Vorbilder beziehen. Es handelt sich somit um ein singuläres Werk, das in seinem Gesamteindruck nicht die Ruhe und Geschlossenheit des Venier-Monuments ausstrahlt, sondern trotz seiner Schwere eher etwas instabil wirkt. Die beiden Dogen waren im Übrigen schon vor Vergabe des Auftrages (1569) in einer heute nicht mehr existierenden Kirche beigesetzt worden. Die Ausführung des Grabmals zog sich hin, es wurde erst 1603/04 vollendet.
Links neben dem Hauptportal der Kirche liegt der Eingang zu den früheren Klostergebäuden mit zwei schönen Kreuzgängen, die in recht nüchternem Renaissancestil gehalten sind. Dabei stellt man fest, dass S. Salvatore auch einen Campanile besitzt, der sonst nur von einem einzigen Punkt auf dem Campo San Luca aus zu sehen ist.
Schräg links gegenüber der Kirche erhebt sich die mächtige zweigeschossige Fassade der ehemaligen Scuola Grande di S. Teodoro, die zusammen mit S. Salvatore ein eindrucksvolles Ensemble bildet. Die Scuola ist vermutlich ältesten Ursprungs und geht auf die Zeit zurück, zu der der hl. Theodor der erste Schutzpatron der Stadt war. Sie ist erstmals im Jahre 1258 dokumentarisch erwähnt. Das jetzige Gebäude entstand in den Jahren 1578–1608, um bis 1671 noch mehrfach verändert zu werden. 1806 wurde die Scuola aufgehoben, 1960 erfolgte die Neugründung der Bruderschaft, die den architektonisch eher unbedeutenden Innenraum heute überwiegend für Konzerte und Ausstellungen zur Verfügung stellt.
Von der Kirchenfassade etwas nach rechts versetzt steht ein Säulenmonument aus dem 19. Jahrhundert. Es trägt die Inschrift „XXII Marzo 1848“ und erinnert somit an den Beginn des Aufstandes der Venezianer gegen die österreichische Besatzung.
Nach kurzem Weg durch eine der Schneisen, die nach 1797 in den Stadtorganismus geschlagen wurden, gelangt man zum Campo S. Bartolomeo. Dieser ist meist sehr belebt, allein schon dadurch, dass sich hier zwei Hauptverkehrsadern der Stadt kreuzen (von S. Marco zur Rialtobrücke und von der Accademia Richtung Bahnhof). Er ist außerdem ein bevorzugter Treffpunkt der Jugend. In der Mitte lächelt Goldoni, der Dichter zahlloser Komödien, weise von seinem Denkmalsockel herab. „Das Denkmal Goldonis ... macht einen gesunden, lebendigen und sehr drolligen Eindruck. Wie der Mann da stockschwingend spazieren geht, bezopft, im Dreispitz: Keck, launig, lachend, und am geschwungenen Röckchen die Spuren der Zudringlichkeit vieler Hundert venezianischer Tauben, gehört er unter das Volk, das ihn rauchend und schwatzend in Alltagstracht umgibt“, sagt Gerhard Hauptmann. Links führt die Salizada Pius X. zur Rialtobrücke. Sie ist heute mit Verkaufsständen fliegender Händler verstellt.
In der Nacht vom 12. zum 13. Mai 1797 gab es hier wilde Ausschreitungen der Bevölkerung gegen diejenigen Patrizier, die die Stadt den Franzosen ausgeliefert hatten. Dabei wurden auch deren Paläste geplündert, und es kam zu Übergriffen auf Unschuldige. Daraufhin ließ ein gewisser Bernardino Renier ein paar Kanonen oben auf der Rialtobrücke in Stellung bringen, um ein Vordringen der Plünderer auf die andere Seite des Canal Grande zu verhindern. Schließlich wurden einige Salven abgefeuert, und die Salizada war mit blutüberströmten Leichen bedeckt. Die letzten Schüsse der Kanonen von San Marco trafen also die Söhne der eigenen Stadt.
Die Kirche S. Bartolomeo, die frühere Hauskirche der Deutschen, ist profaniert und wird heute für Konzerte und Ausstellungen (seit einigen Jahren eine Musikinstrumenten-Ausstellung) benützt. Während die Kirche selbst weitgehend unbedeutend ist, so ist ihr Campanile, den Giovanni Scalfurotto in den Jahren 1747–54 erbaut hat, wichtig für das Stadtbild und ein kräftiger Akzent zu Füßen der Brücke (die zur Zeit der Republik als einzige den Canal Grande überspannte).
Am Fuß des Ponte di Rialto ist an einem der Bögen, die die Schaufenster übergreifen, ein vergoldeter männlicher Kopf zu sehen, mit dem sich zunächst nichts verbinden lässt. Bis zum Jahre 1996 befand sich hier, wo heute touristische Artikel und Glaswaren verkauft werden, die traditionsreiche Spezeria alla Testa d’Oro, also eine Apotheke. Wen der Kopf darstellt, ist unbekannt, möglicherweise ist es das Portrait eines Besitzers der Apotheke im 16. Jahrhundert, vielleicht stellt er auch Mithridates (den König von Pontos) oder Andromachus den Älteren (den Leibarzt Kaiser Neros) dar. Der Kopf wurde 1997 renoviert. Die Apotheke war in der Stadt die berühmteste unter denen, die teriaca herstellten, eine pharmazeutische Spezialität, die an der Grenze zwischen Wissenschaft und Scharlatanerie angesiedelt war und eine erstaunlich lange Tradition besaß.
Kein anderes pharmazeutisches Präparat konnte sich über einen so langen Zeitraum auf dem Markt halten. Der Name Theriak kommt vom griechischen Wort theriaké oder auch vom indoeuropäischen therion, was „giftiges Tier“ bedeutet. In Ägypten wurden schon im 3.– 4. Jahrhundert v. Chr. ähnliche Rezepturen zubereitet, die bis zu vierzig verschiedene Zutaten beinhalteten und letztlich eine Mischung von Antidoten waren. Mithridates, König von Pontos, hatte wohl berechtigte Sorgen, Opfer eines Giftanschlages zu werden und somit das gleiche Schicksal wie viele seiner Standeskollegen zu erleiden. Um gegen solche Attentate gewappnet zu sein, ließ er 63 v. Chr. ein Präparat auf der Basis altägyptischer Rezepturen herstellen, diese jedoch um einige Zutaten auf nunmehr 54 Bestandteile erweitern. Als Pompeius der Große Pontos erobert hatte, fand er das von Mithridates eigenhändig aufgezeichnete Rezept und brachte es mit nach Rom. Andromachus der Ältere, der Leibarzt des Kaisers Nero, erweiterte die Rezeptur erneut, diesmal auf 64 Zutaten, zu denen als wichtiger Bestandteil Vipernfleisch gehörte. Die teriaca wurde auf diese Weise zu einem Allheilmittel. Es enthielt u. a. Rosen, Schwertlilien, Zimt, Ingwer, Myrrhe, Safran, schwarzen Pfeffer, Baldrian, alten Wein, Honig, Erde von der Insel Lemnos, eine immergrüne kretische Pflanze (dictamus) und Opium. Und außerdem, wie gesagt, das Fleisch von Vipern, die aus den Euganeischen Hügeln stammen und in den Monaten Juli und August gefangen worden sein mussten. Mit steigenden Umsätzen wurde es erforderlich, mehr und mehr auch auf andere Herkunftsorte, wie Vicenza, Verona, Trient, Treviso, das Friaul, schließlich sogar auf Istrien zurückzugreifen. Denn immerhin benötigten die Apotheken der Stadt bis zu 800 Schlangen pro Monat, deren Verarbeitung natürlich genau festgelegt war und auch überwacht wurde. Mit der teriaca wurde schwunghafter Handel betrieben, nicht nur in der Stadt selbst, sondern auch über die Fernhandelswege Venedigs. Die Herstellung des Präparates erlosch mitnichten mit dem Untergang der Republik, sondern wurde noch bis weit ins 20. Jahrhundert gepflegt, allerdings mit einer vereinfachten Rezeptur. In den 1940er Jahren wurde die Beigabe von Opium verboten, wodurch die teriaca ihre schmerzstillende Wirkung einbüßte. 1904–57 wurde teriaca für die Firma Branca hergestellt, deren bekanntestes Produkt der „Fernet-Branca“ ist.
Am Ende des campo ragt links mit einer Ecke der Fondaco dei Tedeschi herein. Der Ausdruck fondaco kommt vermutlich aus dem Arabischen, hat aber seine ursprüngliche Wurzel im griechischen Wort pandocheion, was mit Herberge, Karawanserei oder auch mit „man nimmt alles“ übersetzt werden kann. Die Araber übernahmen den Begriff und machten funduq („Hotel“) daraus, ein Wort, das in verschiedene europäische Sprachen eingegangen ist (ital. fondaco, franz. fondigues, katalanisch fondech). Der Fondaco, vor dem man hier steht, diente den Kaufleuten aus den nördlich der Alpen gelegenen Ländern als Handelshaus und Herberge. Vorzugsweise stammten die Gäste natürlich aus dem Deutschen Reich, und die Vorstände dieser Einrichtung kamen meist aus Augsburg, Nürnberg und Regensburg. – Die Einrichtung von nationalen Handelshäusern durch die Republik hatte auch den Nutzen, den Handel bestimmter Volksgruppen zu überwachen und insbesondere das Eintreiben der Steuern zu kontrollieren. Neben dem Fondaco dei Tedeschi gab es flussaufwärts noch den Fondaco dei Turci. – Ein Fondaco ist hier erstmals im Jahre 1228 erwähnt. Dieses Gebäude brannte 1505 ab, wurde aber umgehend wiederhergestellt. Die Architektur wurde zunächst Pietro Lombardi zugeschrieben, bis ein Dokument gefunden wurde, das Giovanni Spavento und Antonio Abbondio, genannt Scarpagnino, als Baumeister nannte. Wie viele Paläste am Canal Grande, so war auch der Fondaco außen bemalt, und zwar von Giorgione (an der Wasserfront) und Tizian (an den Seitenfassaden). Die wenigen Reste, die sich davon erhalten haben, sind in der Galleria Franchetti in der Cà d’Oro und in der Accademia zu sehen. Der Bau hat, von außen betrachtet, etwas Klösterliches. Die Bruderschaft der Kaufleute war klösterlich organisiert, Frauen waren nicht zugelassen. Lebenswandel und insbesondere der Handel, den die Insassen trieben, wurden von Organen der Republik strikt überwacht. Handelsgeschäfte durften nur über venezianische Makler abgewickelt werden (das war ein recht einträgliches und deshalb sehr begehrtes Geschäft, auch Tizian hatte einen Maklerposten inne). Auch hatte der Fondaco eine eigene Zollstation. Interessant ist der große, früher offene Innenhof mit Brunnenkopf (pozzo) und in vier Reihen übereinandergestellten Pfeilerarkaden. Früher wurde das Gebäude als Hauptpostamt genutzt und es war möglich, die Etagen zu ersteigen und die wahrlich klösterliche Architektur mit zellenartigen Gemächern zu studieren. Nach jahrelangen Renovierungsarbeiten befinden sich in dem Gebäude nunmehr zahlreiche Luxusgeschäfte. Von größtem Reiz ist eine Dachterrasse, von der man einen hinreißenden Blick über den Canal Grande hat, der zu Füßen des Fondaco eine scharfe Kurve beschreibt.
Seitlich am Fondaco entlang verläuft die Calle del Fontego, die in ihrem letzten Stück Traghetto del Buso heißt, ein Name, der von der Lage dieses Abschnitts der calle kommen soll, die hier wie in einem Loch (buco) unter der Brücke eingeklemmt ist. Eine andere Erklärung ist interessanter. Einst wurden alle Prostituierten aus der Stadt verbannt, eine Anordnung, die aber auf Grund von Unruhen im Volk rasch widerrufen werden musste. „Als die Prostituierten wieder zurückkehrten, setzten viele an dieser Stelle über den Canal Grande, um wieder ihre Quartiere beim Rialto zu beziehen. So kam das Traghetto zu seinem Namen.“ (Giordani) Früher hieß es auch einmal Traghetto dei Ruffiani (das sind die Zuhälter – aber wer will in einer Straße mit diesem Namen heute wohnen?).
Am Seitenportal des Fondaco vorbei erreicht man den Canal Grande am Fuß des
► Ponte di Rialto (Rialto-Brücke)
Eine Brücke an dieser Stelle wurde erst relativ spät in der Geschichte der Stadt errichtet, anscheinend erstmals Ende des 12. Jahrhunderts, und zwar zunächst nur als Schiffsbrücke. Sie wurde Ponte del Quartarolo oder auch Ponte de la Moneta genannt, weil sie nur gegen Gebühren benützt werden konnte. 1265 hat man sie neu und diesmal schon auf Pfählen erbaut. 1310 durch die Kämpfe beim Bajamonte-Tiepolo-Aufstand schwer beschädigt, wurde sie umgehend restauriert. 1444 brach sie unter der Last der Schaulustigen, die auf ihr den Besuch der Herzogin von Ferrara verfolgten, zusammen. Der Neubau musste 1523 renoviert werden. Seine Konstruktion ist von zeitgenössischen Gemälden, vor allem von einem Bilderzyklus in der Accademia (Saal 20), bekannt. Der Mittelteil der Brücke konnte geöffnet werden, um größeren Schiffen, so auch dem bucintoro, die Durchfahrt zum Gästehaus der Republik, dem jetzigen Fondaco dei Turchi zu ermöglichen. In dieser Zeit wurden erste Überlegungen angestellt, hier eine Brücke aus Stein zu errichten. Es wurde deshalb ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich die herausragenden Architekten der damaligen Zeit wie Fra Giocondo da Verona, Michelangelo Buonarotti, Andrea Palladio, Giacomo Barozzi, genannt il Vignola, Jacopo Sansovino und Vincenzo Scamozzi beteiligten. Zwei Entwürfe Palladios sind überliefert. Der erste sah fünf Bögen sowie einen von vier Säulen getragenen, mittig angeordneten Pavillon vor. Der zweite sollte einen horizontalen Brückenverlauf bekommen, der von drei Bögen getragen wurde. Auch bei diesem Projekt sollte in der Mitte der Brücke ein großer, tempelartiger Pavillon entstehen, zusätzlich zwei weitere kleinere jeweils an den Seiten. Mit der Verwirklichung dieses Entwurfes hätte man die Tradition des venezianischen Brückenbaus verlassen, außerdem wären dabei erhebliche Eingriffe in die Bausubstanz der Umgebung erforderlich gewesen. Zunächst erhielt Sansovinos Plan den Zuschlag. Doch der Beginn der Bauarbeiten verzögerte sich, dann kamen die Türkenkriege dazwischen, und schließlich starb Sansovino im Jahre 1570. Erst 1587 wurde das Projekt wieder ernsthaft in Angriff genommen. Schließlich erhielt ein Mann den Auftrag, der eher der zweiten Riege der Architekten angehörte, nämlich Antonio da Ponte, der 1588 mit dem Bau begann und ihn 1591 fertigstellte. Es wird überliefert, dass da Ponte sich stark an den verlorenen Entwurf Michelangelos angelehnt habe. Erwähnt sei, dass sich die Baukosten auf die astronomische Summe von 245.537 Dukaten beliefen. Um eine Vorstellung von der Höhe dieses Betrages zu bekommen, muss man sich vergegenwärtigen, dass 1.000 Dukaten für eine Familie ausreichend waren, um ein Jahr lang einen Palast zu unterhalten und üppig zu leben; ein normaler Arbeiter verdiente etwa 12 Dukaten im Jahr. Die Brücke hat eine Spannweite von mehr als 28 m und ist etwa 7,5 m hoch. Um das große Gewicht und den gewaltigen Schub auffangen zu können, war es erforderlich, mehr als 12.000 Stämme in den Boden zu rammen.
Man kann die Brücke sowohl von der Ecke des Fondaco dei Tedeschi als auch von der nach links gelegenen Riva del Ferro gut betrachten. Sicher gibt es kaum ein Bauwerk der Stadt, das einen derartigen Bekanntheitsgrad erreicht hat wie die Rialtobrücke, sie ist das Symbol Venedigs schlechthin geworden. Dabei ist sie eigentlich ein ganz einfacher Zweckbau, der nicht nur dem Verkehr zu Lande und auf dem Wasser, sondern sehr wesentlich auch dem Handel diente. Wie der Ponte Vecchio in Florenz, so ist auch der Ponte di Rialto mit einer ununterbrochenen Reihe von Läden zu beiden Seiten der mittleren Haupttreppe besetzt, und zwar mit jeweils zwölf Kaufläden. An den Rückseiten dieser Läden verlaufen beidseits weitere Treppenrampen, die von kräftigen Balustraden gesäumt sind. Von diesen aus öffnet sich der Blick über die Wasserbahn des Canal Grande. Wie viele andere Brücken der Stadt besitzt auch die Rialtobrücke in ihrer Mitte eine ebene Plattform, die hier durch rustizierte Rundbögen und einen Dreiecksgiebel herausgehoben ist. Die Brücke entstand unter dem Dogen Pasquale Cicogna, dessen Wappen auf beiden Seiten in den Bogenzwickeln zu sehen ist. Sie hat auch eine plastische Ausstattung erhalten: Im Bogenscheitel der Südfassade sieht man den Hl. Geist, links und rechts davon in Ufernähe die Figuren einer Verkündigung; auf der Nordseite ist der Markuslöwe mit den hll. Markus und Theodor dargestellt. „Die Brücke ist das Ergebnis einer fast 100 Jahre umspannenden Planungs- und Prüfungstätigkeit, die langsam aber zäh alle Momente ausschied, welche der besonderen venezianischen Architekturtradition des Brückenbaus entgegenstanden, während gleichzeitig alle jene Züge geklärt und hervorgebildet wurden, die Zweck, Sinn und Würde dieses Bauwerks fördern konnten“, sagt Hubala, der die Brücke als ein städtebauliches Monument ersten Ranges und als ein Symbol venezianischer Baukunst bezeichnet.
Ganz reibungslos scheint die Errichtung der Brücke jedoch nicht vonstattengegangen zu sein, was sich aus einer Legende ergibt: Beim Bau der jetzigen Brücke aus Stein und mit nur einem einzigen Bogen kam es zu Schwierigkeiten. Alle Versuche, den Plan Antonio da Pontes zu realisieren, scheiterten, da alles, was die Handwerker tagsüber erbauten, in der Nacht wieder einstürzte und nur die Gerüste verhinderten, dass die Steine in den Canal Grande fielen. Der Baumeister war ein gewisser Sebastiano Bortoloni. Der stammte aus guter Familie, war ein ernsthafter Arbeiter und wollte sich mit dem Bau der Brücke den Weg in eine erfolgreiche Zukunft ebnen, dies umso mehr, als seine Frau Chiara binnen kurzem ein Kind erwartete. Weil die nächtlichen Unfälle nicht abrissen, beschloss Sebastiano, sich des Nachts auf die Lauer zu legen und zu beobachten, was denn da geschehe. Um Mitternacht hörte er einen gewaltigen Lärm, und ein großes Stück des Brückenbogens stürzte ein. Der junge Baumeister erstarrte zu Eis, als er gleichzeitig hinter seinem Rücken ein heimtückisches Lachen hörte. Er drehte sich um und sah sich einer hohen männlichen Gestalt gegenüber, die in einen schwarzen Mantel gehüllt war. Das war der Teufel, der sich an Sebastiano mit den Worten wandte: „Du mühst dich vergeblich ab. Kein Mensch wird es je schaffen, diese Steinbrücke zu errichten. Doch wenn du willst, so helfe ich dir. Aber natürlich ist dafür ein Preis zu bezahlen“. „Was willst du für deine Hilfe“, fragte der Mann, „willst du meine Seele“? „Nicht deine Seele“, erwiderte der Teufel, „dafür aber die des ersten Lebewesens, das die Brücke überquert, wenn sie fertig ist“. Der junge Mann überlegte nicht lange und willigte ein. Denn er war überzeugt, dass es ihm gelingen werde, den Teufel hereinzulegen. Die Arbeiten gingen voran, der Teufel hielt sein Wort, alles blieb intakt und die Brücke wurde rasch fertig. In der Zwischenzeit hatte Sebastiano die Idee, sich einen Gockel in einem Korb zu besorgen. Der Teufel hatte nämlich nicht ausdrücklich davon gesprochen, dass es ein Mensch sein müsse, der die Brücke zuerst überquert. Den Hahn wollte er am nächsten Morgen auslassen und so den Teufel betrügen. Dazu hatte er strikte Anweisung gegeben, dass niemand über die Brücke gehen dürfe. Doch der Teufel war schlauer als er. Er verkleidete sich als Maurer, klopfte an die Haustür der Familie des Sebastiano und erklärte dessen Frau, ihr Mann habe diese Nacht noch auf der Baustelle bleiben müssen und lasse ihr sagen, sie solle sofort kommen. Sie folgte ihm, und die Wachen an der Brücke, die sie kannten, ließen sie passieren. Als Sebastiano, der mit seinen Arbeitern zu Abend aß und feierte, die Augen hob, sah er Chiara auf der Brücke und erschauerte. In der folgenden Nacht konnte er nicht schlafen vor lauter Sorgen darüber, was denn nun geschehen werde. Er musste nicht lange warten. Am nächsten Tag, nach der feierlichen Eröffnung der Brücke, kam seine Dienerin zu ihm gelaufen, um ihm zu sagen, dass das Kind tot geboren sei und dass auch Chiara im Sterben liege. Er rannte sofort nach Hause, doch er kam zu spät, denn seine Frau war schon tot. Seit diesem Tag begann das ungetaufte Kind, auf der Brücke zu spuken. Ein jeder, der die Brücke alleine und in kalten Nächten überquerte, konnte es leise niesen hören. Einmal kam ein alter Gondoliere nachts vorbei und hörte das Niesen. Er sah zwar niemanden, doch sagte er laut „Salute“, worauf eine Kinderstimme antwortete „Grazie“ – das war das Seelchen des Kindes, das auf diese Weise nun endlich erlöst war und zum Himmel fliegen konnte.
Der weitere Weg führt nach links über die Riva del Ferro und geht an den approdi, den Anlegestationen der Vaporetti vorbei. Der anschließende Palast mit dem offenen Portikus wurde von Sansovino entworfen, gehörte später dem letzten Dogen Ludovico Manin. Nach der nächsten Brücke steht an der Riva del Carbon (der Kohle) der riesige Palazzo Bembo. Am Ende der Riva liegt das Rathaus der Stadt. Es besteht aus zwei Palästen, deren untere beide Geschosse aus romanisch-byzantinischer Zeit stammen, was an den gestelzten Bögen zu erkennen ist. Der linke Palast heißt Ca’ Loredan, der rechte Ca’ Farsetti. Beide Bauwerke besitzen feine Steinmetzarbeiten, die von der Fondamenta aus gut zu studieren sind. Dagegen erschließt sich die Architektur besser vom Boot oder vom gegenüberliegenden Ufer aus. An der Ecke der Ca’ Loredan ist eine Gedenktafel für Elena Lucrezia Episcopio angebracht, der es als erster Frau gelungen ist, ein Hochschulstudium zu beenden und zu promovieren, und zwar im Jahre 1676 (siehe auch Kapitel > Canal Grande). Sie erhielt dann sogar auch eine Lehrerlaubnis an der Universität von Padua.
Eine Besonderheit ist eine kleine Zeichnung, die im Portikus der Ca’ Loredan an der zweiten Säule von links in Umrissen eingegraben ist. Sie zeigt die Seitenansicht eines Mannes, der eine lange Pfeife im Munde hat, jedoch ohne Arme dargestellt ist. Niemand weiß mehr so recht, wann der Mann, der Biagio hieß, wirklich gelebt hat bzw. wann sich das, was die Legende über ihn erzählt, ereignet haben soll. Über ihn war in Venedig schon lange kaum mehr als sein Name und sein Beruf bekannt – er war in seiner Jugend einmal Fischer. Biagio versuchte, mit seinem wenigen Geld so gut als möglich auszukommen. Er hielt sich immer vor dem Palazzo Loredan auf, wo er dann und wann Hilfsdienste leistete und gegen Lohn kleinere Arbeiten verrichtete. Er war ein gutwilliger Mann, und in den gar nicht so wenigen Augenblicken der Untätigkeit, die er sich genehmigte, liebte er es, am Ufer des Canal Grande vor dem Palast zu stehen und seine lange Pfeife zu rauchen, die wohl sicher so alt war wie er selbst. Eines Abends nun hatte sich der Alte beim Rauchen etwas verspätet. Niemand war mehr in der Nähe und nur ab und zu glitt eine Gondel lautlos vorüber. Plötzlich aber schien das Wasser unter einer der Gondeln auf unerklärliche Weise in einem seltsamen, dunkel-rotvioletten Licht aufzuleuchten. Eigenartige Strudel bildeten sich rund um das Boot und wurden so heftig, dass der Gondoliere beinahe das Gleichgewicht verloren hätte. Dann tauchten plötzlich zwei riesige schwarze Arme zu Seiten der Gondel aus dem Wasser, mit Händen, die Krallen trugen und mit spielerischer Leichtigkeit die felze (das Kabinendach über den Sitzen, das es heute nicht mehr gibt) wegrissen. Drinnen saßen zwei kleine Mädchen, die sich umarmt hielten. Biagio konnte das gerade noch wahrnehmen, als die Hände auch schon nach den Kindern griffen und ein schrecklicher Kopf mit zwei Hörnern aus dem Canal Grande auftauchte. Das Verhalten des Monstrums, die Hörner, die roten Augen und die gewaltigen Fledermausflügel, die so hoch wie ein campanile waren, ließen keinen Zweifel: Das war Satan, der Teufel in Person. Die beiden Mädchen gehörten zur Familie der Gradenigo und schwebten nun in höchster Gefahr, mit ihrer Haut für den Leichtsinn ihres Vaters zu bezahlen, der sich mit allzu großem Eifer dem Wunsche hingegeben hatte, mit Hilfe des Teufels die Geheimnisse der Magie zu enthüllen und diesem frevelhafterweise erlaubt hatte, sich als Lohn seiner Kinder zu bemächtigen. Ohne viel zu überlegen schleuderte Biagio seine Pfeife gegen die furchtbare Erscheinung, was natürlich geradezu lächerlich war. Doch immerhin gelang es ihm damit und mit einem lauten Schrei, die Aufmerksamkeit des Monsters auf sich zu ziehen: „Nein! Lass die Kinder! Nimm mich dafür!“ Der Dämon war von so viel Courage, ja Unverschämtheit überrascht, hob ein wenig sein Haupt und fixierte mit seinen rot flammenden Augen den seltsamen Menschen. Und er nahm an, dass es da etwas gäbe, womit er sich amüsieren könnte. „Wer bist du“, fragte er, „bist du denn ein neuer Christus am Kreuz, dass du glaubst, dich mir widersetzen zu können? Was willst du denn überhaupt, deine Arme können nicht die ganze Erde umarmen, wie er es mit den seinen tat. Doch ich nehme dich an Stelle der Kinder, wenn Du es Christus darin gleichtust.“ Ohne dass Biagio irgendeine Bitte um Hilfe geäußert hätte, lösten sich nach diesen Worten seine Arme von selbst und völlig schmerzlos von seinem Körper und flogen durch die Luft davon, ein jeder Arm nach einer anderen Seite, wobei sie von einem Schwarm von Cherubim umschwirrt wurden. Als der Teufel das sah, war er bezwungen und musste von den beiden Mädchen lassen. Aber auch den Alten bekam er nicht, da Gott selbst das nicht zuließ. Die Chroniken berichten ferner, dass die beiden Arme zurückkamen, als Biagio starb. Seit dieser Zeit soll es manchmal geschehen, dass man, besonders im November, wenn die Nebel über den Wassern des Canal Grande schwanken, den bleichen Schatten Biagios hier direkt vor der Ca’ Loredan schweben sieht. Seine Figur hat keine Arme, jedoch steckt in seinem Mund eine immer brennende Pfeife. Der Alte braucht auch gar keine Arme, um seine Pfeife in Gang zu halten, da sie durch Gottes Willen immer von selbst brennt und auch sein Tabaksbeutel immer gefüllt ist.
Nach links führen mehrere Gassen vom Canal Grande weg in die Stadt und zum Campo San Luca. An ihm gibt es ein Geschäft, dessen Decke von einer Säule getragen wird, die der Überlieferung zufolge den geografischen Mittelpunkt der Stadt bezeichnet. Die Kirche S. Luca, die 1832 völlig umgestaltet wurde, liegt ein wenig abseits. Von ihrer Ausstattung erwähnenswert sind Gemälde von Veronese (Hochaltar) und Carl Loth (1632–98), der den ersten Patriarchen der Stadt, den hl. Lorenzo Giustiniani, als Wunderheiler zeigt. Loth wurde in dieser Kirche bestattet, ebenso Pietro Aretino (1556), der beschrieben wird als homme des lettres und Lästermaul, das sogar von Fürstenhäusern gefürchtet war. Er war ein bedeutender Humanist und der beste Freund von Tizian und Sansovino. Sein Grab in der Kirche ist verschollen (mehr über ihn im Kapitel Canal Grande).
Auf dem Weg zurück zum Campo San Luca umrundet der weitere Weg einen Neubau, dessen Architektur in dieser so konservativ bauenden Stadt überrascht. Es handelt um die Cassa di Risparmio, einen der umstrittensten Eingriffe in den Stadtorganismus. Sicher waren die Gebäude, die hier niedergelegt wurden, um Platz zu schaffen, weitgehend belanglos, aber sie waren immerhin stimmig und hatten einst die Werkstatt des berühmtesten Buchdruckers seiner Zeit, Aldo Manuzius, beherbergt. Die Architekten Nervi und Scattolin gehörten zwar zu den führenden ihrer Zeit, hatten aber wohl wenig von Wesen und Sensibilität Venedigs begriffen oder wollten bewusst einen Fremdkörper schaffen, damit sich dieser umso markanter von seiner Umgebung abheben würde.
Der Campo Manin, der sich vor der Sparkasse bis zum Rio S. Luca erstreckt, entstand in der heutigen Form erst im 19. Jahrhundert. „Der Größenwahn Napoleons, das rücksichtslose Bedürfnis Österreichs nach Ordnung und Symmetrie und schließlich das blinde Vertrauen in die modernen Zeiten bei den Herrschern des Hauses Savoyen fügten dem alten Stadtbild schreckliche Wunden zu und zerstörten eine Unzahl historischer Denkmäler, deren die Menschheit für immer beraubt wurde“ (Giordani). So geschah es wohl auch hier, wo eine Kirche (S. Paternian) niedergerissen wurde, die als Besonderheit einen fünfeckigen campanile besaß, ein Unikum in der Stadt, „den einige venezianische Arbeiter als Dank dafür errichtet hatten, dass sie sich vor der Sklaverei der Sarazenen hatten retten können.“ In der Mitte des Platzes steht heute das Denkmal des Daniele Manin. Er war Advokat und ging in die Geschichte ein als Anführer des Aufstands gegen die Österreicher (1848–49). Die Aufständischen konnten sich erstaunlich lange gegen die Übermacht der Österreicher halten, wurden aber schließlich bezwungen. Manin musste emigrieren und starb 1857 im Exil in Paris. Seine letzte Ruhe fand er an der Nordseite von S. Marco in einem mächtigen Grabmal.
An der linken Längsseite des campo (in Blickrichtung Manins) trifft man auf eine Wegweisung zur Scala del Bovolo bzw. zum Palazzo Contarini. Der Name bovolo ist venezianisch, bedeutet „Seeschnecke“ und beschreibt die sehr eigenwillige Gestalt der außen liegenden hohen Wendeltreppe recht genau. Sie wurde 1499 erbaut und verbindet den Palast mit einem winzigen Gärtchen, in dem heute eine Sammlung schöner pozzi zu sehen ist. Zwischen der Größe der Treppe und der des Gartens gibt es keine vernünftige Relation. Vielmehr verhalten sich beide geradezu umgekehrt proportional zueinander. Trotzdem ist das Ganze ein liebenswertes Detail der Stadt und ein architektonisches Kleinod, das heiter stimmt. Die Treppe kann (gegen Gebühr) bestiegen werden, was in jedem Fall ratsam ist, da es ja nur ganz wenige Möglichkeiten gibt, die Stadt von oben zu betrachten. Hier hat man nach allen Seiten einen freien Blick über eine vielfältige Dachlandschaft. Besonders gut ist von dort oben auch der Aufbau der eben besichtigten Kirche S. Salvatore mit ihren Kuppelkonstruktionen zu sehen, ebenso das Gran Teatro la Fenice, das das Niveau der Dächer deutlich überragt.
Zurück am Campo Manin, überquert man den Ponte della Cortesia (der Höflichkeit) und gelangt in die gleichnamige Gasse, die in ihrem weiteren Verlauf in die Calle della Mandola übergeht, eine sehr belebte Gasse mit vielen zum Teil recht schönen Läden. An der Grenze zwischen den beiden Gassen weist ein etwas verblichenes Schild den Weg in die Salizada del Teatro und zum Palazzo Fortuny am Campo S. Benedetto (S. Beneto auf Venezianisch) mit der gleichnamigen, immer geschlossenen Kirche. Der eigentliche Name des Palastes ist Palazzo Pesaro degli Orfei. Der mächtige gotische Bau mit einer eindrucksvollen Fenstergruppe und einem wild bewachsenen, verwunschen wirkenden Garten hat seinen zweiten Namen von seinem letzten spanischen Besitzer Mariano Fortuny y Madrazo (1871–1949), den man ohne weiteres als universelles Genie bezeichnen kann. Er war Maler, „Designer“, Dichter, Ingenieur, Bühnenbildner, Fotograf und vieles mehr, lebte und arbeitete in dem Palast von 1899 bis zu seinem Tode. Es wird berichtet, er habe an einer Allergie gegen Pferde gelitten und sei aus diesem Grunde auf die Idee gekommen, in Venedig zu leben. Bekannt wurden besonders seine plissierten, von Gewändern der Antike inspirierten Kleider, von denen eines delphos heißt. Originale dieser Kleidungsstücke werden heute zu hohen Preisen gehandelt, und auch Nachahmungen sind nicht gerade billig. Deren Verkäuferinnen machen darauf aufmerksam, dass man sich nicht setzen und nicht anlehnen dürfe, da sonst das Plissée ruiniert würde. Die Methode zur Herstellung eines dauerhaften Plissées hat Fortuny mit ins Grab genommen. Seine Witwe hat den Palast, der heute ein Textilmuseum beherbergt, der Stadt vermacht. Das Atelier Fortunys ist erhalten geblieben.
In der Nähe gibt es eine Calle dei Assassini, die ihren Namen von häufigen Morden hat, die auf einer hier früher existierenden Brücke begangen wurden. Die Täter waren dabei meist maskiert, weswegen schließlich 1128 das nächtliche Maskentragen verboten wurde.
Über die Calle del Spezier führt der Weg zum ruhigen, wohltuend weiten Campo Sant’ Angelo bzw. Sant’ Anzolo (venezianisch für „Engel“), wo sich ein freier Blick auf den schiefsten Turm Venedigs bietet, den der Kirche S. Stefano. An der Fassade des gotischen Palazzo Duodo links erinnert eine Tafel an Domenico Cimarosa (1749–1801), der hier zahlreiche Opern schrieb und in diesem Haus starb. Weitere schöne Paläste säumen den campo, bei dem, wie auch an anderen Stellen der Stadt, das angehobene Niveau auffällt. Das diente der Wassergewinnung in der darunter gelegenen Zisterne. Die Venezianer erzählen allerdings gerne, die Anhebungen seien entstanden, weil auf den entsprechenden Plätzen zu Zeiten der großen Epidemien Massengräber angelegt worden seien. Die für den Platz namensgebende Kirche S. Angelo, in der auch der Komponist Cimarosa begraben lag, wurde 1837 demoliert.
Man überquert den Platz bis zur Brücke in dessen rechter Ecke, der Ponte dei Frati. Von ihr aus kann man den 1532 entstandenen Kreuzgang des ehemaligen Klosters S. Stefano betreten. Das Architekturschema weicht von den für Venedig typischen Säulenarkaden zu Gunsten einer Kolonnade ab, ein Motiv, das eher römisch anmutet und an Bramantes Kreuzgang von S. Maria della Pace denken lässt. Der Kreuzgang war mit Fresken von Pordenone ausgemalt, deren Reste in der > Galleria Franchetti in der Ca’ d’Oro zu sehen sind.
Die Legende berichtet von einer heftigen Rivalität zwischen diesem Maler und Tizian. Sie soll emotional so sehr aufgeladen gewesen sein, dass Pordenone angeblich nur bewaffnet an die Arbeit gegangen sei, um entsprechend gerüstet zu sein, sollte Tizian einmal unvermutet auftauchen.
In diesem Kreuzgang wurde Pietro Lombardo begraben, daneben auch die Angehörigen des Hauses Carrara, die früheren Herren von Padua, die die Signoria als unliebsame Gegenspieler und Störenfriede im Gefängnis hatte erdrosseln lassen.
Am Ende der folgenden Gasse, an der Stelle, die sich zum Campo S. Stefano öffnet, biegt nach rechts die Calle delle Botteghe ab, in der einige sehr edle Antiquitätengeschäfte und Galerien zu finden sind. Deren Reihe setzt sich in der Salizzada S. Samuele fort, die man am Ende der calle erreicht. Hier steht unter der Hausnummer 3328 das bescheidene Wohnhaus Paolo Veroneses. Der Weg erreicht schließlich am Campo S. Samuele (die gleichnamige Kirche ist profaniert) wieder den Canal Grande. Das von dieser Stelle aus zu überblickende Ensemble mit den flankierenden Palästen ist sehr stimmungsvoll und bietet einen hinreißenden Blick auf die gegenüberliegenden Gebäude (Ca’ Rezzonico, weiter rechts der Doppelpalast der Giustiniani, unmittelbar daran angrenzend die Ca’ Foscari, schließlich auf der anderen Seite des hier mündenden Kanals die Ca’ Balbi). Am campo selbst ragt rechts die Seitenfront des Palazzo Grassi auf, der 1718 von Giorgio Massari erbaut wurde (> Kapitel Canal Grande).
Mehrere Gassen – in einer von ihnen wurde 1725 Casanova geboren – führen in Richtung Osten zum Campo S. Stefano (auch Campo Morosini genannt).
Das ganze Viertel hatte zu Zeiten der Republik keinen guten Ruf, wie ein Spottgedicht zeigt: „San Samuele / Contrada Picola / Grande Bordel / Senza ponti´ / Cative campane / Omeni bechi / E done putane“ – „San Samuele / kleines Stadtviertel / großes Bordell / ohne Brücken / mit schlecht klingenden Glocken / die Männer gehörnt / die Frauen Huren.“ (Tassini)
Der Campo S. Stefano ist sicher eine der schönsten Platzanlagen der Stadt. Er war bis 1810 ein bevorzugter Ort für Volksfeste, Turniere und die in Venedig sehr beliebten Stierkämpfe. Es lohnt, sich Zeit zu nehmen, um das Ensemble kreuz und quer zu durchschreiten und auch das Angebot zu Ruhe und Kontemplation in einem der Cafés wahrzunehmen. Der Eindruck des Theatermäßigen, Kulissenhaften, den die Stadt recht häufig vermittelt, ist hier besonders stark und nachts, wenn kaum mehr Menschen unterwegs und oft nur mehr die Stimmen Unsichtbarer zu hören sind, fast überwältigend.
Wichtige Gebäude säumen den Platz. Da ist zunächst an der nördlichen Schmalseite die schlichte Seitenfront der
► Kirche S. Stefano
mit einfachen spitzbogigen Fenstern. Der Bau entstand im späten 14. Jahrhundert, wurde im 15. Jahrhundert im Chorbereich umgestaltet und erhielt bei diesem Umbau auch seine hölzerne Decke. Die Hauptfassade, zum Campiello S. Stefano hin gelegen, ist dreiteilig und mit weißen Marmortabernakeln bekrönt – ein traditionelles Gestaltungsmotiv gotischer Sakralbauten Venedigs. Das Portal ist geradezu umschäumt von einem üppigen Ornament aus Blattranken. Eine Besonderheit weist das Äußere der Kirche im Chorbereich auf. Der Chor ist über einen rio hinweggeführt und kann mit dem Boot unterquert werden. Diese Anlage ist vom Campo S. Anzolo aus sichtbar oder auch von der ersten Brücke, dem Ponte S. Maurizio, wenn man in Richtung S. Marco weitergeht. Den Innenraum bildet eine dreischiffige gotische Säulenbasilika mit weiten Jochen und einem dreiteiligen Presbyterium. Der Besucher empfängt allerdings eher den Eindruck, in einem Saal zu stehen als in einer Basilika, da die Stellung der – eigentlich zu schlanken – Säulen den Raum kaum unterteilt und die Schiffe somit nicht wirklich voneinander trennt. Während die Seitenschiffe durch Pultdächer gedeckt sind, wird das Mittelschiff durch eine spektakuläre kassettierte Holzdecke in Form eines umgedrehten Schiffsrumpfes überspannt. Sie soll von den Schiffbauern des Arsenals, den arsenalotti, ausgeführt worden sein. Ins Auge springt die Wandstruktur der Obergadenzone, deren Muster in Anlehnung an das am Dogenpalast gestaltet wurde, wobei dieses Ornament in Venedig früher häufiger anzutreffen war als heute.
Ausstattung: Im Boden des Mittelschiffs, gleich beim Eingang, liegt unter einer mächtigen reliefierten Bronzeplatte der Doge Francesco Morosini, der „Peloponesiaco“, begraben. Er hatte 1685 noch einmal die Peloponnes von den Türken zurückgewonnen. Am Ende des rechten Seitenschiffs führt ein schönes Renaissanceportal von 1525 in die sehr sehenswerte Sakristei. Die Türflügel dieses Portals sind moderne Arbeiten, sie stellen Johannes XXIII. Roncalli rechts und Giovanni Paolo I. Luciani links dar, beides Päpste, die zuvor Patriarchen von Venedig waren. Die Sakristei enthält eine Sammlung vorzüglicher Werke (deren Aufstellung ab und zu wechselt). Auf dem Altar steht die Büste des hl. Sebastian von Tullio Lombardo. Das kleine Werk ist köstlich gearbeitet und sprüht vor Leben. Es ist sicher eine der besten Arbeiten Tullios, und die Marmorbehandlung lässt an die besten Werke der griechischen Klassik denken. Zu Seiten dieser Plastik sind zwei weitere Statuen zu sehen, eine davon, vermutlich ein hl. Hieronymus, ist von Pietro Lombardo signiert, von dem auch die andere stammt, die Paulus darstellt. Die Altarädikula wird von zwei schönen Statuetten der Brüder dalle Masegne flankiert, links steht Giovanni Battista, rechts Antonius von Padua. Weiterhin ist hinzuweisen auf Bartolomeo Vivarinis Gemälde der hll. Nikolaus und Lorenz beidseits neben der Altararchitektur, die aus der profanierten Kirche S. Vidal hierher kamen. Schließlich stehen auf einer Truhe links zwei Figuren: Johannes der Täufer und eine Frauenfigur, eventuell eine allegorische Darstellung einer Tugend. Die hohe Qualität der Arbeiten lässt ohne weiteres annehmen, dass sie von Tullio Lombardo gearbeitet wurden. An der linken Seitenwand hängt ein großformatiges Gemälde Tintorettos, eine Version des Themas Abendmahl, dem sich der Maler wiederholt gewidmet hat. Der Tisch, an dem sich die Handlung vollzieht, ist hier auf ein Podest gestellt, somit ist die Szene in deutlicher Untersicht gegeben. Das Bild, bei dem es sich um eine schwächere Interpretation des Themas handelt, dürfte nicht in allen Partien eigenhändig sein. Zwei weitere Gemälde Tintorettos hängen an der rechten Seitenwand, links eine Fußwaschung mit undeutlicher Lichtführung, rechts daneben Christus am Ölberg. Dieses Bild ist von einem geheimnisvollen Weben des Lichtes erfüllt. Christus wird fast wie ein Schlafender gezeigt, wie ein Mensch, der sich in sein unabwendbares Schicksal fügt, „überzeugt“ und gleichzeitig getröstet vom Engel, der den Kelch bringt, während die Jünger zu Füßen dieses Geschehens schlafen und in Bildmitte links die Häscher auftauchen. An der Eingangswand hängen koloristisch reizvolle Bilder von Diziani. Besonders hübsch und originell ist die Flucht nach Ägypten links oben, die hier unter dem Schutz von zwei prachtvollen Engeln auf einem Schiff bewerkstelligt wird.
Im Chor, der über einer Krypta erhöht ist, sind hochinteressante Fragmente einer Chorschranke von 1488 aufgestellt, deren Entwurf Pietro und Tullio Lombardo zugeschrieben wird. Die örtliche Beschriftung spricht dagegen nur von einer bottega lombarda und datiert die Apostelstatuen in das Jahr 1480. Ein schönes Werk ist der Hochaltar, der 1613 begonnen und wohl erst 1656 fertiggestellt wurde. Das Tabernakel, das von einem gewaltigen Triumphbogen überfangen und gerahmt wird, ist edel proportioniert. In den beiden seitlichen Intervallen stehen große Statuen von Campagna, die die hll. Markus und Klara darstellen. Sie sind aus patiniertem Holz gearbeitet, also in einer Technik, die Bronze vortäuschen soll. Vor dem letzten Seitenaltar links findet sich die Grabplatte für Giovanni Gabrieli (1557–1612), Kapellmeister von S. Marco, bedeutender Komponist des Frühbarock und Lehrer von Heinrich Schütz.
Es wird berichtet, dass 1594 eine Marietta da Leze, Witwe von Gerolamo Bragadin, dann erneut verheiratet mit einem Carlo Foscari, in S. Stefano beigesetzt wurde. Wenig später jedoch erwachte sie aus ihrem todesähnlichen Schlaf. Zu ihrem Glück befanden sich einige Novizen des Konvents in der Nähe ihrer Gruft, so dass ihre Rufe bemerkt wurden und sie gerettet werden konnte. Zum Dank verfügte sie, dass alle zwei Jahre zehn Brüder des Konvents auf Kosten der von ihr eingerichteten Stiftung eingekleidet werden sollten. – In der Geschichte Venedigs gab es mehrere Fälle von Scheintod, die ihren Niederschlag auch in den Legenden der Stadt fanden.
Zurück zum Campo S. Stefano: Inmitten des Platzes steht das Denkmal für Niccolò Tommaseo (1802–74), der am Aufstand von 1848 gegen die Österreicher teilnahm. „In einer mutigen Rede in der Akademie wandte sich der Dichter, Romancier, Lyriker, Lexikograph, Verfasser pädagogischer und politischer Streitschriften 1847 gegen die Zensur des österreichischen Stadtregiments von Venedig.“ (Maurer). 1849 musste er fliehen und starb schließlich in Florenz. Der Bildhauer gestaltete den Stabilisator der Statue als Bücherstapel, „Dante“ und „Omero“ (Homer) ist auf den Buchrücken zu lesen. Dieser Bücherpfeiler scheint unter dem Mantel Tommaseos hervorzukommen, Grund für die Venezianer, das Ganze respektlos als caccalibri („Bücherscheißer“) zu bezeichnen.
Weiter links ragt der langgestreckte Palazzo Loredan in den campo hinein. Die Familie der Loredan führte sich bis auf den Römer Mucius Scaevola zurück. Zwar nannten sich dessen Nachfolger zunächst Mainardi, erhielten aber nach mehreren gewonnenen Schlachten den Beinamen Laureati, was zu Lauretani und weiter zu Loredani verändert wurde. In diesem Palast wohnte Leonardo Loredan, Doge von 1501 bis 1521, unter dem nach dem Krieg gegen die Liga von Cambrai Venedigs politischer Abstieg begann und den Giovanni Bellini herrlich porträtiert hat (das Bild hängt heute in der National Gallery, London). Die lange Front mit dem großen Fenster im Obergeschoss baute Scarpagnino, die zierliche Fassade zum Platz hin stammt von Giovanni Grapiglia (1618). Ursprünglich war der Palast mit Fresken von Salviati bemalt. Seit 1891 beherbergt er das Istituto Veneto degli Scienze, Lettere ed Arti und dessen Bibliothek von etwa 200.000 Bänden.
Dem Palazzo Loredan gegenüber weitet sich der campo zu einem zweiten Platz, an dem sich der riesige Palazzo Pisani erhebt. Mit seinem Bau wurde 1614/15 begonnen, also zu einer Zeit, in der es keine herausragenden Architekten gab. In Anbetracht dessen beschloss der Bauherr Alvise Pisani, seinen Palast ohne benennbaren Baumeister errichten zu lassen und stützte sich stattdessen auf die Erfahrung bewährter Handwerker. Die Fassade hat zwar gewaltige Dimensionen, ist aber nicht geglückt, sondern wirkt eigenartig wackelig. 1728 wurde der Palast unter Francesco Frigimelica aufgestockt und erweitert. Er wurde später im Inneren oft umgebaut und den Bedürfnissen der Bewohner angepasst. Nur der Teil am Campo Morosini wurde noch bis 1880 von der Familie bewohnt, die in diesem Jahr in der männlichen Linie ausstarb. 1940 wurde der gesamte Palast Sitz des Konservatoriums, das schon seit 1880 einige Räumlichkeiten benutzte. Der Palast kann nicht besichtigt werden. Wandelt man über den campiello, so dringen oft brillant gespielte Kaskaden von Tönen aus den Fenstern. Nach dem Untergang der Republik wurde das Gebäude des größten Teils seiner kostbaren Ausstattung beraubt, abschnittsweise verkauft und auch in Mietwohnungen umgewandelt. Nur noch in den Räumen der Direktion gibt es ein paar verschlissene Reste der alten Wandbespannungen. Daneben existiert noch ein erstaunlich intakter zweistöckiger Ballsaal, der an ein Kapitel in Lampedusas „Il Gattopardo“ denken lässt.
Links neben dem Palazzo Loredan wendet die Kirche S. Vidal (oder San Vitale) ihre Fassade schräg gegen den campo, wodurch eine besonders eindrucksvolle, kulissenhafte Wirkung entsteht. Die Säulenfront stammt von Andrea Tirali (1700), der sich der Formensprache Palladios bediente und sich stilistisch insbesondere an dessen Kirche S. Giorgio Maggiore anlehnte. Die Kirche selbst wurde im 12. Jahrhundert gegründet und im 18. Jahrhundert von Gaspari neu errichtet. Der campanile stammt dagegen aus dem 13. Jahrhundert. Lange war die Kirche geschlossen, Ausstattung bzw. Gemälde waren verstreut. Jetzt ist sie wieder zugänglich und dient für Ausstellungen und Konzerte. Der schlichte Saalraum, dessen Besuch sich in jedem Falle lohnt, besitzt ein Muldengewölbe, in das vier Thermenfenster eingeschnitten sind. Die Wände sind durch kraftvolle korinthische Halbsäulen gegliedert, zwischen denen Altäre stehen, das Gebälk ist kräftig verkröpft. Über den Altären hängen jetzt wieder einige sehr schöne Gemälde. Erwähnt sei am dritten Altar rechts ein Gemälde Piazzettas, der Erzengel Raphael mit den hll. Antonius von Padua und Ludwig aus dem Jahre 1730. Es ist in den schönen erdigen Tönen gemalt, die Piazzetta besonders liebte. Auf dem Hochaltar steht ein in leuchtenden Farben gehaltenes Gemälde Carpaccios von 1514, Der heilige Vitalis und acht Heilige, gestaltet in streng symmetrischer Komposition und mit fast aufdringlicher Anwendung kompositorischer Gesetze (der sogenannten „Drittelregel“, dies sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung). Bei den anderen Gemälden von geringerer Bedeutung mag man an Jakob Burckhardts Wort denken, als er einem Freund schrieb: „… wenn Du wieder in Zürich bist und der Schnee fällt, dann wärest Du froh, wieder vor einem Altarblatt fünfter Ordnung stehen zu können.“
Rechts gegenüber der Kirchenfassade ragt der neugotische, recht eigenartige Anbau des mächtigen Palazzo Cavalli Franchetti aus einem Garten (Franchetti war auch Besitzer der Ca’ d’Oro und rettete diese vor dem Untergang). Auch dieser Palast befindet sich im Besitz des Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti und wird seit 2005 für Ausstellungen genützt. Für den Besucher hält das Gebäude einige Überraschungen bereit. Schon das Treppenhaus bereitet einiges Erstaunen, denn es entspricht stilistisch dem neugotischen Anbau – und beinahe könnte man versucht sein, von einem venezianischen Neuschwanstein zu sprechen: Alles ist üppig, bunt, überladen, formal nicht geklärt. Die Räumlichkeiten des alten Teils des Palastes sind weitgehend verändert und größtenteils ebenfalls neugotisch umgestaltet. Sie besitzen kostbare intarsierte Parkettfußböden, die für sich gesehen sehr schön sind, in einem venezianischen Palazzo aber unpassend wirken. Der östlich vom Portego gelegene Raum hat noch einen reich verzierten und vergoldeten Soffitto aus der Renaissance, und in einigen Räumen hängen prächtige Murano-Leuchter. Das Schönste an dem Palast ist zweifelsohne seine wundervolle Fassade, die sehr gut von der Accademia-Brücke aus zu überblicken ist. Die ist mit ein paar Schritten zu erreichen, und von ihrem Scheitel bieten sich herrliche Blicke über den Canal Grande bis zur Salute-Kirche auf der einen, bis zur Ca’ Rezzonico auf der anderen Seite und ebenso über die Dächer des Dorsoduro.
Von der Mitte des Campo S. Stefano zweigt die Calle del Spezier nach Osten ab und führt in Blickrichtung des Denkmals gemäß der Wegweisung nach S. Marco.
An der Ecke dieser calle zum campo befand sich früher eine Apotheke. Vor dem jetzigen Geschäft sind im Pflaster des Platzes ringförmige Vertiefungen zu sehen, für die es zunächst keine rechte Erklärung gibt. Der Überlieferung nach rühren sie von großen Mörsern her, die hier im 18. Jahrhundert standen und bei der Zubereitung der bereits erwähnten venezianischen Spezialität dieser Zeit benutzt wurden, der sogenannten Teriaca Fina di Venezia, auch einfach Teriaca genannt.
Die erste Brücke nach der Calle del Spezier heißt Ponte S. Maurizio, von der aus zu sehen ist, wie der rio die Apsis von S. Stefano unterquert. Die Gasse führt, kurz bevor sie sich zum Campo S. Maurizio öffnet, an der früheren Scuola degli Albanesi vorbei, deren Fassade Reliefs aus dem Jahre 1540 trägt. Der Campo S. Maurizio wird von hohen, strengen, überwiegend gotischen Palastfassaden umstanden. Der Palast an der Ecke stammt aus dem 16. Jahrhundert und trug Fresken Veroneses, die heute verloren sind. Alessandro Manzoni, der Dichter der „Promessi sposi“ wohnte hier 1803–04.
Auch auf einen Giorgio Baffi, der außerhalb Venedigs wohl weitgehend unbekannt ist und der hier 1694–1768 lebte, verweist eine Inschrift. Sie bezeichnet ihn als „poeta dell’amore, che ha cantato con la massima libertà e con grandiosità di linguaccio – Dichter der Liebe, der mit größter Freiheit und der Großartigkeit eines Lästermauls geschrieben hat“. Tatsächlich sind seine überwiegend erotischen Gedichte, die er im venezianischen Dialekt verfasst hat, außerordentlich freizügig. Guillaume Apollinaire bezeichnete den Autor der Gedichte als „le plus grand poète priapique – größten Dichter der Fruchtbarkeit“. Baffis Werke waren sehr bekannt und wurden „in allen Cafés vorgetragen“ (Corto Maltese). Heute soll ihre Beliebtheit völlig unvermindert sein – allerdings sind sie wohl nur Muttersprachlern zugänglich.
Die 1806–26 erbaute Kirche S. Maurizio stellt nach Meinung der Mehrzahl der Autoren eine Replik der Sansovino-Kirche S. Geminiano dar, die der Ala Napoleonica an der Piazza weichen musste. Nach anderen Quellen (Brusegan) waren Antonio Diedo und Gianantonio Selva die Architekten. Die Kirchengründung geht bis auf das 9. Jahrhundert und die Familie der Candiano zurück. Ein Vorgängerbau von 1560 wurde 1806 abgerissen. Das jetzige Gebäude entstand in den Jahren bis 1828. Die Kirche ist heute profaniert und enthält ein kleines Museum alter Musikinstrumente. Der Raum zeigt den Typus der Kreuzkuppelkirche in reinster Form und ist so ausgewogen und harmonisch, dass man ihn fast melodisch nennen möchte. Er ist von einem feinen Schwingen beseelt, das von den vertikal und horizontal verlaufenden Bögen ausgeht. Besonders belebend wirken die mächtigen Dreiviertelsäulen, die die zentrale Pendentiv-Kuppel tragen.
Weiter in Richtung S. Marco liegt der Campo S. Maria Zobenigo (oder S. Maria del Giglio). Die Namen erinnern an das ausgestorbene Gründergeschlecht der Jubanico, beziehen sich aber auch auf die Lilie, mit der der Erzengel Gabriel vor Maria erscheint. Die
► Kirche S. Maria del Giglio (San Zobenigo)
ist dem Geheimnis der Verkündigung geweiht. Sie geht auf das 9. Jahrhundert zurück und wurde mehrfach, zuletzt im 17. Jahrhundert, komplett umgestaltet. Die Familie der Barbaro hat die Kirche in dieser Zeit mit großen Stiftungen bedacht und finanzierte auch die von Giuseppe Sardi entworfene Fassade. Diese Schaufront ist ungewöhnlich dadurch, dass ihre Statuen nicht wie üblich Heilige, sondern vielmehr Angehörige der Familie Barbaro darstellen. Auch die Reliefs mit Plänen venezianischer Festungen (so z. B. die von Zara, Padua, Korfu, Spalato) nehmen auf diese Familie Bezug, die dort Besitzungen hatte. Den plastischen Schmuck der Fassade schuf Justus le Court. Sie wird durch kräftige Säulenpaare und klar gezogene Gesimse gegliedert, ein Motiv, das vom römischen Barock übernommen wurde. Der Innenraum ist ein schlichter Saal mit jeweils drei flachen Seitenkapellen und hohem, einteiligem Presbyterium.
Ausstattung: Zu beiden Seiten des Haupteingangs hängen vier Sibyllen Salviatis, weiter rechts an der Eingangswand ein Auferstandener Christus von Giulio del Moro aus dem 16. Jahrhundert. Dahinter ist ein kleines Relief Hl. Hieronymus in der Felsengrotte zu sehen, das Pietro Lombardo zugeschrieben wird. Nach dem ersten Seitenaltar findet sich der Eingang zur Cappella dei Molin, über deren Türe eine Büste eines Gerolamo Molin von Vittoria zu sehen ist; auf dem Altar der Kapelle steht eine schöne Pietà von del Moro. Vor der Rückwand der Kapelle ist eine Heilige Familie von Peter Paul Rubens aufgestellt, das einzige Gemälde des Malers in Venedig. Es ist „ein Bild mit leuchtender Körperlichkeit der Figuren“, wie es in dem Führer des Chorus-Projekts heißt. Trotz dieser klangvollen Beurteilung gehört das Bild sicher nicht zu den stärksten Werken des Malers. Den Höhepunkt der Ausstattung stellen die ehemaligen Orgelflügel dar, die von Tintoretto mit Darstellungen der vier Evangelisten bemalt wurden und die sich im Presbyterium befinden. Es handelt sich um Frühwerke aus dem Jahre 1550, die noch aus der manieristischen Phase des Künstlers stammen, weshalb Posen und Bewegungen der Figuren etwas gesucht und gewaltsam wirken. An den Wänden des Presbyteriums stehen Grabmäler der Contarini, von denen das für einen Giulio Contarini auf der linken Seite eine sehr schöne Portraitbüste von Vittoria besitzt.
Von der Kirche aus führt ein kurzer Weg zum Canal Grande. Eine schöne Aussicht bietet die Terrasse des Hotel Gritti, das auf der linken Seite des campo liegt.
Vom Campo S. Maria del Giglio zog sich im 10. Jahrhundert eine lange Mauer bis hin nach S. Pietro di Castello, die unter dem Dogen Pietro Tribuno (888–912) errichtet wurde. Vom Eckpunkt der Mauer konnte bedarfsweise eine Kette hinüber nach S. Gregorio auf dem Dorsoduro gespannt werden, durch die der Canal Grande gegebenenfalls abgesperrt und geschützt werden konnte. Diese Befestigungsanlagen, von denen heute nichts mehr erhalten ist, wurden letztmals 1380 im Krieg gegen die Genuesen eingesetzt. Es existiert hier seit Jahrhunderten eine Fährstation, ein traghetto, das zum Dorsoduro übersetzt. Es heißt auch, dass früher hier einmal eine Jungfrau lebte, die den Dienst der Fährleute verschmähte, weil sie einfach über den Canal Grande hinwegzuschreiten vermochte.
In der Pfarrei von S. Maria del Giglio lebte einst der Patrizier Michele Steno, dem die Legende eine wesentliche Rolle im Drama um den Dogen Marino Falier zuschreibt. Die Geschichte dieses Dogen ist bekannt, weniger sind es jedoch die Hintergründe, die zu dessen Verschwörung und damit zu seiner Hinrichtung geführt haben sollen. Es wird erzählt, dass Steno 1355 an einem vom Dogen veranstalteten Ball teilnahm. Bei dieser Gelegenheit machte er einen Scherz, den ihm der Doge so übel nahm, dass er ihn des Festes verwies. Steno rächte sich für diesen Eklat mit einem Spottvers: „Marin Falier mit der schönen Frau, andere genießen ihre Gunst, aber er kommt für sie auf“ (zum besseren Verständnis sei gesagt, dass die Dogaressa wesentlich jünger als der Doge war). Verständlicherweise war Falier wegen dieses seine Ehre beleidigenden Verses aufgebracht. Er strengte deshalb ein Verfahren gegen Steno an und wollte auf diese Weise eine strenge Bestrafung erreichen, konnte sich aber bei der Signoria nicht durchsetzen. Da sich Falier somit auf legalem Weg nicht an Steno rächen konnte, verfiel er auf die Idee, die unumschränkte Macht im Staate an sich zu reißen, um dann freie Hand zu haben. So zettelte er eine Verschwörung an, die aber entdeckt und derentwegen der Doge nach kurzem Prozess hingerichtet wurde. – Michele Steno wurde viel später selbst Doge (1400–13).
Nach der nächsten Brücke biegt der Weg nach links ab, um sich dann nach rechts zur breiten Calle Larga XXII Marzo zu erweitern. Deren gänzlich unvenezianischer Stil lässt erkennen, dass sie erst nach der Zeit der Republik entstanden ist. Am 22. März 1848 wurde der Kommandant des Arsenals von den Werftarbeitern ermordet, eine Tat, die der entscheidende Anlass zum Ausbruch der Revolution war, die noch am gleichen Tag zur Kapitulation der Österreicher und zur Ausrufung einer provisorischen Regierung Venedigs führte. Von hier leitet die erste Gasse links (Calle del Sartor da Veste) zu der gleichnamigen Brücke in die Calle del Caffetier und weiter auf den Campo S. Fantin mit der gleichnamigen Renaissancekirche und dem weltberühmten
► Teatro la Fenice
Das Fenice stammt aus den letzten Jahren der Republik und wurde 1792 nach einem ersten Brand des Vorgängerbaus eingeweiht. Neben der Mailänder Scala und dem Teatro San Carlo in Neapel gehört es zu den drei bedeutendsten Häusern Italiens. Zahlreiche Komponisten führten hier ihre Werke auf, unter ihnen Donizetti und Rossini, und es gab nicht weniger als fünf Uraufführungen von Opern Giuseppe Verdis.
In diesem Zusammenhang gibt es die hübsche Geschichte von der Arie „La donna è mobile“ aus dem Rigoletto. Verdi hielt sie bis zur Uraufführung geheim, auch vor den Musikern, um sie nicht vorzeitig zum Gassenhauer der Gondolieri werden zu lassen, wie es später dann geschah.
1836 brannte das Theater zum zweiten Male ab, um alsbald in erstaunlich kurzer Zeit, genauer in nur einem Jahr, wieder zu erstehen – wie der „Phönix aus der Asche“, wovon sich der Name Fenice ableitet. Nach dem letzten Brand vom 29. Januar 1996 geschah außer der Errichtung gewaltiger Gerüste und reichlichen Streitigkeiten über Jahre nichts, obwohl der damalige Bürgermeister die Wiedereröffnung „zur Jahrtausendwende“ zugesagt hatte. Böse Zungen spotteten, er habe nicht gesagt, welche Jahrtausendwende er denn damit gemeint habe. Im Dezember 2003 waren die Arbeiten dann aber soweit fortgeschritten, dass eine inaugurazione, eine Eröffnung, stattfinden konnte, allerdings nur mit einem Orchesterkonzert, da das Haus noch lange nicht fertig war. Eine erste Opernaufführung fand im November 2004 statt.
Immerhin sollen die geleisteten Arbeiten mit der Wiedergabe einiger Zahlen gewürdigt werden: Gekostet hat der Wiederaufbau 89 Millionen Euro. Es wurden 4.700 qm Marmor verlegt, 3.225 qm in Gips ausgeführte Rahmen angebracht, von denen 1.300 qm mit 12.000 Blattgoldblättern vergoldet wurden. Weiterhin wurden 700 qm Schnitzarbeiten ausgeführt, 600 qm Papiermaché und 4.000 m Stoff verarbeitet, 172 km elektrische Kabel und 2.500 qm Steinfußboden verlegt. Insgesamt waren 8.000 Bootstransporte erforderlich, um die Materialien anzuliefern. Bei der Restaurierung fanden nur alte handwerkliche Techniken Anwendung. Der Besuch des Innenraums ist lohnend.
Dem Theater gegenüber liegt der schwer überschaubare, fast abweisende Bau der Kirche S. Fantin mit strenger Fassade und glatten, grauschwarzen Steinflächen, „wie ein in die Stadt hineingesprengter Meteor“ (Hubala). Er wurde 1507–49 von Scarpagnino begonnen und bis 1564 von Sansovino vollendet, der das Presbyterium errichtete. Leider ist eine Besichtigung kaum möglich. Der Innenraum stellt eine Variante der venezianischen Kreuzkuppelkirchen-Architektur dar, die hier um ein Presbyterium mit vier schönen korinthischen Freisäulen in den Ecken sowie einer Apsis mit fünf Fenstern erweitert ist. Diese sind von außen weitgehend verstellt, so dass die vom Architekten gewünschte Lichtsituation verändert und das Innere recht dunkel ist. Interessant ist das Motiv der Freisäulen in den Ecken des Presbyteriums, das ursprünglich aus antiken römischen Bauten stammt. Erstmals taucht es in Venedig in S. Marco (im tesoro) auf. Später greift es Palladio wieder auf, beispielsweise in S. Giorgio Maggiore und im Redentore.
Neben der Kirche erhebt sich die weiße Fassade der ehemaligen Scuola di S. Fantin, die früher auch Scuola dei Picai (der „Gehenkten“) hieß. Ein weiterer Name ist überliefert mit Scuola della buona Morte o della Giustizia. Die Bruderschaft versah nämlich die Aufgabe, die zum Tode Verurteilten zur Hinrichtung zu begleiten, sie dabei seelsorgerisch zu betreuen und dann für ihre Beerdigung zu sorgen. Die Fassade entstand 1592–1604 unter den Brüdern Antonio und Tommaso Contin (ersterer ist Architekt der Seufzerbrücke) sowie unter Vittoria. In dem Gebäude finden heute Ausstellungen und Vorträge zur Förderung lokaler Kunst statt.
Zurück auf der Via Larga XXII Marzo führt der weitere Weg nach links zur
► Kirche S. Moisè
Die Kirche ist Moses, also alttestamentlich geweiht, woran das Alter der Kirchengründung, die 797 stattfand, zu erkennen ist. Es ist eine Verbindung zu den in Venedig lebenden Byzantinern zu vermuten, da die Dedikation einer Kirche an Moses im westlichen Bereich der damaligen Welt völlig ungewöhnlich gewesen wäre. Die Legende berichtet, dass zwei Tribunenfamilien, die der Chorii und der Vidilicii, die Kirche auf einem unbebauten Grundstück am Ufer des Canal Grande gegründet hatten. Die heutige Fassade entstand seit 1668 und wurde von einem Vincenzo Fini mit der gewaltigen Summe von 30.000 Dukaten finanziert. Dieser war erst kurz zuvor in den venezianischen Adel aufgenommen worden (was ihn noch einmal 100.000 Dukaten gekostet hatte) und wurde 1667 zum Prokurator von S. Marco ernannt. Der Kirchenbau wurde 1632 begonnen, also kurz nach der großen Pestepidemie von 1630/31. Ganz sicher gibt es bei dem Neubau einen Bezug zu den Bibelworten: „Moses beschützte sein Volk vor dem Biß glühender Schlangen – möglicherweise eine Metapher für die Pest.“ (Concina)
Immer wieder überrascht die Fassade mit ihrer Überladenheit. Dabei wirkt sich sicher auch der Umstand ungünstig aus, dass heute die Fassade schon aus größerer Entfernung betrachtet werden kann, während sich früher der Blick wohl erst auf der Brücke geöffnet hatte. Kretschmayr meint, sie sei „im ganzen eher als Gipfel phantastischer Verwirrung denn als köstliches Barockstück“ beurteilt worden. Im 19. Jahrhundert wurde von einem „Gipfel aller architektonischen Tollheit“ gesprochen und sogar der Abriss erwogen. Dabei war sie ursprünglich noch üppiger verziert, bevor 1878 aus statischen Gründen einige Statuen entfernt wurden. Architekt war Alessandro Tremignon, die Skulpturen schuf A. Meyring. Hubala bezeichnet das Ganze als „eine in Stein verewigte Bühnendekoration der Fini“, die sich hier ein Denkmal gesetzt haben.
Das Innere ist ein Saalraum mit dreiteiligem Presbyterium, der sein Licht aus Thermenfenstern in der Gewölbezone erhält und im unteren Bereich ruhig und kraftvoll gegliedert ist. Auch der Hochaltar stammt von Tremignon als Architekt und Meyring als Bildhauer der Skulpturen. Dargestellt ist die Übergabe der Gesetzestafeln an Moses. Beim Betrachten entsteht weniger der Eindruck, vor einem Altar, als vor einer „barocken Szenerie“ zu stehen. An der linken Seitenwand der linken Trabantenkapelle hängt ein Spätwerk Tintorettos, eine Fußwaschung. Das Bild ist in dem Dunkel, das hier meistens herrscht, kaum erkennbar und befindet sich auch in einem schlechten Zustand.
Rechts von der Fassade dieser Kirche erhebt sich eine ganz üble Bausünde, die hässliche Rückseite des Luxushotels Bauer Palace. Dieser Bau entstand in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, da Widerstandskämpfer den Vorgängerbau wegen seiner Nutzung als Quartier der Militärverwaltung und der SS im Kriege gesprengt hatten. Schon zur Zeit der Entstehung des neuen Gebäudes war dessen Architektur stark umstritten. Huse spricht von einem „Block von plumper Modernität, der selbst in der vermeintlichen Zurückhaltung präpotent wirkt und bereits durch seine Verkleidung in römischem Travertin zu verstehen gibt, dass Bauherr und Architekt mit Venedig wenig im Sinn hatten.“
Die Salizada di S. Moisè führt weiter in Richtung S. Marco, vorbei an einer Reihe ausgesprochen luxuriöser Geschäfte, während in der nach links abzweigenden Frezzeria die Läden teilweise etwas bürgerlicher wirken.
Hier wurden früher die frecce, also die Pfeile verkauft, die für die Geflügeljagd in der Lagune verwendet wurden. Es gibt einige Gesetze aus dem 14. Jahrhundert, aus denen hervorgeht, dass die Venezianer verpflichtet waren, sich regelmäßig im Pfeilschießen zu üben. Die Schießübungen, zu denen alle männlichen Bewohner einer contrada im Alter von 16 bis 35 Jahren erfasst wurden, fanden einmal pro Woche statt.
In der Nähe der Frezzeria liegt völlig versteckt die kleine Kirche der Armenier, die nur an Sonntagvormittagen zum Gottesdienst geöffnet ist. Die Republik beherbergte zahlreiche unterschiedliche ausländische Gemeinschaften, deren Rechte und Pflichten genau definiert waren. Innerhalb dieser Regeln genossen die Gemeinschaften absolute Freiheit und konnten auch ihre jeweiligen ethnischen und religiösen Bräuche pflegen. Die seit dem 12. Jahrhundert nachweisbare Anwesenheit der Armenier in der Stadt erklärt sich aus den dauernden Verfolgungen, denen sie in ihrer Heimat durch die Türken ausgesetzt waren. Nach und nach wurde diese Volksgruppe zu einer der größten und auch reichsten in der Stadt. Der jetzige Kirchenbau entstand in den Jahren zwischen 1682 und 1688, möglicherweise nach einem Entwurf von Giuseppe Sardi. Von außen ist die Kirche kaum auszumachen, ihre Kuppel ist nur von wenigen, eher versteckt liegenden Stellen aus zu sehen. Sie besitzt keine Fassade, und ihr Eingang liegt in einem Sottoportego (in der Calle degli Armeni). Der Innenraum hat einen quadratischen Grundriss und wird von einer Kuppel überfangen. Die architektonischen Elemente sind elegant und ausgewogen gebildet. Das Ganze ist nicht bedeutend im eigentlichen Sinn, enthält auch keine herausragenden Kunstwerke. Doch ist es ein heiterer, stiller Ton im Konzert der venezianischen Kirchen.
Die Salizada di S. Moisè geht in die Calle Vallaresso über, die hier nach rechts abbiegt. Hier liegt heute das Hotel Luna, an dessen Stelle einmal ein Kloster des Templer-Ordens stand. Die Calle Vallaresso mit sehr exklusiven Geschäften führt zur Haltestelle S. Marco, von der sich ein sehr schöner Blick über den Bacino und zur Salute-Kirche bietet. Unter der Hausnummer 1332 ist der Palazzo Dandolo zu finden, in dem sich einst das berühmteste Spielcasino (Ridotto) der Stadt befunden hat. Das, was davon übrig geblieben ist, war lange Zeit nicht zugänglich, ist jedoch jetzt wiedererstanden und in das Hotel Monaco integriert worden. Der alte Ballsaal im ersten Stock präsentiert sich heute wieder in der gleichen Pracht, wie er von zeitgenössischen Darstellungen her bekannt ist.
Zurück auf der Salizada di S. Moisè kommt man zur Rückseite der Ala Napoleonica am westlichen Ende des Markusplatzes und zur Calle dell’Asuncion, in der früher ausländische Gesandte untergebracht waren. Hier stand bis 1824 die Kirche der Ascensione, der Himmelfahrt. Dieser Ausdruck wurde im Venezianischen zur sensa, dem Fest der Vermählung mit dem Meere, das laut Überlieferung von Papst Alexander III. inauguriert wurde, als er 1177 in der Stadt weilte. Weiter geht man durch den dunklen Säulenwald unter der Ala Napoleonica hindurch und tritt, geblendet von Licht, Weite und Schönheit, auf die Piazza, um auf S. Marco zuzuschreiten, was im Leben eines Menschen jedes Mal von neuem ein großer Augenblick ist. Hofmannsthal besingt ihn mit den Worten: „... endlich durch einen dumpfen finsteren Schwibbogen hinaus auf den großen Platz, der dalag wie ein Freudensaal, mit dem Himmel als Decke, dessen Farbe unbeschreiblich war: denn es wölbte sich das nackte Blau und trug keine Wolke, aber die Luft war gesättigt von aufgelöstem Gold, und wie ein Niederschlag aus der Luft hing an den Palästen, die die Seiten des großen Platzes bilden, ein Hauch von Abendrot.“