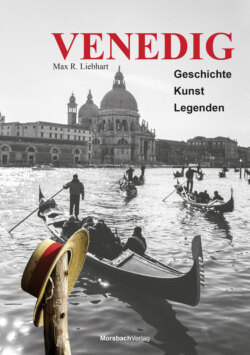Читать книгу Venedig. Geschichte – Kunst – Legenden - Max R. Liebhart - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPiazza San Marco
Markusplatz – Markuskirche – Dogenpalast – Glockenturm – Bauten an der Piazza und der Piazzetta
Wenn die Führung durch Venedig mit diesem Stadtbezirk, genauer gesagt im Umfeld von Piazza, Markusdom und Dogenpalast begonnen wird, so entspricht das einer inneren Logik, stellten doch die Piazza und ihre Umgebung sowohl das politische als auch geistige Zentrum der Republik Venedig dar. Dagegen lag das geistliche Zentrum weit draußen im äußersten Osten der Stadt, nämlich in dem Komplex von Kirche und Kloster San Pietro di Castello, während die Markuskirche nicht Dom, nicht Sitz des Patriarchen, sondern vielmehr Privatkapelle der Dogen und somit Staatsheiligtum war.
Der Sestiere di San Marco (das Stadtviertel San Marco) erschließt sich vordergründig ohne weiteres in seinen Kirchen und Museen und in seinen vielen, teils sehr exklusiven Geschäften sowie seinen teuren Hotels und Restaurants. Es macht Spaß, hier spazieren zu gehen, zu schauen und einzukaufen. In der Umgebung des Markusplatzes ist Venedig am ehesten das geblieben, was es über Jahrhunderte war, nämlich ein Zentrum von Luxus und feinster Qualität. Doch stellt sich bei näherer Betrachtung leicht das Gefühl ein, an einer Fassade entlang zu gehen, einer Fassade, die nur scheinbar einladend und offen ist. Zwar öffnen sich dem Besucher die Gebäude des Platzes mit ihren endlosen Arkadenstellungen weit und lockend, doch ist diese Offenheit nur Schein. In Wirklichkeit ist alles in sich selbst geschlossen. Man steht vor einer gewaltigen Selbstdarstellung der Republik, die über Jahrhunderte die führende Weltmacht war. Die Wenigen, die das Recht hatten, zu regieren und mitzubestimmen, haben sich und ihrem Staat hier den ihnen gemäßen Rahmen gegeben. Dieser Sachverhalt wird angesichts des touristischen Treibens auf dem zentralen Platz der Stadt mit dem früher obligatorischen Füttern der Tauben heute nicht mehr ohne weiteres deutlich. Der Markusplatz ist nicht mehr ein Forum für eine Elite, sondern ein Tummelplatz für Massen von Besuchern, deren Verhalten oft genug den gebotenen Respekt vermissen lässt. Doch derjenige, der sich auch nur ganz wenig weiter abseits wagt, findet unvermutet völlige Ruhe und Stille, eine Stille, wie sie als Stadt nur Venedig schenken kann.
Der Markusplatz
„Venedig bietet am Markusplatz ein meisterliches Vorbild harmonischer Ausgewogenheit. Unbestreitbar hat hier die Poesie ihre bezauberndste Manifestation erfahren. Heiterer Ernst, fruchtbarer Wechsel, Reiz des Unerwarteten, Anmut und Majestät vereinigen sich auf der Lagune zu einer einzigartigen Symphonie. Die aufeinanderfolgenden Jahrhunderte haben die gegensätzlichsten Auffassungen mit sich gebracht, die Bildung von Oppositionen und regelrechte Umstürze.“
Mit diesen Worten besingt der Architekturtheoretiker und Stadtplaner Le Corbusier die Platzanlage, die den Markusdom umgibt. Sie besteht aus der eigentlichen Piazza, die sich vor der Hauptfassade der Kirche nach Westen hin erstreckt, und der Piazzetta, die von S. Marco nach Süden zwischen Palazzo Ducale und Libreria zum Wasser hin verläuft. Von geringerer Bedeutung ist die nördlich von S. Marco gelegene Piazzetta dei Leoncini, so genannt nach den beiden von Kindern viel berittenen Löwen aus rotem Veroneser Marmor, deren Rücken mittlerweile völlig blank poliert sind.
Die Venezianer selbst suchen bis heute die Piazza eher selten auf. Früher gehörte sie im Wesentlichen den ricchi, den Reichen also, und den nobili (was nicht gleichbedeutend war). Die anderen Bewohner der Stadt lebten und arbeiteten jeweils in eng umgrenzten Gebieten und verließen diese praktisch nie. Napoleon hat von der Piazza gesagt, sie sei „der schönste Salon Europas, dem als Decke zu dienen nur der Himmel würdig ist.“ Das scheint ein Wort des höchsten Lobes zu sein, doch offensichtlich war er der Meinung, diesen Platz dennoch verändern zu müssen mit dem Abriss einer kleinen Kirche und dem Bau der jetzigen Ala Napoleonica (siehe am Ende des Kapitels). – Napoleon war alles andere als ein Freund Venedigs, weder der Republik, die zu zerstören er sich zum Ziel gesetzt hatte („io sarò un Attila per lo Stato veneto“), noch der Stadt mit ihrer Architektur und ihren politischen, sozialen und kulturellen Strukturen. Für ihn war Venedig nicht mehr als eine politische Manövriermasse, mit der er nach Gutdünken schalten und schachern konnte. Er veranlasste mit grober Hand bauliche Maßnahmen und Veränderungen, er brauchte Wohnräume und einen eigenen Ballsaal, auch wenn er nur selten in der Stadt war. Wenn er die Piazza als „Salon“ bezeichnete, so beweist das recht deutlich, wie wenig er sich der herausragenden geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung dieses singulären Ensembles bewusst war. – Nietzsches Verse in einem seiner Gedichte klingen da weit sensibler:
Mein Glück
Du stilles Himmels-Dach, blau-licht, von Seide,
Wie schwebst du schirmend ob des bunten Bau’s,
Den ich – was sag ich? – liebe, fürchte, neide …
Die Seele wahrlich tränk’ ich gern ihm aus!
Gäb’ ich sie je zurück? –
Nein, still davon, du Augen-Wunderweide!
– mein Glück! Mein Glück!
Schon allein durch seine Weite und die Öffnung hinaus auf die Lagune ist der Markusplatz ein einmaliges Gebilde in dieser Stadt, die, abgesehen von wenigen großen campi, von Enge und Verwinkelung geprägt ist, zum entspannten Verweilen nur gelegentlich einlädt und den Blick nur selten freigibt. Wenn heute auf der Piazza meist größere Menschenmengen anzutreffen sind, so sollte sich der, der diese Tatsache als störend empfindet, klar machen, dass das immer so war. Die Gemäldegalerien der Stadt bergen zahlreiche Bilder, die dies bestätigen. Die Piazza war immer schon der Ort, wo man sich traf – das heißt der Adel, die Repräsentanten des Staates und der Regierung, die gehobene Schicht, wo man Feste feierte und Staatsakte beging, wo man sich, besonders in der Spätzeit der Republik, in den damals vierundzwanzig Cafés und im nahegelegenen Spielcasino, dem Ridotto, amüsierte, besonders natürlich im schier endlosen Karneval.
Mit den Tauben von San Marco verbinden sich im Übrigen einige Legenden. Eine von ihnen berichtet, dass den Flüchtlingen, die nach der Zerstörung der antiken Stadt Altino durch Attila in die Lagune geflohen waren, auch Schwärme von Tauben gefolgt und dass die Vögel, die heute die Piazza bevölkern, deren Nachkommen seien. – Dieser Bericht existiert auch in leicht modifizierter Form. Die Bewohner von Altino, bedroht von den Langobarden, flehten Gott um seinen Rat und Beistand an und sahen mit einem Male, wie die bei ihnen nistenden Tauben ihre Jungen mit dem Schnabel packten und mit ihnen weg von der Stadt auf die Lagune zu flogen. Die Einwohner der alten römischen Stadt sahen darin eine Warnung und folgten den Vögeln. – Eine weitere Legende weiß zu erzählen, dass einer erkrankten dogaressa ein Taubenpaar aus dem Orient mitgebracht wurde und dass sich diese Tiere dann enorm vermehrt hätten. –Schließlich gibt es noch eine Legende, der zufolge die Tauben seit 877 in der Stadt ansässig seien: „Es war ehemals der Brauch, dass die Küster von Sankt Markus am Palmsonntag nach den Gottesdiensten Tauben laufen ließen, die sie mit Papierstreifen gefesselt und auf diese Weise unfähig gemacht hatten, zu fliegen. Die Menschen auf der Piazza sollten versuchen, diese Tauben zu fangen. Die erbeuteten Tiere wurden dann gefüttert und zu Ostern verspeist. Aber einige Tauben sind immer wieder entkommen. Die flüchteten sich auf das Kirchendach, wo sie gewissermaßen als unverletzlich galten und nach und nach auf eine gewaltige Zahl anwuchsen.“ (Howells). – Alfred Polgar (1873–1955) berichtet: „An dem sonnigen Septembervormittag, an dem ich die Freude hatte, die Tauben von San Marco zu beobachten, waren dort ihrer dreißigtausendsechshundertvierzig versammelt, ein paar Sonderlinge, die auf der Piazzetta spazieren gingen, nicht mitgerechnet. Plötzlich flogen alle mitsammen auf und flatterten in großen, schiefen Ellipsen stürmisch rauschend über den Platz. Und als sie zu Boden gingen, ein gewaltiger, weicher Wirbel von Blau und Weiß und Grau, war es, als ob sie aus der Luft geschüttet würden, so dicht fielen und lagen sie zuhauf übereinander“. – Seit etwa 2010 ist das Füttern der Tauben verboten, und erstaunlicherweise wird das Verbot weitestgehend eingehalten.
Es ist nicht möglich, die Platzanlage von einem einzigen Punkt aus vollständig zu überblicken. Um sie sich zu erschließen, ist es erforderlich, sich auf ihr in verschiedene Richtungen zu bewegen, kreuz und quer zu schlendern, so dass sich immer wieder neue Perspektiven entfalten. Und wenn der Blick an den rundum verlaufenden Arkadenstellungen entlangschweift, so kann sich das Gefühl einstellen, als glitten Hände über die Saiten einer Harfe.
In der Frühzeit der Republik war die Piazza deutlich kleiner als heute. Der Platz wurde in der Mitte von einem kleinen Fluss durchquert (dieser existiert unterirdisch noch immer, man begegnet seiner Mündung in die Lagune, wenn man an der Zecca vorbei ein paar Schritte nach Westen geht), er war grasbewachsen und Bäume standen auf ihm, weswegen er auch damals den Namen brolo (Garten) trug. Auf die heutigen Ausmaße wurde er unter dem Dogen Sebastiano Ziani (1172–78) erweitert. Einen ersten festen Belag mit Ziegelsteinen erhielt der Platz 1267. Im Jahr 1392 wurde dieser erneuert, indem man Ziegelrechtecke verlegte, die von Marmorstreifen gefasst waren, eine Art des Pflasterns, die auch heute noch an einigen wenigen Stellen in Venedig zu sehen ist (z. B. vor Madonna dell’Orto). In den Jahren 1495, 1566, 1626, 1723 und zuletzt 1893 erhielt die Piazza jeweils neue Beläge, die beiden letzten dann aus Trachyt, der aus den Euganeischen Hügeln stammt. Ganz sicher wurde durch den Wechsel des Materials der Gesamteindruck, den die Piazza mit dem alten farbintensiven Belag gemacht hatte, entscheidend und nicht zum Vorteil verändert: „Statt des feinkörnigen modularen Netzes dominiert ein sich selbst genügendes großspuriges Ornament. Das Säulenpaar der Piazzetta und die Fahnenmasten vor der Kirche verlieren ihren optischen Halt, die elegante Parataxe der Arkaden der Alten Prokuratien bekommt etwas Trippelndes. Alle vor 1723 an der Piazza errichteten Bauten standen ursprünglich auf einem farbigen Boden. Für die, die einmal weiß waren, wie die pietra d’Istria-Fronten der Prokuratien, des Uhrturms oder der Libreria, wie auch für diejenigen Bauten, die mit so viel farbigem Stein und Marmor aufwarten wie der Dogenpalast und die Loggetta, hat sich die ursprüngliche Wirkung durch das neue Pflaster grundlegend verändert, und selbst der von Anfang an ungeschmückte Backsteinpfeiler des Campanile ist ein anderer geworden.“ (Huse)
Der Grundriss der Platzanlage folgt der bei venezianischen campi häufiger anzutreffenden L-Form. Der lange Schenkel dieses „L“ ist die trapezförmige Piazza direkt vor der Hauptfassade der Markuskirche, die von den schier endlosen Arkadengängen der alten (rechts) und der neuen Prokuratien (links) gefasst wird. Diese lange, nach Westen gerichtete Bahn wird durch die Ala Napoleonica mit ihrer derben, lastenden Attika abgeschlossen. Der kurze Schenkel des „L“, die Piazzetta als zweite Bahn, beginnt an dem bunten Uhrturm und zieht an der Fassade von S. Marco vorbei bis zum sogenannten Bacino, der weiten Wasserfläche zwischen Dogenpalast und der Kirche S. Giorgio Maggiore, deren Fassade trotz der Entfernung einen optischen Abschluss bewirkt. Die Piazzetta wird auf ihrer linken Seite von der Westfront des Dogenpalastes und rechts von der Libreria Sansovinos mit ihrer üppig verzierten Fassade begleitet. Im Kreuzungspunkt der beiden Platzachsen erhebt sich der mächtige, 95 Meter hohe Campanile, der gleichsam eine riesige Angel bildet, um die sich die Platzanlage dreht. Die Piazzetta war bis ins 12. Jahrhundert ein Hafenbecken, die Fläche der Piazza gehörte dem Kloster San Zaccaria, das hier Gemüse anbaute. Eine weitere sehr wichtige Bahn der Platzanlage wird nicht ohne weiteres deutlich und ist auch weniger architektonischer, als spiritueller Art. Sie geht aus von dem zierlichen Bau zu Füßen des Glockenturms, der Loggetta, reicht hinüber zum früheren Haupteingang des Dogenpalastes, der Porta della Carta, der Verbindungsstelle zwischen Kirche und Palast, und führt weiter durch den sogenannten Porticato Foscari und Arco Foscari zur Gigantentreppe im Hof des Palastes.
Ausstattung der Platzanlage: Von herausragender Bedeutung sind zunächst die beiden riesigen Granitsäulen, die ganz vorne auf der Piazzetta stehen. Sie sind Monolithe aus dem Orient und wurden 1172 aufgerichtet, angeblich vom legendären Baumeister der ersten Brücke am Rialto, einem Niccolò Barattini. Ursprünglich sollen es drei Säulen gewesen sein, doch sei gemäß der Legende eine davon beim Anlanden ins Wasser gestürzt und habe nicht mehr geborgen werden können. In den Jahren 1557 und 1809 wurde vergeblich im Lagunenboden vor der Uferbefestigung nach ihr gesucht. Diese Säulen sind Herrschafts- und Gerichtssymbole und haben ihre Vorbilder in der Antike und in Byzanz. Zwischen ihnen wurden die Hinrichtungen vollzogen. Über dieser Stelle soll übrigens ein Fluch hängen, und bei den abergläubischen Venezianern lebt die Meinung, es bringe Unglück, zwischen den Säulen hindurchzugehen. Die Legende berichtet, Marino Falier sei nach seiner Wahl zum Dogen bei der Ankunft in Venedig im dichten Nebel versehentlich zwischen den Säulen hindurchgeschritten, und tatsächlich wurde er 1355 hingerichtet. Die Säulen stehen auf Basen, deren Ecken stark verwitterte symbolische Darstellungen der Handwerke tragen, besitzen Kapitelle aus veneto-byzantinischer Zeit und tragen jeweils eine Figur.
Auf der linken Säule (Blickrichtung zur Lagune) steht ein geflügelter Löwe, also das in der Stadt allgegenwärtige Symbol der „Löwenrepublik“, wie Venedig auch bezeichnet wurde.
Wie alle Evangelisten, so besitzt auch der hl. Markus ein ikonografisches Attribut, nämlich einen Löwen. Warum der Markuslöwe geflügelt ist, begründet eine Legende, die aus Capodistria stammt. Ihr gemäß hat sich Markus, nachdem er die Niederschrift seines Evangeliums beendet hatte, dem Studium der Meteorologie gewidmet. Anscheinend war er aber mit seinen dabei erzielten Erkenntnissen nicht zufrieden, da er sich eines Tages an Gottvater mit der Bitte wandte, ihm doch noch vor seinem Tod Zutritt zum Himmel zu gewähren, damit er dort das Wesen von Blitz und Donner ergründen könne. Gottvater stimmte dem zu, und um Markus die Himmelfahrt zu erleichtern, stattete er ihn mit zwei Flügeln aus. Gleichzeitig verwandelte er ihn jedoch auch in einen Löwen, um zu verhindern, dass Markus den Menschen die Kenntnis über gutes und schlechtes Wetter übermittelte. Als geflügelter Löwe konnte Markus nicht sprechen, sondern nur brüllen. Er erkundete alle Geheimnisse des Himmels und kehrte dann auf die Erde zurück, um lange nach seinem Tod, nämlich 828 nach Venedig zu gelangen. Dort blieb er als Schutzpatron der Stadt bis 1797, dem Jahr des Untergangs der Republik. Erst danach kam er endgültig in den Himmel.
Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass das Gebilde auf der linken Säule in Wirklichkeit gar kein Löwe ist. Vielmehr wurden einer Chimäre, deren Herkunft nicht ganz klar ist – diskutiert werden Assyrien, Etrurien, Persien und sogar China –,
erst später Flügel und Buch hinzugefügt (das geschlossen und deshalb Symbol für den Krieg ist). Der Löwe, der in alten Zeiten vergoldet war, schaut nach Osten, also in Richtung auf das Meer und symbolisiert somit die Herrschaft Venedigs zu Wasser.
Auf der rechten Säule steht Todaro, wie die Venezianer den hl. Theodor von Euchaita nennen (es handelt sich dabei um eine Kopie, während das Original im Hof des Dogenpalastes aufbewahrt wird). Um das Jahr 300 n. Chr. erlitt er das Martyrium und wurde zum griechischen Soldatenheiligen. Im byzantinischen Heer besonders verehrt, galt er dagegen in Venedig nur als ein „mittelrangiger Heiliger“ (Lebe). Bis 828 war er der Staatspatron, dem Jahr, in dem die translatio, die Überbringung des Leichnams des hl. Markus nach Venedig stattfand. San Marco war als Evangelist natürlich bei weitem „ranghöher“, so dass der hl. Theodor nach dessen Ankunft bedeutungslos wurde. Seine Kirche lag dort, wo sich heute S. Marco erhebt, verschwand nach und nach und wurde schließlich von der Markuskirche förmlich aufgezehrt. Die Statue ist ein pasticcio, eine Mischung aus einem hellenistischen Kopf (vielleicht ein Portrait von Mithridates, dem König von Pontus) und einer römischen Gewandstatue. Das Krokodil, auf dem Todaro steht, eine Zutat aus dem frühen Quattrocento, gehört zwar zur Ikonografie des Heiligen, was auch auf Darstellungen an der nach ihm benannten Scuola Grande neben der Kirche S. Salvatore (in der Nähe der Rialtobrücke) erkennbar wird. Seine Bedeutung aber ist undeutlich geworden. (Tötschinger stellt dazu fest, der Drache sei das Symbol für den Teufel, und der Fuß des Heiligen auf ihm bedeute den Sieg über die Finsternis). Todaro hält den Schild in der rechten, also eigentlich in der „falschen“ Hand, mit der normalerweise das Schwert geführt wird, was dahingehend interpretiert wird, dass Venedig nie von sich aus angegriffen, sondern sich immer nur verteidigt, also nur dann Krieg geführt habe, wenn es dazu gezwungen war.
Im Übrigen ist „fra Marco e Todaro“ ein venezianisches Sprichwort, das den Zustand der Ratlosigkeit ausdrückt. Eine weitere, ausgesprochen drohende Redewendung ist in Venedig gebräuchlich, wenn man jemanden einschüchtern möchte und deshalb zu ihm sagt: „Ich zeige dir die Uhr“. Gemeint ist damit die Uhr am Uhrturm, ein Anblick, der für viele Menschen das Letzte war, was sie in ihrem Leben zu sehen bekamen, vor ihrer Hinrichtung nämlich.
Die Säulen waren früher mit Buden umstellt. Das vor ihnen liegende Ufer wird molo genannt, ein Wort, das so viel wie „Schutz vor der Gewalt des Wassers“ bedeutet. Hier lag das offizielle Entrée für die Besucher der Stadt, außerdem der Ankerplatz der Handelsschiffe. Heute sind am molo zahlreiche Gondeln festgemacht.
Blickt man vom Ufer zurück auf die kurze südliche Fassade von S. Marco, findet man an einem kubischen, fensterlosen Bau mit feinster vielfarbiger Marmorverkleidung, dem Tesoro, der Schatzkammer von S. Marco, in der Ecke eine Figurengruppe eingelassen. Sie ist aus rotem Porphyr gefertigt, dem Stein, der in der Antike dem kaiserlichen Hause und den Göttern vorbehalten war. Die vier Männer, die sich paarweise einander zuwenden und sich umarmen, werden als Tetrarchen, also als Kaiser Diokletian und seine drei Mitkaiser Maximian, Valerius und Constantinus Clorus gedeutet und somit dem 4. Jahrhundert zugewiesen. Die Gruppe (eine Kopie, das Original befindet sich im Museum von S. Marco) wurde in Ägypten bzw. in dortigen Porphyrsteinbrüchen der Römer gearbeitet. Sie stammt aus dem Philadelphion von Konstantinopel, wo sie sich bis 1204 befand. Bei genauer Betrachtung ist festzustellen, dass einem der vier Männer ein Fuß fehlt. Vor längerer Zeit hat man bei Grabungen in Istanbul genau diesen Fuß gefunden, ein Beweis für die Herkunft der Gruppe aus dieser Stadt.
Die Tetrarchen werden von den Venezianern als Mohren oder auch als i Mori ladroni bezeichnet. Die Legende erzählt dazu, dass einst Diebe den Schatz von S. Marco rauben wollten und dafür in Stein verwandelt wurden.
Vor der Südfront von S. Marco sind zwei reliefverzierte Marmorpfeiler zu sehen, deren Herkunft und Datierung unsicher sind. Gemäß alter Überlieferung sollen sie zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert entstanden und Siegestrophäen der Venezianer nach einem Sieg im syrischen Akkon im Jahre 1258 sein. Tatsächlich aber stammen sie aus der Polyeuktoskirche in Konstantinopel und wurden dort 524–527 gefertigt.
Gleich daneben, an der Südwestecke von S. Marco, steht der Stumpf einer Porphyrsäule, die Pietra del Bando, deren Herkunft nicht genau benennbar ist. Sie wurde zu Zeiten der Republik als Plattform genutzt, von der aus Gesetze und Erlasse verkündet wurden. Daneben diente sie dazu, die Köpfe, die man Hochverrätern abgeschlagen hatte, drei Tage und drei Nächte auszustellen. Die Säule überstand den Einsturz des campanile im Jahre 1902 unbeschadet, was sicher der Härte des Porphyrs zu verdanken ist. Es wird berichtet, die Trümmer des Turms seien von ihr aufgehalten und umgelenkt worden, so dass sie die Kirche vor Schaden bewahrt habe, was jedoch als eine etwas romantische Interpretation anzusehen ist.
Vor der Hauptfassade der Kirche stehen drei Flaggenmasten aus Zedernholz, die früher die Fahnen von Candia (Kreta), Morea (Peloponnes) und des Königreichs Zypern trugen. Heute wehen hier an Sonn- und Feiertagen die Fahnen Italiens, der EU und Venedigs. Zwischen den Flaggenmasten wurde bis 1576 der Sklavenmarkt der Stadt abgehalten. Herrliche Arbeiten sind die Bronzesockel, die Alessandro Leopardi 1505 gegossen hat. Sie wurden stilbildend für zahlreiche Nachempfindungen des 19. Jahrhunderts, die in verschiedenen Städten Europas anzutreffen sind. Als Werke der Renaissance übernehmen sie Formen der Antike. An den Sockeln der seitlichen Masten sind Motive des Meeres wie Neptun, die Nereiden und Tritonen dargestellt. Der mittlere Sockel zeigt Justitia, das Symbol der Gerechtigkeit, sowie Pallas, die den Überfluss versinnbildlicht. Er trägt außerdem drei Medaillons mit jeweils einem Dogenportrait, welches als das von Leonardo Loredan, Doge von 1501 bis 1521, identifizierbar ist. Solche öffentlich sichtbaren Portraits waren im republikanischen Venedig völlig ungewöhnlich.
Bevor man sich den einzelnen Gebäuden zuwendet, sei eines der Grundthemen venezianischer Architektur, das der Säulenarkade, hervorgehoben. Es ist an fast allen Gebäuden von Piazza und Piazzetta konsequent verwirklicht. „Alle Bauwerke am Markusplatz, auch die Markuskirche, schließen sich nach außen nicht hermetisch ab, sondern öffnen sich nach draußen im Erdgeschoss völlig, in den oberen Geschossen weitgehend, so dass sich in den Fassaden ‚Draußen‘ und ‚Drinnen‘, öffentlicher und privater, profaner und sakraler Bereich durchdringen und gleichzeitig architektonisch zur Anschauung gebracht werden.“ (Hubala)
► Die Markuskirche
Die Basilica di San Marco überragt an Bedeutung alle anderen Gebäude der Stadt, allenfalls der Dogenpalast kann ihr zur Seite gestellt werden. Dieser ist aber seit 1797 zweckentfremdet und heute nur mehr ein riesiges Museum seiner selbst. S. Marco jedoch, seit 1807 durch ein Dekret Napoleons die Kirche des Patriarchen von Venedig, ist bis zur Gegenwart im Wesentlichen unverändert geblieben. Dieses Bauwerk ist sicher einer der schönsten Sakralbauten, die es gibt, und kann wohl am deutlichsten ein Gefühl dafür vermitteln, was das Venedig der Republik einmal war. Es gibt viele Gesichtspunkte, die die herausragende Bedeutung dieses Kirchenbaus unterstreichen. Einer von ihnen sei durch ein Zitat veranschaulicht: „Die Kostbarkeit des Materials wurde durch die höchsten Ziele geheiligt und in der feierlichen Pracht ist alles so zueinander passend und richtig angeordnet, dass man nicht erst um ein Wunder zu bitten braucht. Selbst die unermesslichen und seltenen Schätze der Kirche, wie das berühmte Altargemälde ... berührten mich durchaus nicht wegen ihres Geldwertes ... Die Edelsteine anderer Kirchen sind auffällige und lächerliche Anhäufungen von Kleinodien, doch die Markuskirche, in der die winzigste Fläche eine herrliche Arbeit aus wertvollstem Material sichtbar werden lässt, verweist die Juwelen auf den Platz eines dem Ganzen untergeordneten Schmuckes.“ (Howells) Der Sitz des Patriarchen von Venedig, des Vertreters Roms also, war übrigens zuvor die Kirche San Pietro di Castello im Sestiere Castello. Nach dem Ende der staatlichen Selbständigkeit wurde die Markuskirche (als Staatskirche) dann erst zum Markusdom als Bischofs- bzw. Patriarchensitz.
Die Geschichte der Markuskirche beginnt 828 oder 829, also mit der sogenannten translatio, in der „zwei vornehme venezianische Kaufleute und Tribunen“ den Leichnam des hl. Markus (oder was man dafür hielt oder dazu erklärte) von Alexandria nach Venedig brachten. Die Ausfuhr von Reliquien aus Alexandrien war zwar eigentlich nicht erlaubt. Um aber das Verbot zu umgehen, halfen sich die beiden dadurch, dass sie den Leichnam unter Schweinefleisch verbergen ließen, das den islamischen Zöllnern als unrein und deshalb unberührbar galt. So jedenfalls berichtet der venezianische Chronist und spätere Doge Andrea Dandolo (1343–54), und er nennt auch die Namen der beiden Kaufleute mit Rusticus von Torcello und Bon aus Malamocco.
Was die Echtheit der Reliquie des hl. Markus betrifft, so gibt es dazu eine neuere Hypothese. 1962 erfolgten archäologische Grabungen in der Apsis der Kirche. Dabei fand man eine reliefverzierte Steinplatte, deren Symbole Anlass für die kühne Theorie waren, in der Basilika würden nicht die Überreste des hl. Markus, sondern die von Alexander dem Großen aufbewahrt. Gemäß den Erkenntnissen des englischen Forschers Andrew Michael Chugg seien im Jahre 828 die beiden einbalsamierten Leichname vom arabischen Gouverneur ausgetauscht worden, angeblich um zu vermeiden, dass die Christen den von Alexander schänden könnten. Die Überlegungen von Chugg stützen sich u. a. auf die Tatsache, dass auf der in der Apsis entdeckten Steinplatte eine Sonne mit acht Strahlen zu sehen ist, ein Symbol des mazedonischen Königshauses. Natürlich steht die These Chuggs auf wackeligen Beinen. Denn weiterführende Untersuchungen wie z. B. die Radiokarbon-Methode zur Altersanalyse oder DNA-Bestimmungen kamen bisher noch nicht zur Anwendung.
Der Legende zufolge hätte der hl. Markus die Schiffer auf der Rückreise vor dem Untergang in einem fürchterlichen Sturm gerettet. Als dann die Reliquien den Boden Venedigs berührten, habe sich ein lieblicher Rosenduft in der ganzen Stadt verbreitet. Zuvor hatte der Evangelist noch deutliche Zeichen gegeben, dass er nicht in der damaligen Bischofskirche auf Olivolo (heute San Pietro di Castello) bleiben, sondern zum Palast des Dogen gebracht werden wolle – der Heilige verhielt sich somit durchaus gemäß der Interessenlage der Republik. Eine andere Legende berichtet dagegen, dass das Schiff, das die Reliquien des hl. Markus transportierte, untergegangen sei. Doch hätten einige der Seeleute, die sich schwimmend retten konnten, auch den Schrein, in dem Markus lag, mit sich genommen und an Land gebracht.
Prompt nach der translatio wurde mit der Errichtung der ersten, noch hölzernen Markuskirche begonnen, die 836 vollendet wurde. Sie ging in einem Volksaufstand 976 samt Dogenpalast und mehr als 400 Häusern durch Brandstiftung unter. Der folgende zweite Bau, nunmehr in Stein ausgeführt, wurde im 11. Jahrhundert wieder abgerissen, vermutlich wegen des wachsenden Bedürfnisses nach Repräsentation und der zunehmenden Markusverehrung. Von ihm blieb lediglich die – vor einigen Jahren trockengelegte und restaurierte – Krypta unter dem Presbyterium erhalten. Der heutige Bau wurde 1063 begonnen und 1071 geweiht.
Umfangreiche Vorarbeiten waren erforderlich: „Die Fundamente des dritten Kirchenbaus bestehen aus Steinblöcken und reichen bis in eine Tiefe von 3,5 m unterhalb des Fußbodens. Sie lagern über einer Doppelschicht aus Eichenbrettern von 8–10 cm Stärke auf einem Untergrund, der mit Erlholzpflöcken stabilisiert ist, die 130–150 cm lang, 10–14 cm dick und bis zum Anschlag ins Erdreich getrieben sind.“ (San Marco – Geschichte, Kunst und Kultur). Erwähnenswert sind auch Einzelheiten zur Bautechnik des Oberbaus: „Die Pfeiler sind vom Typ des Gussmauerwerks mit einer 30 cm starken Mauerschale, gefüllt mit zerbrochenen Ziegelsteinen, die durch Kalkmörtel und gestoßenen Ziegelstaub (coccipesto) zusammengehalten werden. Die Dicke der anderen Mauern variiert zwischen mindestens 40 cm bis maximal 100 cm in den Bögen, in den Gewölben und in den Kuppeln. In der Krypta sind sie 140 cm dick, in den verstärkten Bereichen sogar bis zu 280 cm. Die verwendeten Backsteine entsprechen dem anderthalb Fuß langen römischen Typus mit den Maßen 40 x 30 x 8 cm.“
Fertiggestellt war die Kirche 1094, im Jahr der sogenannten apparitio, worunter das wunderbare Wiederfinden der Markusreliquien, die seit dem Brand von 976 verschollen waren, zu verstehen ist.
Es wird berichtet, dass „die allgemeine Trauer über die Unkenntnis vom Verbleib der Markus-Reliquie zu mehrtägigen Bußübungen und inbrünstigen Gebeten der venezianischen Geistlichkeit wie des Dogen geführt habe – bis man plötzlich ein Beben in der Kirche verspürte und das Mauerwerk eines Pfeilers bröckelte, in dem nun der dort eingemauerte Sarg des Heiligen sichtbar wurde.“ In anderen Lesarten habe Markus sogar ostentativ seinen Arm aus dem Pfeiler (rechts neben dem Durchgang zur Pala d’Oro) gestreckt (Lebe). Man mag diese Geschichte zunächst nur amüsiert zur Kenntnis nehmen, sollte dabei aber bedenken, dass sie erhebliche symbolische Bedeutung besitzt. Durch sie wird die Markuskirche, in der sich eine Säule für den Heiligen öffnet, dem Grab Christi vergleichbar.
Die Basilika S. Marco ist eines der Wunderwerke dieser Welt. Dieser lapidaren Feststellung stehen durchaus auch kritische, ja sogar negative Äußerungen gegenüber. So wurde beispielsweise von einem „Schalentier“ oder einem „orientalischen Pavillon“ gesprochen. Goethe erschien der Bau wie ein „kolossaler Taschenkrebs“. Für Mark Twain war die Kirche „ein riesiger, warzenbedeckter Käfer“. Karel Capek (1866–1927) meint: „San Marco, das ist keine Architektur, das ist ein Orchestrion; man sucht den Schlitz, wo man den Kreuzer hineinwirft, damit die ganze Maschinerie mit ‚O Venezia‘ losgeht.“ Doch natürlich überwiegen die positiven Äußerungen. „Indessen, noch vor dem Dogenpalast, ist die Markuskirche von allem Anfang an das bauliche und religiös-kulturelle, in einiger Hinsicht auch das politische Herzstück Venedigs gewesen: Nationalheiligtum und Tempel des Staatskultes. In der Basilika San Marco kulminierte das Selbstverständnis Venedigs.“ (Lebe) Für diese Deutung sprechen die Liebe und Hingabe, mit der die Venezianer dieses Bauwerk bis ins kleinste Detail ausgeschmückt haben.
Die neue Kirche wurde vom Dogen Domenico Contarini (1043–71) im Jahre 1063 gestiftet. Dessen namentlich nicht bekannter Architekt übernahm von den beiden Vorgängerbauten die kreuzförmige Anlage und den Narthex (die Vorhalle) und griff damit auf ein byzantinisches Vorbild des 6. Jahrhunderts zurück, nämlich auf die Apostelkirche Kaiser Justinians zu Konstantinopel, die 1453 nach der Eroberung der Stadt durch die Türken zerstört wurde. „Der venezianische Kirchenbau des 11. Jahrhunderts schloss sich also an die klassisch griechische Architektur des 6. Jahrhunderts an, nicht an gleichzeitige mittelbyzantinische Sakralbauten, fügte aber besondere abendländisch-romanische Elemente hinzu, so vor allem die Kuppeln.“ (Hubala) War der Bau im Urzustand noch ungeschmückt (mit Ausnahme von Mosaiken in der Hauptapsis), so wurde er über die Jahrhunderte immer reicher ausgestattet. „Die Säulen, die Marmortafeln an den Außenfassaden, die ionischen und korinthischen Kapitelle haben alle eines gemeinsam – sie sind gestohlen. Ein Gesetz des Dogen Domenico Selvo (1070–85) besagte, dass jedes Schiff Schmuck für die Basilika mitzubringen habe.“ (Mario Grasso) In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde mit der Verkleidung der Innenwände begonnen, mit Marmorplatten in der unteren, mit Mosaiken in der oberen Zone. Der Sieg über Konstantinopel im Jahre 1204 brachte dann einen solchen Reichtum an Baumaterial, das als Spolien verwendet werden konnte, und natürlich auch an Gold mit sich, dass es möglich war, der Kirche gewissermaßen einen Schmuckmantel umzulegen. Es entstanden die Säulenfassade an der Piazza, die nördliche Vorhalle und die Außenkuppeln mit ihren typischen Laternen über den fünf inneren Kuppelschalen. Nach 1300 wurden die großen gotischen Maßwerkfenster in die West- und Südfront eingefügt. Ab 1385 bis hin ins frühe 16. Jahrhundert entstand die spätgotische Bekrönung mit Figurentabernakeln und geschweiften Wimpergen an den Fassaden, die sowohl Romanisches und Byzantinisches als auch Arabisch-Maureskes in sich vereinigen, woraus, wie der frühere Bürgermeister Massimo Cacciari sagte, sich felici dissonanze ergäben. Das 15. und 16. Jahrhundert brachte Anbauten wie die Cappella dei Mascoli und die Cappella Zen (> Sonderräume). Der Zustand der Westfassade von S. Marco aus der Zeit um 1496 mit ihrer üppigen Vergoldung ist deutlich auf Gentile Bellinis Gemälde Prozession auf dem Markusplatz zu erkennen, das in der Accademia (Akademie der Bildenden Künste > Stadtteil Dorsoduro) hängt.
Außenbau: Der eigentliche Baukörper ist im Norden und Westen von Vorhallen umstellt, im Süden bilden Cappella Zen, Baptisterium und Tesoro die Ummantelung. Durch diese vorgelagerten Räume entstand darüber Platz für eine Terrasse, die an drei Seiten um die Kirche geführt ist.
Die Kirche besitzt drei Fassaden. Die zweigeschossige Hauptfassade zeigt nach Westen und zur Piazza. In der unteren Ebene nehmen die fünf Portalnischen ein Grundmotiv venezianischer Architektur, das der Säulenarkade, auf. Die mittlere Nische ist breiter und höher als die anderen und durchbricht die große Horizontale der Terrassenbalustrade. In zwei Etagen gestellte Säulen aus polychromem Marmor fassen die Nischen ein. Herrliche Steine sind hier zusammengetragen und verarbeitet, und die Kapitelle, von denen keines dem anderen gleicht, bilden eine kleine Welt für sich. Wohl die Hälfte der etwa sechshundert Säulen, die hier verbaut wurden, sind Spolien von griechischen Inseln und „so gut in das Gesamtbild integriert, dass sie nicht immer von den mittelalterlichen Kopien unterschieden werden können.“ (Fortini Brown) In den Nischen öffnen sich rechteckige Türen zur Vorhalle. Die Portalnischen tragen Mosaiken, ebenso wie die Bogenfelder des Hochgadens in der zweiten Etage der Fassade, in der dem mittleren Hauptportal ein großes bogenförmiges Fenster entspricht. Vor diesem stehen heute Kopien der vier antiken Bronzerosse, die nach 1204 von Konstantinopel nach Venedig gebracht wurden. Das Fenster war früher in Felder aufgeteilt, von denen fünf Figuren trugen, nämlich die Darstellung Christi und die vier Evangelisten, die heute in Kopien an der Nordfassade zu sehen sind.
Einzelne herausragende Werke der reich ausgestatteten Fassade seien erwähnt. Bis auf eine Ausnahme sind die Lünetten-Mosaiken der Westfassade erst im 17. und 18. Jahrhundert entstanden, wobei man damals in Thematik und Darstellung auf die heute verlorenen Vorbilder zurückgegriffen hatte. Das Mosaik der linken Portalnische (porta di S. Alippio), das zeigt, wie der Leichnam des hl. Markus in die Basilika getragen wird, stammt dagegen aus dem Jahr 1265. Der Zustand der Kirchenfassade zu jener Zeit ist darauf detailreich wiedergegeben. Besonders schön sind die Bronzeflügel des Mittelportals mit übereinandergestellten Halbbögen (ein Motiv, das in Venedig häufiger zu finden ist) und einer Reihe wunderschöner Löwenköpfe, deren jeder eine eigene Persönlichkeit darstellt. Die Türen stammen aus Konstantinopel und entstanden vermutlich in der Zeit des Kaisers Justinian. Die mittlere Portalnische ist von drei Archivolten übergriffen, die jeweils an Innen- und Stirnseite Reliefstreifen tragen. Viele der hier dargestellten Szenen, die astrologische und theologische Themen behandeln, sind schwer zu deuten. Gut verständlich sind dagegen die Allegorien der zwölf Monate (Innenseite der zweiten Archivolte), sowie die Darstellung der Stände (Innenseite der dritten Archivolte). Diese Kunstwerke gehen zum Teil auf byzantinische Vorlagen zurück, „sind jedoch ohne direkten Kontakt mit der französischen Kathedralgotik des frühen 13. Jahrhunderts nicht denkbar“ (Hubala). Möglicherweise war es Benedetto Antelami, der hier vermittelte. Die Figurengruppe über dem Türsturz des Mittelportals wird Il sogno di S. Marco genannt: Über einem schlafenden Mann steht ein Engel, der gemäß der Legende dem Schläfer weissagt, er werde an der Stelle, an der er schläft, eine Stadt gründen. Die Worte, mit denen der Engel seine Weissagung eingeleitet haben soll, waren „Pax tibi Marce, Evangelista meus“ und stehen seitdem in dem Buch, das der Markuslöwe mit seiner Pranke hochstemmt. Daneben finden sich zahlreiche weitere schöne Details, wie z. B. die Reliefplatten in den Bogenzwickeln. Auf den beiden äußeren sind Taten des Herakles dargestellt (links mit dem kalydonischen Eber, rechts mit der Hirschkuh, die die Hydra zertritt). Das linke Relief stammt aus der Spätantike, und zwar von der Hand des sogenannten Heraklesmeisters, dem auch die beiden weiter innen gelegenen Reliefs zugeschrieben werden, die links die Madonna, rechts den Erzengel Gabriel darstellen. Die ganz innen gelegenen Platten sind byzantinische Werke des 12. Jahrhunderts und zeigen die Heiligen Demetrius und Georg. Weiterhin gibt es feine Steinarbeiten an den Portalnischen.
Höhepunkt der Westfassade sind die vier Bronzerosse auf der Terrasse vor dem Mittelfenster, die auf kurzen Säulenschäften postiert sind. Zu sehen sind heute Kopien, während die Originale im Museo Marciano (in der Kirche auf der hinteren Empore) stehen. Es ist die einzige Quadriga des Altertums, die auf uns gekommen ist. „... ein herrlicher Zug Pferde! Ich möchte einen rechten Pferdekenner darüber reden hören“, schreibt Goethe 1786. Er meint jedoch auch, sie seien nur schwer zu beurteilen und sähen von der Piazza aus gesehen „leicht wie Hirsche“ aus. Die Entstehungszeit dieser Pferde ist nach wie vor unklar. In der Literatur schwanken die Angaben vom späten 1. Jahrhundert bis 200 n. Chr. Früher wurden diese Arbeiten dem 4. Jahrhundert vor Christus zugerechnet, sie sind in jedem Fall in hohem Maße der hellenistischen Kunst verpflichtet. Diskutiert wurde auch schon, ob sie nicht kaiserzeitliche Repliken von verlorenen Werken aus der Zeit des Hellenismus seien. Heute tendiert man dazu, sie in die späte Kaiserzeit zu datieren. 1204 wurden sie vom Hippodrom zu Konstantinopel nach Venedig verbracht, lagen mehrere Jahrzehnte im Arsenal und sollten wohl eingeschmolzen werden. Um 1250 erfolgte die Aufstellung an der heutigen Stelle. 1797 hat Napoleon sie nach Paris schaffen lassen, von wo sie 1815 zurückkamen, um für die Zeit der beiden Weltkriege nochmals ausgelagert zu werden. Die Pferde waren zu Zeiten der Republik vergoldet, wie das Gemälde Gentile Bellinis in der Accademia zeigt. Im Jahre 2006 hat man den Repliken wieder eine dezent golden schimmernde Auflage gegeben.
Die volkstümliche Überlieferung erzählt, dass seit jeher in die Augen der Pferde große Rubine eingesetzt gewesen waren und dass diese Rubine auf der Reise der Pferde über die Alpen geraubt wurden. Nach ihrer Rückkehr aus Frankreich hätte man die uralten Pferde jahrzehntelang in den dunkelsten Nächten des Jahres gehört, wie sie die Piazza der Länge und Quere nach wiehernd und stampfend durchquert hätten, und zwar auf der Suche nach ihren kostbaren Augen. Nach der Installation der elektrischen Beleuchtung auf der Piazza ließen die Pferde von diesem Treiben ab und verweilen seither unbeweglich auf ihrem Platz.
Auf der Spitze über dem Mittelportal steht eine Statue des hl. Markus, die von goldgeflügelten Engeln flankiert wird. In den mittleren Tabernakeln auf der Fassade stehen die vier Evangelisten, in den beiden äußeren eine Verkündigungsgruppe mit Maria rechts und dem Erzengel Gabriel links.
Die Nordfassade (zur Piazzetta dei Leoncini) ist seit Anfang 2006 wieder fast vollständig zu sehen, nachdem sie vorher 25 Jahre lang restauriert wurde. Für den, der noch den alten Zustand der Fassade kannte, ist das Ergebnis in hohem Maße erstaunlich. War die Fassade vorher grau, ja teilweise fast schwärzlich verfärbt durch die Ablagerungen der Zeit, so leuchtet sie jetzt wieder in den verschiedenfarbigen Marmorarten der verkleidenden Platten und der Säulen, erhält klare Akzente durch die scharf geschnittenen Kapitelle sowie die Patere (runde Reliefs) und die genannten Reliefplatten.
Die Fassade ist in gleicher Weise strukturiert wie die Westfassade und besitzt zwei Etagen. In der unteren Zone wiederholt sie das Arkadenmotiv der Westfront, deren Balustrade hier weitergeführt wird. Über der Terrasse ist die Wand in Strebepfeiler und Hochgadenmauern mit Lünetten eingeteilt. In der unteren Etage finden sich vier ungleich weite Bögen. Im Gegensatz zu den anderen Fassaden der Kirche fehlen hier (bis auf eine kleine Ausnahme) die Mosaiken. Die Rückwände der Arkaden werden von verschiedenen Reliefplatten gefüllt, ebenso die Zwickel zwischen den Bögen und die Westwand des deutlich vorspringenden Querschiffs. Hingewiesen sei auf eine Greifenfahrt Alexanders im Zwickel zwischen der ersten und zweiten Arkade (von rechts), ein Motiv, das aus der orientalischen Legende stammt. In der rechten Arkade ist die Darstellung einer sogenannten Hetoimasia zu sehen. Darunter ist der leere Thron Gottes in der Welt zu verstehen, der von zwölf Lämmern, Symbolen für die Apostel, flankiert wird. Vermutlich handelt es sich hier um eine mittelalterliche Nachbildung eines frühchristlichen Werkes.
Eine besonders kostbare Arbeit mit wertvollen Details ist die Porta dei Fiori in der vierten Arkade, die in das dritte Viertel des 13. Jahrhunderts zu datieren sein dürfte. Es sei zunächst hingewiesen auf die beiden byzantinischen Reliefikonen im Türsturz, über denen sich eine doppelte maureske Archivolte spannt. Deren Inneres ist „gefüllt“ mit einem schönen grünen Stein, von dem sich die beiden konzentrisch angeordneten Arabesken farblich und plastisch eindrucksvoll abheben. Im Tympanon befindet sich eine Geburt Christi, die mit etwas naiv-derben Figuren dargestellt ist. Die Stirnseite der inneren Archivolte trägt Pflanzen- und Tiermotive sowie Engel. Die äußere Archivolte zeigt Engel zwischen rahmenden Blattspitzen. All das wird von einem weiten Rundbogen überfangen, der an der Innen- und der Stirnseite skulptiert ist. Zu sehen sind innen Prophetenbüsten in Akanthusrahmen mit Maria im Scheitel, während außen Apostel in einer ähnlichen, noch üppigeren Rahmung und Christus im Scheitel zu sehen sind. Des Weiteren sind über der Porta dei Fiori sowie an der Westwand des Querschiffs der Kirche auf großen Reliefplatten von hoher Qualität die vier Evangelisten (heute Kopien, die Originale im Museo Marciano), der thronende Christus und die Muttergottes dargestellt. Es wird vermutet, dass die Platten von der alten Ikonostasis der Kirche stammen, die der heutigen weichen musste. In der weiten Arkade ganz links an der Nordfassade hat man dem Freiheitskämpfer von 1848/49, Daniele Manin (gestorben 1868), ein zwar prunkvolles, doch wenig stimmiges Grabmal errichtet.
Auch der Aufbau der Südfassade, die zum Dogenpalast weist, entspricht dem der Hauptfassade. Rechts neben den drei Bogenstellungen schließt sich ein glatter, mit feinem, farbigem Marmor verkleideter Mauerblock an, der bereits genannte Tesoro, die „Schatzkammer“ von S. Marco. An der linken Ecke der Südfassade findet sich ebenfalls eine geschlossene Wandfläche, die der Südwand der Cappella Zen entspricht. Hier öffnete sich früher die sogenannte porta da mar, durch die der Narthex von dieser Seite her zu betreten war. In der oberen Etage, zwischen den Obergadenbögen mit Vergitterungen, die aus Konstantinopel stammen, wird ein byzantinisches Madonnenbild des 13. Jahrhunderts, die sogenannte Madonna del Mare, von zwei Lichtern flankiert. Gemäß der Tradition sollten sie eigentlich Tag und Nacht brennen.
Diese Tradition soll laut der legendären Überlieferungen auf die Stiftung eines Seemanns zurückgehen. Jedoch wird auch von einem ewigen Sühnezeichen für einen Justizmord berichtet, der an einem Bäckerjungen namens Pietro Faccioli begangen wurde. Der war in Verdacht geraten, einen Adeligen ermordet zu haben. Als man dessen Leiche auffand, steckte im Herz des Toten ein Dolch, der exakt in die Scheide passte, die der Bursche bei sich trug, ohne dass er genau hätte erklären können, wie sie in seinen Besitz gekommen war. Er behauptete zwar, er habe sie am Morgen nach dem Mord auf der Straße gefunden und behalten (nach Howells), doch nahm ihm niemand diese Erklärung ab. So wurde er des Mordes für schuldig gesprochen und zwischen den Säulen hingerichtet. Erst viele Jahre später konnte der Fall definitiv geklärt werden, als nämlich der eigentliche Mörder auf seinem Sterbebett in Padua die Tat gestand. Von den beiden Lampen wurde gemäß der Legende die eine für die Seele des ermordeten Adeligen, die andere für die des unschuldigen Bäckerjungen gestiftet. Der Rat der Zehn hat aus diesem Vorfall eine Lehre gezogen und verhängte nie mehr ein Todesurteil, ohne dass zuvor eines seiner Mitglieder feierlich die Worte gesprochen hätte: „Ricordatevi del poaro (povero) Fornaretto – denkt an den armen Bäckerjungen“. Seit dem Tod dieses Bäckerjungen sei es nicht schwierig – so die Legende –, in nebligen Nächten an dem Säulenstumpf aus Porphyr, der an der Südwestecke von S. Marco steht, ein paar Tropfen von brennend rotem Blut zu erblicken, ein Zeichen, mit dem der Junge seine Wut über die Republik hinausschreit, die ihm in der Blüte seines Lebens dieses raubte. Weiterhin wird berichtet, dass zu Seiten der Madonna während Exekutionen schwarze Kerzen angezündet wurden, die den Menschen, die da auf der Piazzetta gerichtet wurden, noch Stärkung bringen sollten.
Vorhallen (Narthex): Sie umgeben den eigentlichen Kirchenbau im Westen und Norden L-förmig und besitzen Nischen, in denen mehrere Dogen bestattet sind. Teile des westlichen Flügels, so die mittlere Portalnische und der Lichtschacht vor dem inneren Hauptportal, stammen noch aus der ersten Bauphase des 11. Jahrhunderts, alles Übrige entstand erst im 13. Jahrhundert. Besonders schön sind die zwölf Säulen zu Seiten der Portalnische. Eine wundervolle Arbeit ist der Mosaikfußboden aus vielfarbigem Marmor, der im 11. Jahrhundert entstand und auf den Fußboden einstimmt, der den Besucher im Inneren der Kirche erwartet. Den westlichen Teil des Narthex übergreifen Kuppeln, zwischen die Tonnengewölbe geschaltet sind. Eine Folge von vier weiteren Kuppeln findet sich im nördlichen Flügel. Die Gewölbezone wird von Mosaiken aus den Jahren 1220–1300 bedeckt, auf denen Themen aus dem Alten Testament gezeigt werden. Die Vorbilder für diese Kompositionen kamen nicht aus Byzanz, sie sind vielmehr „ausgeprägt abendländisch und stilgeschichtlich spätromanisch“ (Hubala) und gehen auf spätantike bebilderte Handschriften zurück. „Entscheidend aber ist, dass aus solchen Anregungen ein durchaus eigener, eben venezianischer Bildstil entwickelt wurde, der durch eine detailreiche Erzählung, ein oft buntes Kolorit ... gekennzeichnet ist.“ (Hubala) Der Zyklus beginnt in der südlichen Kuppel der westlichen Vorhalle mit den Schilderungen der sechs Tage der Schöpfungsgeschichte. Es sind zauberhaft naive, dabei aber ausgesprochen ausdrucksstarke Formulierungen dieses Themas. Die Bilder der folgenden Tonne erzählen mit köstlichen Einzelheiten die Geschichte der Arche Noah, die in der linken Tonne ihre Fortsetzung findet. Thema der nächsten Kuppel ist die Geschichte Abrahams, die drei folgenden Kuppeln zeigen Bilder aus der Josefslegende. In der letzten Kuppel wird die Geschichte des Moses geschildert.
Innenraum: „Ich schwimme in einem Traum aus Gold. Ich bin gefangen in Netzen aus Gold, ich stehe auf Gold, ich tauche unter in Gold. Ein Geruch von Gold berührt mich. Ich habe das Gold unter den Füßen. Ich habe Gold auf dem Kopfe. Die tiefen und fernen Fenster sind goldene Filter; und das Gold dringt wie eine ganz feine Welle zwischen die Pfeiler ... Die Grundpfähle von San Marco müssen aus Gold sein, Wälder aus goldenen Barren in die Lagune gepflanzt“, so schwärmt André Suarès (1866–1948). Und in der Tat: Dem Eintretenden verschlägt es schier den Atem ob der Pracht und Fülle, die allenthalben herrschen und das Aufnahmevermögen sprengen.
Die Architektur stammt im wesentlich aus dem 11. Jahrhundert. Marmorinkrustation und Mosaiken entstanden im 12. bis 14. Jahrhundert. Der Grundgedanke der Architektur von S. Marco, als sogenannte Kreuzkuppelkirche, wurde prägend für zahlreiche spätere Sakralbauten Venedigs. Bei diesem Typus der Sakralarchitektur wird ein zentraler Kuppelraum an seinen Ecken von vier kleineren überkuppelten Trabantenräumen flankiert, zwischen denen sich Tonnen spannen. Die insgesamt fünf Kuppeln sind dabei so angeordnet, dass sich im Grundriss ein Bild ergibt wie bei der „Fünf“ des Spielwürfels, was auch als quincunx bezeichnet wird. Diese Grundform kann für sich alleine ausgeformt sein. Hier in S. Marco sind jedoch jeweils drei dieser Systeme ineinander verzahnt, und zwar dadurch, dass eine Tonne und zwei Trabantenräume jeweils zu zwei Systemen gehören. Diese Art der Verzahnung geschieht dabei sowohl in der Längs- als auch in der Querachse des Raumgebildes. Es sind hier fünf große Kuppeln so angeordnet, dass sich ein griechisches Kreuz (mit gleichlangen Schenkeln) ergibt, das jedoch nicht ganz rein geformt ist. So ist der Durchmesser der mittleren Kuppel, welche die Vierung von Längs- und Querarmen übergreift, größer als derjenige der vier übrigen. Das typische System der quincunx ist im Bereich der Presbyteriumskuppel in der Weise modifiziert, dass der entsprechende Kuppelraum gleichzeitig die mittlere Chorkapelle eines dreiteiligen Presbyteriums und somit von anders geformten Räumen umgeben ist. Die Kuppeln werden von mächtigen quadratischen Pfeilern getragen, die nicht kompakt sind, sondern jeweils zwei kleine, übereinander angeordnete und überkuppelte Räume enthalten, die nach drei Seiten offen sind. Zwischen den Pfeilern verlaufen weite Tonnen mit halbkreisförmigem Querschnitt, sie flankieren die Kuppeln an vier Seiten. Eigentlich ist die Kirche als Zentralbau angelegt, doch entsteht durch architektonische Besonderheiten die Betonung einer bestimmten Richtung. Dies geschieht einerseits durch die Apsis mit ihren Nischengruppen, andererseits durch die Säulenarkaden, die zwischen die Pfeiler gespannt sind und Säulchenbalustraden tragen, die sogenannten Katzenstege, Reste der Emporenanlage der früheren Contarinikirche. Diese Säulenarkaden „teilen“ den Raum jedoch nur in der unteren Zone, lassen die Wölbungszone dagegen frei. Der Eindruck der Dreischiffigkeit entsteht somit nur unten, um darüber vollkommen verwischt zu werden. Wichtig für den Raumeindruck ist schließlich die große Chorschranke (Lettner, Ikonostasis), die von den Brüdern dalle Masegne in den Jahren 1394–1404 ausgeführt wurde und so gewichtig ist, dass sie den östlichen Kuppelraum optisch abgetrennt.
Mosaiken: Bei der Entstehung des Baus war eine Dekoration mit Mosaiken noch nicht geplant. „Man muss sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Kirche im 11. und frühen 12. Jahrhundert nur eine teilweise, auf Apsis (und Portale im Narthex) beschränkte Mosaikdekoration aufwies.“ (D. Demus bei Hubala)
Mosaiken hat man auch Gemälde für die Ewigkeit genannt, weil sie sich nicht verändern und insbesondere ihre Farben nicht verblassen. Die Kunstform des Mosaiks reicht bis zum Hellenismus zurück, doch kann vermutet werden, dass die eigentlichen Wurzeln noch tiefer liegen. Die Römer übernahmen diese Dekorationsform und perfektionierten sie, um sie sowohl im sakralen (z. B. Santa Costanza, Rom), als auch im profanen Bereich (Fußböden in Pompei u. a.) zu verwenden. In der Spätantike wurde die musivische Kunst bevorzugt von der Kirche eingesetzt (S. Maria Maggiore und zahlreiche weitere Kirchen Roms). Die später zu datierenden Mosaiken von Ravenna stehen dann schon ganz in byzantinischer Tradition. Für Mosaiken werden Glas- und Marmorwürfel mit einer Kantenlänge von etwa einem Zentimeter benutzt. Mit Hilfe von Vorlagen, den sogenannten Kartons, wurden die darzustellenden Themen in Originalgröße in die Putzschicht versetzt, wodurch Tagwerke bis zu einem Quadratmeter möglich waren. Die Mosaiken von S. Marco – insgesamt sind es mehr als 8.000 qm – wurden in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts begonnen, in einer Zeit also, in der Venedig sich längst von Byzanz gelöst hatte und zu einer gleichwertigen Macht geworden war. Sie stehen folgerichtig nicht mehr nur in byzantinischer Tradition, sondern sind „abendländisch“, das heißt die Einzelthemen sind nicht gerahmt, sondern schweben über einem lückenlosen Goldgrund, der den gesamten oberen Teil des Baus überzieht und die Architektur fast verwischt.
Von der Thematik her sind die Mosaiken von Ost nach West angeordnet und zu lesen: In der Altarkuppel erscheint Christus im Kreise der Propheten, in der Mittelkuppel wird er, umgeben von den Aposteln, zum Himmel getragen („Himmelfahrtskuppel“). Die Westkuppel zeigt das Pfingstwunder mit Herabkunft des Hl. Geistes auf die Jünger („Pfingstkuppel“). Über dem Eingang findet sich eine Darstellung des Weltgerichts. „Christus herrscht also in den Mosaiken der Längsachse, der Bogen wölbt sich vom Vorhistorischen über das Geschichtliche bis zur Endzeit des Jüngsten Gerichts.“ (Hubala) Ist die Längsachse thematisch in sich geschlossen, so sind die Darstellungen der beiden Querhauskuppeln ohne direkten Bezug. So werden in der Nordkuppel Szenen aus dem Leben des hl. Johannes gezeigt, während in der Südkuppel weitere Heilige vor dem goldenen Hintergrund stehen und dort fast etwas verloren wirken. In den Bögen, welche die Mittelkuppel umgeben, sind Szenen des Neuen Testaments zu sehen, die Zwickel (Pendentifs) tragen die Evangelistensymbole.
Ein weiterer kostbarer Mosaikschmuck ziert den Fußboden (Paviment), der aus mehr als 60 Marmorarten zusammengesetzt ist und im 12. und 13. Jahrhundert entstand. Ein schier unerschöpflicher Reichtum an Formen, Mustern und Farben tut sich hier auf, und der Boden hebt und senkt sich in leichten Wellen, so dass das Beschreiten an die Bewegungen der Meeresoberfläche denken lässt. Nicht übersehen werden sollte die Inkrustation der Wände im unteren Bereich des Raumes. Hier sind fein geäderte, zersägte Marmorplatten so verlegt, dass sich reiche, spiegelbildliche Muster ergeben, die mit denen der gegenüberliegenden Wände korrespondieren. Es wird berichtet, dass die Venezianer diese Marmorplatten 1204 von der Westfassade der Hagia Sophia in Konstantinopel geraubt hätten. Fußboden und Wände entsprechen – metaphorisch gesprochen – dem irdischen Bereich, während Gewölbe und Kuppeln für den himmlischen Bereich stehen.
Ausstattung: Gleich nach dem Eingang, am Ende des rechten Seitenschiffs, findet sich an der Wand eine sogenannte Deesis, bei der Christus zwischen Maria und Johannes dem Täufer in Halbrelief dargestellt ist. Die Figuren, die jeweils von einer Säulenarkade umgeben sind, entstanden im 11. Jahrhundert. Weiter vorne im Seitenschiff befindet sich die Türe zum Baptisterium (> Sonderräume). Im Chor ist unter einer schlichten Platte der Architekt Jacopo Sansovino begraben (er hatte bis zum Ende der Republik sein Grab in der von ihm selbst erbauten Kirche S. Geminiano, die Napoleon abreißen ließ).
Am Eingang zum rechten, dem südlichen Querarm findet sich am Pfeiler ein Muttergottesrelief aus dem 12. Jahrhundert. Es ist stark abgeschliffen, denn es handelt sich um eine „Kusstafel“, um eine sogenannte Madonna del Bacio. Solchen Kusstafeln Verehrung zu erweisen, soll dem Gläubigen Glück und Gesundheit bringen. Von diesem Bildwerk berichtet die Legende, es sei aus dem Stein gefertigt worden, aus dem Moses im Sinai Wasser geschlagen habe. In der Ecke dahinter liegt der Eingang zum Tesoro, zur Schatzkammer. Zu beachten ist im südlichen Querarm das große Rundfenster mit feinem gotischem Maßwerk aus dem 15. Jahrhundert. Grundgedanke der Gliederung ist hier das Leitmotiv venezianischer Architektur, die Säulenarkade, wie an den radial gestellten Säulen zu erkennen ist. Das Fenster war früher sicher polychrom verglast.
Zwischen rechtem Querarm und Lettner steht vor dem Pfeiler der Frührenaissance-
Altar des hl. Jacopo di Compostela, der wie sein Gegenstück, der Paulus-Altar auf der anderen Seite des Längsarmes, vom Dogen Cristoforo Moro (1462–71) gestiftet wurde. Es handelt sich um Arbeiten von Antonio Rizzo, die im Jahre 1469 fertiggestellt waren. Eine Beteiligung von Pietro Lombardo wurde diskutiert. Die Architektur der Renaissancetabernakel kann formal auf Desiderio da Settignanos Sakramentstabernakel in San Lorenzo, Florenz (1461), zurückgeführt werden. Besonderer Beachtung wert ist hier die in feinster Meißeltechnik ausgeführte Dekoration an Pilastern und Bögen. „Rizzos Altäre gehören zu den frühesten Beispielen, die Pfeiler, Gebälk und Bogenfeld als strukturelle Rahmenelemente eines Altars einsetzen.“ (Anna M. Schulz) Weiter hervorzuheben sind die beiden Leuchterengel auf den seitlichen Balustraden, deren linker an Arbeiten Verrocchios erinnert und somit toskanische Wurzeln hat. Am Pfeiler hinter dem Altar des hl. Jacopo di Compostela vollzog sich gemäß der Legende die sogenannte apparitio, das Wunder der Erscheinung der Markusreliquien, die nach dem Großbrand von 976 verschollen waren und hier 1094 wieder auftauchten.
Links neben dem Pfeiler führen ein paar Stufen zur Cappella di San Clemente, die ausschließlich dem Dogen vorbehalten war und deshalb kostbar ausgestattet wurde. Er konnte sie durch eine eigene Türe direkt vom Palast aus erreichen. Besonders ist auf das Mosaik in der Apsis mit seinen herrlichen Abstufungen des Kolorits hinzuweisen. Der untere Teil des Relief-Retabels am Altar zeigt den Dogen Andrea Gritti zu Füßen der hll. Andreas und Nikolaus. Die Muttergottes darüber hat der Doge Cristoforo Moro 1465 gestiftet. Sie steht stilistisch in der Nachfolge Donatellos, wobei aber auch auf eine Darstellungsweise der venezianischen Malerei dieser Zeit zurückgegriffen wurde (die Muttergottes stehend, das Kind vor ihr auf einer Balustrade).
Nach links öffnet sich der Zugang zum Presbyterium. Dieser Teil der Kirche wurde 1834–36, als man S. Marco zur Patriarchalkirche umfunktionierte, wesentlich umgestaltet und stellt sich heute deshalb anders dar als zu Zeiten der Republik. Vorher bot er bei großen Festen Platz für den Dogen und die Signoria. Presbyterium und Apsis bergen Werke von höchstem historischem und kunsthistorischem Wert. Im Vorchor stehen seitlich zwei Sängerkanzeln (Cantorien) mit Bronzereliefs Sansovinos, die Szenen aus dem Leben des hl. Markus zeigen (1537–44). Der Hochaltarraum wird seitlich jeweils durch zwei Säulchenbalustraden mit Bronzestatuetten der sitzenden Evangelisten abgetrennt, die ebenfalls Sansovino gearbeitet hat (1550–52). Die Kirchenlehrer daneben stammen aus dem frühen 17. Jahrhundert.
Der Hochaltar wurde 1834–36 aus alten Stücken rekonstruiert. Von großem Interesse sind die vier Marmorsäulen, die den Altarbaldachin tragen und rundum, jeweils in neun Zonen, Darstellungen aus der Geschichte Christi und Marias tragen. Kleine Figuren, deren Motivik auf Elfenbeinschnitzereien zurückgeht, sind hier in Säulenarkaden gestellt und szenisch angeordnet. Die Datierung ist unsicher. Diskutiert wird eine Entstehung im 13. Jahrhundert, wobei das hintere Säulenpaar auch aus dem 5. oder 6. Jahrhundert stammen könnte. – An der rechten Seitenwand des Chorraumes ist der sogenannte Thron des Markus auf einem hohen Postament aufgestellt, der früher in der Schatzkammer aufbewahrt wurde. Der Name ist sicher unzutreffend, da es sich in Wirklichkeit um ein Reliquiar handelt, das vermutlich für die Fragmente der hölzernen Kathedra, des legendären Stuhles Petri, bestimmt war. Es wird angenommen, dass der Thron im 6. oder 7. Jahrhundert in Alexandrien gearbeitet wurde. Auf ihm sind der Lebensbaum mit dem Lamm und den vier Flüssen des Paradieses sowie die Evangelisten mit ihren Symbolen dargestellt. Laut Überlieferung handelte es sich um ein Geschenk, das der byzantinische Kaiser Heraclius 630 dem ersten Patriarchen von Grado zusandte.
Ein einzigartiges Werk – eine Feststellung, die nicht nur für Venedig gilt – ist die Pala d’Oro an der Rückseite des Hochaltars. Dieser Altaraufsatz, der 3,45 x 1,40 m misst, besteht aus mehr als 800 Einzelstücken wie Goldemailles, Edelsteinen und Ornamenten und ist ein Werk mit einer langen Entstehungsgeschichte. Die Einzelteile, die aus dem Zeitraum zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert stammen, wurden nach und nach zusammengesetzt. Dabei wurden sowohl Teile byzantinischer Herkunft verwendet, als auch solche, die in Venedig selbst gearbeitet wurden (aus Venedig stammen z. B. die Emailplatten mit Szenen des Neuen Testaments und aus dem Leben des hl. Markus, während die Darstellungen von Begebenheiten aus dem Leben Christi byzantinisch sind. Ein unmittelbarer Stilvergleich ist dadurch ohne weiteres möglich). Die Pala d’Oro entging nach dem Ende der Republik nur deshalb der Vernichtung und wurde nicht eingeschmolzen, weil fälschlicherweise angenommen wurde, sie bestehe nur aus vergoldetem Material und nicht aus massivem Gold (Zorzi).
In der Apsis stehen vier Spiralsäulen aus Alabaster, die den Altarbaldachin tragen und deren Transparenz gelegentlich mit starken Lichtquellen demonstriert wird. Auf dem Tabernakel zeigt ein Relief Sansovinos den auferstandenen Christus mit Engeln. Ebenfalls von Sansovino stammt die herrliche Sakristeitür links vom Altar, die der konkaven Apsiswand angepasst ist. Sie trägt zwei große Relieffelder mit Darstellungen der Grablegung und der Auferstehung Christi, die von kleineren quadratischen und rechteckigen Feldern umgeben sind. Dieses System hat als direktes Vorbild die Porta del Paradiso von Ghiberti am Baptisterium von Florenz. Wie dort, so tragen auch hier die Eckquadrate kleine vollplastische Köpfe. Sie sollen gemäß der Überlieferung Zeitgenossen Sansovinos darstellen: den Künstler selbst (rechts unten), daneben Tizian, Aretino, Palladio, Veronese und Sansovinos Sohn Francesco.
Wieder zurück in der Vierung, also dem Raum unter der Mittelkuppel, hat man die Ikonostasis der Brüder Jacobello und Pierpaolo dalle Masegne aus den Jahren 1394–1404 vor sich. Sie erhebt sich über der Krypta (erkennbar an der Stirnmauer mit Säulenarkaturen und Fenstern) und ist aus polychromem Marmor gefertigt. Auf ihr steht eine Kreuzigungsgruppe, die von den großen Figuren der Apostel flankiert wird. Herrliche Charaktere sind hier in der Formensprache der Spätgotik gestaltet. An den Pfeilern beidseits des Presbyteriums stehen zwei Kanzeln, deren rechte zu Zeiten der Republik pergolo grando genannt wurde und aus Porphyr besteht. Auf ihr wurden bei bedeutenden Zeremonien die wichtigsten Reliquien aus dem Besitz von S. Marco ausgestellt. Der jeweils neu gewählte Doge wurde auf ihr dem Volk präsentiert zur collaudatio, den obligatorischen Beifallsrufen, und zwar mit dem traditionellen Satz: „Questo xe Missier lo Doxe, se ve piaxe“ – Das ist der neue Doge, wenn es euch gefällt“ (das venezianische „x“ wird als stimmhaftes „s“ ausgesprochen). Das Volk hatte auf die Frage mit den jubelnden Rufen „sia! sia!“ zu antworten. Der Präsentation des neuen Dogen war dessen Amtseinsetzung vorangegangen, die der primicerius, der oberste Kleriker von S. Marco als Vertreter des Heiligen vornahm, indem er dem Gewählten das Staatsbanner überreichte. Besonderer Beachtung wert sind vier vergoldete, kerzentragende Engelsstatuen hoch oben an den Ecken der Vierung, die aus dem 13. Jahrhundert stammen, also zu den ersten Werken venezianischer Großplastik gehören. Sie sind von ausgezeichneter Qualität und lassen an Werke Antelamis denken.
Auf dem Altar des linken, des nördlichen Querarms wird eine byzantinische Madonna verehrt, ein Andachtsbild des 10. Jahrhunderts vom Typ der Nicopeia, der „Siegbringerin“, das zu der Beute gehört, welche die Venezianer 1204 bei der Eroberung von Konstantinopel machten. Dort war die Nicopeia die Schutzpatronin der Römer und fungierte auch als condottiera delle legioni (Anführerin der Legionen), besaß somit eine zentrale Rolle innerhalb der Kaiserliturgie. Sie war in einer Kapelle der kaiserlichen Paläste untergebracht. Seit 1234 befindet sich die Nicopeia in S. Marco und besitzt auch ein Prunkgewand, das im Tesoro aufbewahrt wird. Das Madonnenbild hatte für die Venezianer immer eine große Bedeutung und wurde bei vielen Gelegenheiten um Hilfe angefleht. Das geschah jeweils durch große Prozessionen auf der Piazza, bei denen das Bild von vier Priestern getragen wurde, denen der gesamte Klerus der Stadt zusammen mit dem Dogen und den Adeligen folgte. Auf diese Weise hat man beispielsweise 1630 um das Ende der Pest gebetet und die Madonna fünfzehn Samstage darum angefleht. Anlässlich des Untergangs der Republik im Jahre 1797 blieb das Bild ebenfalls fünfzehn Tage lang ausgestellt. Auch 1919 und 1945 vereinigte sich die Bevölkerung Venedigs vor dem Andachtsbild, um für die Beendigung der beiden Weltkriege zu danken. Der Raum davor, von dem Hubala meint, er könne „eine gewisse Vorstellung vom Aussehen des Kirchenraums zur Zeit der Republik geben“, ist von einer dichten, andächtigen Stimmung erfüllt, er ist dem stillen Gebet vorbehalten. Am Pfeiler an der Ecke zwischen nördlichem Querhaus und dem Längsarm nach Westen ist die sogenannte Madonna dello Schioppo zu sehen, ein besonders schönes Relief aus dem 13. Jahrhundert. Der heutige Name bedeutet „Madonna mit der Flinte“ und nimmt mit der nach dem ersten Weltkrieg hinzugefügten Waffe auf die Errettung venezianischer Soldaten in diesem Krieg Bezug.
Die Cappella dei Mascoli liegt links hinten im linken Querarm. Die Betrachtung ihrer Kunstwerke ist wegen der meistens ungünstigen Lichtsituation in der Regel schwierig. Beleuchtet wird sie nur bei feierlichen Anlässen, und auch dann bleibt sie durch ein Gitter abgesperrt. Sie hat ihren Namen von der Bruderschaft der mascoli, der unverheirateten Männer. Besonderer Beachtung wert sind sowohl die Figuren auf dem Altar als auch die Mosaiken des Tonnengewölbes. Auf dem Altar steht Maria mit dem Kind zwischen den hll. Markus und Johannes. Die Figuren sind von einer aufwendigen Architektur mit gedrehten Säulen, Fialen und Wimpergen gefasst. Der Name des ausführenden Meisters ist nicht bekannt, er wird deshalb als „Mascoli-Meister“ bezeichnet. Die Werke gehören dem sogenannten Übergangsstil an, der zeitlich zwischen Spätgotik und Frührenaissance anzusetzen ist und Stilmerkmale beider Epochen vereint. Sie weisen aber auch nordische Einflüsse auf, besonders die Muttergottes. Sehenswert sind auch die beiden schönen Engel im Antependium. Die Mosaiken der Kapelle, deren Entstehungszeit um 1450 liegt, zeigen Szenen aus dem Marienleben. So ist in der Lünette eine Verkündigung zu sehen, in der Tonne links sind Geburt und Darstellung im Tempel, in der rechten Heimsuchung und Tod dargestellt. Der ausführende Künstler hat seine Werke deutlich mit seinem Namen Michele Giambono signiert. Nicht ganz klar ist, von wem die Kartons stammen, bei denen in jedem Fall toskanische Einflüsse anzunehmen sind (besonders im Marientod). Die Heimsuchung wird mit Jacopo Bellini, der Marientod mit Mantegna oder Castagno in Verbindung gebracht. „Jedenfalls ist das Mosaik des Marientodes eine Inkunabel venezianischer Frührenaissance, vorbildlich für die Bildarchitekturen Jacopo Bellinis und als Übertragung eines Bildgedankens donatellesker Herkunft zu beurteilen.“ (Hubala)
Im Weitergehen nach Westen (in Richtung Ausgang) findet sich links am Vierungspfeiler der Verkündigungsaltar, der seine heutige Gestalt im 14. Jahrhundert erhielt. Das schöne gemalte Kruzifix wurde bei der Eroberung von Konstantinopel erbeutet und 1205 von dort nach Venedig gebracht. Es stand dann zunächst auf der Piazza und kam erst 1290 an seinen jetzigen Platz. Seinen Namen hat der Altar von der Verkündigungsgruppe aus dem 13. Jahrhundert, deren Figuren etwas unbewegt und schwerfällig anmuten.
Sonderräume: Der Zugang zum Baptisterium unterliegt unterschiedlichen Regelungen. Zumeist muss im Patriarchenpalast eine Erlaubnis eingeholt werden. Dasselbe gilt für die Cappella Zen im Narthex sowie für die Krypta und ist ein recht kompliziertes Unternehmen. Manchmal ist das Baptisterium jedoch ohne weiteres zugänglich, dann allerdings den Betern vorbehalten. Es ist ebenfalls vollständig mit Mosaiken ausgekleidet, u. a. ist hier eine hinreißende Salome zu sehen.
Gegen Gebühr zugänglich ist die Schatzkammer, der Tesoro, mit einer exquisiten Sammlung der Kostbarkeiten, die nach 1797 noch verblieben sind. Vertreten sind u. a. Werke byzantinischer Goldschmiedekunst, Reliquienbehälter, Kreuzreliquiare, aus erlesenen Steinen geschnittene Pokale, ein silbernes Kreuzkuppel-Kirchenmodell. Beachtenswert ist das Portal bzw. die eigenartig geformte Arabeske über dem Türsturz. Diese trägt ein kunstvoll gearbeitetes Band mit Ranken, Vögeln und anderen Tieren. Im Tympanon sind zwei mosaizierte Engel vor einem Hintergrund zu sehen, der das Bogenmotiv des Bronzeportals von S. Marco wiederholt. Vor diesem Mosaik steht ein Schmerzensmann des 14. Jahrhunderts, der Züge nordischer Skulptur trägt.
Ebenfalls zugänglich sind die Galerien mit dem Museo Marciano. Dieses erreicht man über eine steile Treppe rechts des Haupteingangs. Ein Besuch ist in jedem Fall zu empfehlen. Von den Galerien aus hat man einen wunderbaren Blick in den Kirchenraum und auf die Mosaiken, und zwar gleich beim Eingang des Museums in die Längsachse der Kirche sowie von der Nordkuppel aus in deren Querarme. Tritt man von hier nach draußen auf die schmale umlaufende Terrasse, bietet sich ein hinreißender Blick über Piazza und Piazzetta. Das Museum birgt heute zahlreiche Werke, die hier vor der Einwirkung der Witterung in Sicherheit gebracht wurden. Insbesondere sind dies die Originale der vier Bronzepferde. Sie sind heute gut aufgestellt und ausgezeichnet beleuchtet, so dass man sie gut studieren kann. Nach einer grundlegenden Umgestaltung und Erweiterung des Museums fesseln und ergreifen Kraft, Bewegung und Feuer dieses singulären Werkes, das noch erstaunlich üppige Reste der ursprünglichen Vergoldung zeigt. Gleich daneben befinden sich das Original der Tetrarchen von der Außenseite des Tesoro sowie die Reliefplatten mit der Darstellung der Evangelisten, die sich früher am Seitenportal der Nordfassade befanden. Das Museum windet sich heute förmlich um die Markuskirche herum. In den teilweise recht engen Räumlichkeiten werden liturgische Gegenstände und Gewänder gezeigt. Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus die Sansovino-Madonna, die beim Einsturz des campanile 1902 zertrümmert wurde – man hat sie aus mehr als 1.000 Fragmenten wieder zusammengesetzt. Teil des Museums ist heute der ursprüngliche Ballsaal des Dogen, der in den Patriarchenpalast integriert ist.
Die anderen Sonderräume, wie die Cappella Zen am südlichen Ende der Vorhalle, die Krypta unter der Kirche und die Cappella di S. Isidoro am Ende des nördlichen Querarms, sind nur mit Sondergenehmigung zugänglich.
► Der Dogenpalast
„Eine derartige Baukunst hat man sonst noch nirgends gesehen, alles daran ist neu, man fühlt sich vom Hergebrachten erlöst, man begreift, dass es jenseits der klassischen und gotischen Formen eine ganze Welt gibt, dass die menschliche Erfindung ohne Grenzen ist ... Alle Gewohnheiten der Augen werden umgeworfen, und mit wundervoller Überraschung sieht man hier die morgenländische Phantasie Fülle auf das Leere anstatt Leere auf die Fülle setzen.“ (H. Taine)
Wie so vieles in Venedig, so ist auch der Palazzo Ducale von zahllosen Abbildungen her bekannt als komplexer Bau von unerhörtem Detailreichtum. Heute ist das riesige Gebäude praktisch ein Museum seiner selbst und eine Gemäldegalerie von größtem Reichtum.
Der Dogenpalast ist das einzige Gebäude der Stadt, das offiziell palazzo genannt wird. Alle anderen Bauten des Adels und der Reichen, und seien sie auch noch so prachtvoll und somit ihrem Wesen nach klar Paläste, heißen im Venezianischen Ca’, die Kurzform für casa (Haus). Bis 1797 war der Dogenpalast die Residenz der Dogen, die verpflichtet waren, in dem ihnen zugeteilten weitläufigen Appartement zu wohnen. Alle Veränderungen der Räumlichkeiten, die sie wünschten, mussten sie selbst bezahlen und außerdem auch noch für alle hier entstehenden Repräsentationskosten aufkommen. Daneben barg der Palast insbesondere den riesigen Saal für die Versammlungen des Adels, die Sala del Maggior Consiglio, sowie die Amtssitze der Regierungsgremien und der obersten Richter. Interessant ist, dass es beileibe nicht nur goldstrotzende Säle waren, in denen Macht ausgeübt wurde. Im Rahmen einer höchst empfehlenswerten Führung, genannt die Itinerari segreti (geheime Wege), werden Räumlichkeiten gezeigt, die eher Verschlägen als Büros gleichen und in denen Träger wichtigster Ämter auf etwa zwei Quadratmetern zusammen mit ihrem Sekretär an einem winzigen Tischchen arbeiteten. Mit seiner Gesamtanlage und seinen Prunkräumen „verkörpert der Dogenpalast Macht und Herrlichkeit, Geschichte und Eigenart des venezianischen Staates für alle Welt“ (Hubala).
Baugeschichte: Die Anfänge einer Dogenresidenz liegen im Dunkeln, doch soll schon bald, nachdem die Verwaltung im 9. Jahrhundert von Malamocco hierher verlegt wurde, eine hölzerne, von Wasser umgebene Burg entstanden sein. Von diesem Vorgängerbau hat sich nichts erhalten, und auch anderweitige Quellen liefern keinerlei Informationen über die Struktur dieses Gebäudes. Erste wesentliche Veränderungen fanden unter dem kurzen, aber hochbedeutenden Dogat Sebastiano Zianis (1172–78) statt, der 1177 als Friedensstifter zwischen Papst Alexander III. und Kaiser Friedrich Barbarossa fungierte. Von diesem Palast sind „dicke Mauern aus Haustein im Westflügel, umfangreiche Reste eines Turms an der Südostecke und eine einsame Säule im Südflügel“ (Wolters) noch nachweisbar, von der Struktur des Baus ist jedoch nichts überliefert. Es wird angenommen, dass das Gebäude von Ecktürmen flankiert war und, in Anlehnung an die Contarinikirche (die Baugestalt der Markuskirche im 11. Jahrhundert), bereits das Motiv der Säulenarkade aufgenommen hatte, sich also schon zur Umgebung hin öffnete. 1340 fasste man den Entschluss zu einer durchgreifenden baulichen Veränderung bzw. zu einem Neubau. Der Anstoß dafür ging von der Notwendigkeit aus, einen ausreichend dimensionierten Saal für die Versammlungen des auf mehr als 1800 Mitglieder angewachsenen Großen Rates zu schaffen. Als Architekten wurden ein Filippo Calendario (der sich dann in die Falier-Verschwörung verstrickte und am 16. April 1355 zwischen den Säulen des von ihm erbauten Palastes gehängt wurde) und die Familie der Bon (oder Buon) genannt. Zwischen 1340 und 1400 entstand der Südflügel (am Molo), dessen Skulpturen-Schmuck (sogenanntes Stenofenster, Kapitelle und Eckplastiken) nach 1404 hinzukam. Die Sala del Maggior Consiglio wurde 1423 unter dem Dogen Francesco Foscari eingeweiht, der bis 1438 die Front des alten Ziani-Baus zur Piazzetta hin niederlegen und den jetzigen Westflügel aufführen ließ. Gleichzeitig entstand die Porta della Carta, ab 1483 auch der Ostflügel mit Front zum Rio del Palazzo, nachdem ein Brand einen Vorgängerbau zerstört hatte. Ihm wurden Pläne des Bildhauers Antonio Rizzo zugrunde gelegt, unter dem auch die monumentale Scala dei Giganti im Hof des Dogenpalastes entstand, Ort aller künftigen Dogenkrönungen. Die heute zu sehende kostbare Ausstattung der Innenräume entstand erst nach weiteren Großbränden der Jahre 1574 und 1577. Damals wurde sogar ein radikaler Umbau nach Plänen Palladios erwogen, die man jedoch verwarf – eine Tatsache, die als Glücksfall anzusehen ist, da ein Neubau wohl kaum ein adäquater Ersatz für das wundervolle Bauwerk gewesen wäre.
Die Besichtigung des Dogenpalastes ist zeitaufwendig, aber in hohem Maße lohnend. Ob man sich durch die schier unendliche Raumfolge treiben lässt oder alle Einzelheiten eingehend und vertieft betrachtet – in jedem Fall wird man um unerhörte Eindrücke bereichert.
Äußeres – Baugestalt: Ein weiträumiger, rechteckiger Binnenhof wird an drei Seiten von den Palastbauten, an der vierten (nördlichen) Seite von der Markuskirche begrenzt. Der gewaltige Baukörper misst etwa 75 x 100 Meter. Sein Fundament ist ein Rost von Lärchenstämmen. Das Erdgeschoss ist im Süden und Westen als Arkadenhalle gebildet. 36 schmucklose, mächtige Säulen, die heute durch Anhebung des Platzniveaus etwa vierzig Zentimeter tief im Boden stecken, tragen über figurengeschmückten Kapitellen Bögen mit weicher Rundung. Im zweiten Geschoss stehen Säulenarkaden in so dichter Reihung, dass zwei Bögen oben auf einen unteren Bogen treffen. Zwischen die Säulen im Obergeschoss ist eine feingliedrige Säulchenbalustrade gespannt. Die Säulen tragen hier fast zierlich wirkende Laubkapitelle. Aus diesen steigt das Wunderwerk des gotischen Maßwerkes kraftvoll mit großen kreisrunden Öffnungen empor, in denen Vierpässe geformt sind. Dieses Geschoss wird durch ein Gesims mit einem Blattrosetten-Dekor abgeschlossen. Das nun folgende Hauptgeschoss hat dieselbe Höhe wie die beiden Untergeschosse zusammen und besitzt – abgesehen von den Fenstern – eine geschlossene Fläche, die durch ein kelimartiges Muster aus kleinen Ziegeln in Weiß, Rot und Grün zart strukturiert ist. Die „verkehrte“ Anordnung der Wandflächen der Geschosse – zerbrechliche Bögen unten tragen massives Mauerwerk oben – ist oft besprochen und natürlich auch als statisch unsinnig kritisiert worden. Man mag dazu stehen wie man will: Durch seine ungewöhnliche Fassadenstruktur gewinnt dieses gewaltige Bauwerk etwas Schwebendes, ein Eindruck, der noch verstärkt wird durch das Licht der Lagune, aus dem es sich erhebt. Ohne weiteres kann auch die Vorstellung entstehen, dass hier einem Würfel eine Decke mit venezianischer Spitze übergeworfen worden ist. Der filigrane Eindruck wird weiter durch die sogenannten merlature verstärkt (merletto bedeutet im Venezianischen „Spitze“), nämlich durch die an arabische Gestaltungsweise gemahnenden Zierzinnen (sie sind in moderner Rekonstruktion nach alten Abbildungen gefertigt). Die Architektur des Dogenpalastes ist ganz wesentlich auf die Ansicht vom Wasser her ausgerichtet.
Feinste Einzelheiten bereichern und beleben das Bauwerk. So sind die Kapitelle des Erdgeschosses eine kleine Welt für sich. Jedes von ihnen zeigt acht Darstellungen, z. B. von Tugenden und Lastern, der Stände, von antiken Kaisern und Philosophen, von Tieren und Pflanzen, von der Geschichte eines Paares vom Kennenlernen bis hin zum Tod des gemeinsamen Kindes usw., von Themen also, die auch an den Fassaden gotischer Kathedralen in Frankreich behandelt werden – „eine Enzyklopädie spätmittelalterlicher Frömmigkeit und Weltlust“ (Hubala). An den Ecken des Gebäudes finden sich plastische Werke: im Südosten die Verspottung des trunkenen Noah, darüber der Erzengel Raphael mit Tobias, im Südwesten der Sündenfall mit dem Erzengel Michael darüber, im Nordosten das Urteil Salomons und der Erzengel Gabriel. Die Mitte des Obergeschosses der Südfassade trägt das sogenannte Stenofenster, das 1404 entstand und benannt ist nach dessen Stifter, dem Dogen Michele Steno (1400–13). Es ist ein Werk der Brüder dalle Masegne, das nach dem Palastbrand von 1577 erneuert wurde. Es wird von Vittorias Statue der Justitia aus der gleichen Zeit bekrönt. An der Westfassade (zur Piazzetta hin) findet sich ein etwas einfacher gestaltetes Pendant zu diesem Fenster. Es wurde 1536 von Scarpagnino und Sansovino entworfen und zeigt den vor dem Markuslöwen knienden Dogen Andrea Gritti (1523–38) – ein Motiv, das in nächster Nähe noch dreimal vorkommt, nämlich an der Porta della Carta, am Arco Foscari und am Uhrturm (alles Nachbildungen, weil die Originale 1797 von Bilderstürmern zerstört wurden), und das die nachgeordnete Stellung des Dogen im Staate symbolisiert. Im westlichen Arkadengang fallen zwei Säulen aus rotem Veroneser Marmor auf. Allgemein wird überliefert, dass sie den Ort bezeichnen, an dem Todesurteile verkündet wurden. Eine andere Überlieferung weiß zu berichten, dass der jeweilige Doge von dieser Stelle aus der Vollstreckung der Todesurteile zwischen den beiden Säulen der Piazzetta beiwohnen musste.
Rechts der zum Molo hin gelegenen Südfassade spannt sich der Ponte di Paglia über den Rio del Palazzo, von ihr ist in starker Verkürzung die östliche Rückseite des Dogenpalastes zu überblicken. Es fällt immer recht schwer, sich diese insgesamt wenig systematisch gegliederte Renaissancefassade zu vergegenwärtigen, die in der Sockelzone der langgestreckten Diamantenwand zwei gewaltige Wassertore besitzt. Von der Brücke aus fällt der Blick auch auf den Ponte dei Sospiri (Seufzerbrücke), die den Palast mit dem gegenüberliegenden Palazzo dei Prigioni (Staatsgefängnis) verbindet und 1603 nach Plänen Antonio Contins errichtet wurde. Ob immer gemäß dem Symbol der Justitia, deren Figur dort zu sehen ist, gehandelt wurde, mag dahingestellt bleiben. Der Blick vom Ponte di Paglia aus in das gesamte Ensemble wirkt wie der in eine Schlucht und ist ein wenig unheimlich und beklemmend, da alles, was über die lautlose Willkür venezianischer Justiz und Staatsinquisition zu hören und zu lesen war, hier baulich verkörpert ist. Anzumerken bleibt, dass die berühmten Bleidächer, unter denen Casanova gefangen gehalten wurde, die des Dogenpalastes selbst und nicht die des benachbarten Gefängnisses, der Prigioni, sind.
Links der Westfassade, zwischen dem Palast und S. Marco, erhebt sich die sog. Porta della Carta (Papiertor), ein Name, der vermutlich von den hier früher angrenzenden Staatsarchiven abgeleitet wurde. Sie war früher reich vergoldet, weswegen sie auch Porta aurea genannt wurde. Entstanden ist sie 1438–42 unter Leitung von Giovanni Bon und dessen Sohn Bartolomeo, vermutlich waren aber auch Kräfte aus der Lombardei und der Toskana beteiligt. Polygonale Strebepfeiler flankieren eine mächtige hochrechteckige Tür mit darüber liegendem Großfenster. Über diesem halten drei schwebende Engel einen Tondo mit dem segnenden hl. Markus, ein Motiv, das auf die Spätantike zurückgeht. Auf den Rändern des Wimpergs turnen Putti und auf seiner Spitze thront Justitia. In den Nischen der Strebepfeiler stehen Personifikationen der Kardinaltugenden. Vor dem Fenster kniet (als Rekonstruktion) der Doge Francesco Foscari vor dem Markuslöwen. Stilistisch gehört die Porta della Carta dem sogenannten Übergangsstil zwischen Spätgotik und Frührenaissance an. Die unteren Tugendfiguren werden mit Antonio Bregno, dem Schöpfer des Foscari-Grabmals in der Frari-Kirche, in Verbindung gebracht. Die Porta della Carta korrespondiert mit der ihr zu Füßen des campanile gegenüberliegenden Loggetta. Sie führt in einen tunnelartigen Gang, den Porticato Foscari und weiter in den Hof des Dogenpalastes, den man durch den Arco Foscari betrat, um der Scala dei Giganti gegenüber zu stehen. Heute liegt hier der Ausgang aus dem Dogenpalast.
Innenhof: Der Eingang zum Dogenpalast bzw. zu seinem Innenhof liegt heute an dessen Südfront. Im Inneren des Hofes hat man rechts die Renaissancefassade des Ostflügels, links die gotische Fassade des Westflügels vor sich, die stilistisch der Fassade des Südflügels entspricht. Im Hintergrund erhebt sich die Seitenfront der Markuskirche. Davor steigt feierlich die Scala dei Giganti nach rechts zum ersten Geschoss des Palastes empor. In der linken Hälfte der weiten Fläche des Hofes stehen zwei wundervolle pozzi (Brunnenköpfe) aus Bronze, die Alfonso Alberghetti und Niccolò dei Conti 1554–59 gegossen haben. Die drei Palastfassaden nehmen in den beiden unteren Geschossen die große Gliederung der gotischen Außenfassaden mit zwei übereinander gestellten Loggien auf, sind aber in ihrer Ausführung weit schlichter. Auch die einhundert Meter lange Front des Ostflügels behält diese Gliederung bei, ist jedoch im oberen Abschnitt in der Formensprache der venezianischen Frührenaissance gestaltet. Dabei erscheint die Verteilung der Fenster in den beiden Obergeschossen der Ostfront unsystematisch und willkürlich, was sich durch die Anordnung der dahinterliegenden Räume erklärt, auf die Rücksicht genommen werden musste. Die Fassade trägt reichen ornamentalen Schmuck.
Ein Werk von großer historischer und kunstgeschichtlicher Bedeutung ist die zu der Ostfassade emporsteigende Prachttreppe, die Scala dei Giganti (Gigantentreppe), so genannt nach den beiden Großstatuen von Jacopo Sansovino am oberen Absatz, die Mars und Neptun darstellen und somit die Macht Venedigs zu Lande und auf dem Meere symbolisieren. Die Treppe selbst ist das Werk Antonio Rizzos von 1483, der auch die Pläne lieferte, nach denen die Fassade des Ostflügels entstand. 1485 fand auf dem oberen Podest der Treppe erstmals eine Dogenkrönung statt, woraus eine Tradition entstand, die bis zum Ende der Republik beibehalten wurde. Auf einem Vorgängerbau hat man allerdings 1355 den Dogen Marino Falier, der einen Staatsstreich plante, enthauptet. Es ist in jedem Falle lohnend, die feinen Details der Treppe zu betrachten, so die dekorative Ausgestaltung der gliedernden Pilaster und Gesimse und die Einlegearbeiten in den Setzstufen. Die Treppe grenzt links einen kleinen Bezirk vom Innenhof des Dogenpalastes ab, den sogenannten Cortile dei Senatori. Unter den dahinter gelegenen Arkaden wird die Originalstatue des hl. Theodor aufbewahrt, die früher auf der rechten Monumentalsäule der Piazzetta stand, auf der heute eine Kopie zu sehen ist.
Der Treppe gegenüber und an der Mündung des Porticato Foscari, des Ganges, der von der Piazzetta in den Hof des Dogenpalastes führt, steht mit reicher Architektur der sogenannte Arco Foscari, der 1462–71 unter dem Dogen Cristoforo Moro errichtet wurde. Neben dem großen Bogen des Untergeschosses stehen in Nischen Kopien der Figuren von Adam und Eva (die Originale befinden sich im Dogenpalast), die Antonio Rizzo ausgeführt hat. Eine Figurengruppe über der Tür im zweiten Stockwerk mit einer Darstellung des vor dem Markuslöwen knienden Dogen Moro (in Analogie zur Porta della Carta) wurde 1797 zerstört. Das mittlere Intervall der Architektur wird von Strebepfeilern flankiert, die in hohen, mit Statuen bekrönten Fialen auslaufen. Auf der Spitze der Bekrönung der Mittelachse steht die Figur des segnenden hl. Markus. Der gesamte Aufbau erinnert an den der Fassade von S. Marco, „der Dogentreppe sollte eine reduzierte Erinnerung an San Marco entgegengestellt werden ... Der Segen des hl. Markus gilt dem Dogen, ihm wird die Bindung weltlicher Macht an überirdische Maßstäbe vor Augen gestellt, er wird ermahnt, als Herrscher zu dienen, tugendhaft zu handeln und sich der Grenzen irdischer Menschennatur bewußt zu bleiben. Es umschließt also das Gegenüber von Scala dei Giganti und Arco Foscari die Quintessenz venezianischer Staatslehre.“ (Hubala).
Inneres: Zur Loggia des ersten Geschosses führt eine Treppe rechts unter den Arkaden des Ostflügels empor. Dort ist im ersten Stock rechts an der Wand eine sogenannte Bocca della verità zu sehen, ein in die Wand eingelassener Briefkasten, der hinter einer Löwenmaske liegt. Sie war Denunziationen vorbehalten, die entgegen weitverbreiteter Meinung nicht anonym waren – Anzeigen „ohne Unterschrift oder Nennung von mehreren Zeugen wurden folgenlos vernichtet, es sei denn, der Rat der Zehn erklärte mit einer überwältigenden Mehrheit von fünf Sechsteln, dass es sich um eine Staatsaffäre handle.“ (Wolters) Der Weg weiter nach oben führt über die Scala d’Oro (Goldene Treppe), benannt nach der vergoldeten Dekoration ihres Gewölbes, zu der Dogenwohnung im zweiten und zu den Prunkräumen im dritten Geschoss. Im ersten Abschnitt besitzt die Treppenanlage zwei Läufe, die sich am oberen Treppenansatz zu einem einzigen vereinigen. Der Entwurf der Anlage, der 1557–59 ausgeführt wurde, ist vermutlich ein Gemeinschaftsprodukt von Sanmicheli und Sansovino. Das System der Gewölbedekoration entwarf Alessandro Vittoria, während die Malerei, deren Programm bis heute nicht befriedigend interpretiert werden konnte, Battista Franco schuf. Laut örtlicher Beschriftung ist die Thematik der Bilder der ersten Treppenhausrampe Aphrodite gewidmet und spielt auf diese Weise auf die Eroberung Zyperns, der Geburtsinsel der Göttin, an. Die Malerei im rechten Aufgang zeigt Neptun und stellt somit die Herrschaft Venedigs über das Meer dar.
Die Treppe führt mit ihrem ersten Lauf zum zweiten Stockwerk, in dem die Dogenwohnung liegt.
Nicht alle Dogen waren mit der ihnen zugewiesenen Wohnung zufrieden. So wollte Agostino Barbarigo (1486–1501) sich einen eigenen, jenseits des Rio della Canonica gelegenen Dogenpalast errichten lassen. Auch Andrea Gritti (1523–38) hatte solche Pläne und hatte bereits einen Entwurf von Sansovino ausarbeiten lassen. Die zur Verfügung stehenden Räume reichten schließlich nicht mehr aus, so dass 1618 weitere Räumlichkeiten im Bereich der Canonica (heutiger Bischofspalast neben S. Marco) geschaffen wurden. „Alvise Mocenigo (1763–78) und seine Gemahlin hatten 19 Räume zu ihrer Verfügung, darunter die riesige Sala dei Banchetti – heute Teil des Museo di San Marco –, zwei Oratorien und eine Bibliothek“ (Wolters).
Man biegt am oberen Treppenabsatz im zweiten Stockwerk nach rechts ab und kommt über den Corridoio in die Sala degli Scarlatti, deren wunderschöner soffitto (Holzdecke) mit geschnitzter, vergoldeter Dekoration auf blauem Grund aus dem Jahr 1507 stammt. Den prachtvollen Marmorkamin schufen Antonio und Tullio Lombardo, das Relief über dem Eingang hat deren Vater Pietro gearbeitet. Seit Ende des Jahres 2006 ist hier ein kürzlich wiederentdecktes Gemälde Carpaccios ausgestellt, eine Madonna, die ihr Kind anbetet. Dem frisch restaurierten Bild ist noch anzusehen, in welch schlechtem Zustand es sich ursprünglich befand (insbesondere in den Hautpartien, die ganz pauschal wirken). An den Seitenwänden des Raumes hängen zwei freskierte Lünetten, darunter ein Werk Tizians, eine Madonna mit Kind und zwei Engeln. Die eigentlichen Dogengemächer liegen jenseits der querverlaufenden Sala dello Scudo und zu beiden Seiten des breiten, im rechten Winkel dazu angeordneten Korridors, der Sala dei Filosofi. Die Wohngemächer selbst sind heute weitgehend leer, besitzen aber zum Teil noch schöne soffitti und caminetti (Kamine). In der Sala Grimani wird zunächst hingewiesen auf die hölzerne, üppig vergoldete Decke. „Die Grundform der Motive erinnert an antike Fußböden, während die ausschmückenden Details dem antikisierenden Formenrepetoire der Schnitzer entstammen.“ (Wolters) An den Wänden hängen vier große Gemälde mit Darstellungen des Markuslöwen, darunter das berühmte Bild Carpaccios mit dem leone andante, der mit seinen vorderen Pranken auf der Erde, mit den hinteren auf dem Wasser steht und somit Venedigs Anspruch auf den Besitz sowohl des Landes als auch des Meeres versinnbildlicht.
Kurz vor dem letzten Raum links des Korridors, der Sala degli Stucchi mit schönen Wanddekorationen, führt eine kleine Treppe nach oben. Ersteigt man hier einige Stufen und dreht sich dann um, so hat man Tizians Hl. Christophorus vor sich. Dieses Fresko entstand 1523/24. Der Heilige ist als derbe Gestalt dargestellt, die kraftvoll durch die Lagune watet. „Die Pinselführung ist von herrlicher Freiheit und formbezeichnender Kraft“, schreibt Hubala. Links unten ist ein in venezianischem Stil gehaltener Turm dargestellt, während rechts von ihm die Kuppeln von S. Marco zu sehen sind. Die Berge ganz rechts im Bilde sind die Ausläufer der Alpen in der Gegend von Cadore, dem Geburtsort Tizians. Die Treppe war dem Dogen vorbehalten, der auf ihr schneller von seiner Wohnung zu den Repräsentationsräumen im darüber gelegenen Stockwerk gelangen konnte. In den drei Gemächern gegenüber ist eine kleine Pinakothek untergebracht. Erwähnt sei eine Pietà Giovanni Bellinis, bei der das offene Grab Christi als Altar dargestellt ist. Insgesamt sind die Dogengemächer in allen Details sehr edel gestaltet, durchaus auch mit einem gewissen Prunk, jedoch mit erstaunlicher Zurückhaltung – ganz sicher waren die privaten Paläste der Dogen üppiger ausgestattet.
Über den zweiten Lauf der Scala d’Oro gelangt man in das dritte Stockwerk des Palastes mit den Repräsentations- und Versammlungsräumen der Republik und betritt zunächst das Atrio quadrato, in dem sich der ursprüngliche, vergoldete soffitto erhalten hat, der unter dem Dogen Girolamo Priuli (1559–67) entstanden ist. Sein Dekorationssystem hat W. Wolters als „System kommunizierender Kassetten“ bezeichnet. Das achteckige Hauptbild stammt von Tintoretto (1561–64) und zeigt den Dogen in Gegenwart seines Namenspatrons Hieronymus vor der Venetia. Begleitet von Justitia, überreicht ihm diese das Zeremonienschwert. Interessant ist bei diesem Bild die Gruppierung der vier Figuren: Sie sind „abwechselnd in Untersicht (Justitia, Venetia), in Frontalsicht (Doge), in Draufsicht (Hieronymus) und in Anlehnung an das achteckige Format gegeben, so dass die Darstellung nicht nur von einem einzigen Betrachterstandpunkt aus lesbar ist und das Auge den räumlichen Zusammenhang aus den Wendungen der Figuren stillschweigend ergänzt.“ (Hubala)
Es folgt die Sala delle Quattro Porte, die sich quer über den ganzen Flügel erstreckt und ihren Namen von den vier aus wundervollen Steinen errichteten Prachtportalen erhalten hat. Die Anlage, für die Palladio die Pläne geliefert hat, entstand 1574–77. Die Deckengemälde entstammen überwiegend der Werkstatt Tintorettos. Unter dem Gewölbe der rechten Schmalseite des Raumes hängt eine Kopie von Tiepolos Gemälde Neptun bringt Venedig Schätze des Meeres dar, das Original steht am Boden auf einer Staffelei. Ein großes Gemälde rechts an der Wand, das den Dogen Antonio Grimani (1521–23) darstellt, wurde von Tizian begonnen und von Marco Vecellio vollendet. Von großem Interesse ist das gegenüberliegende Wandbild, auf dem der Empfang König Heinrichs III. von Frankreich in Venedig gezeigt wird (1574). Die darauf abgebildete Festarchitektur stammt von Palladio, der mehrere Triumphbögen entworfen hatte, die dann von Tintoretto und Veronese bemalt wurden. Das Bild kann einen Eindruck von dem Prunk vermitteln, den die Republik bei solchen Anlässen entfaltete.
Es lohnt sich, von einer solchen Festlichkeit etwas mehr zu hören, wobei allerdings festgestellt werden muss, dass die (zeitgenössischen) Berichte den Pomp bis ins Phantastische steigern. Der Besuch des erst 23-jährigen Königs hatte zwar keine besonderen positiven Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Venedig und Frankreich, doch hatte die Republik anscheinend hohe Erwartungen an ihn geknüpft. So wurde Heinrich „in die Stadt eingeholt mit einem von 400 Rudersklaven fortbewegten Schiff, das von einer Eskorte von vierzehn Galeeren begleitet war. Während diese Flotte über die Lagune fuhr, bliesen Glasbläser auf einem Begleitfloß zur Belustigung des Königs alle möglichen Figuren; ihr Ofen war ein gigantisches Seeungeheuer, das Flammen aus Backen und Nase spie. Diesem Geleitzug fuhr eine zweite Armada entgegen, die aus seltsam dekorierten, phantastisch oder symbolisch aufgemachten Schiffen bestand und mit Delphinen und Meeresgöttern verziert oder üppig mit Tuchwerk behangen war. In Venedig war der am Canal Grande gelegene, „Ca’ Foscari“ genannte Palazzo eigens für den Besucher hergerichtet worden. Man hatte ihn verschönert mit golddurchwirktem Tuch, Teppichen aus dem Osten, seltenem Marmor, Seidenstoffen, Samt und Porphyr. … Die Bilder, speziell für diese Gelegenheit erworben oder in Auftrag gegeben, stammten von Giovanni Bellini, Tizian, Paris Bordone, Tintoretto und Veronese. Für das Hauptbankett im riesigen Großen Ratssaal des Dogenpalastes wurden die in der Stadt geltenden Gesetze gegen übermäßigen Aufwand vorübergehend aufgehoben, und die schönsten Frauen Venedigs erschienen alle in blendendem Weiß, ‚geschmückt‘, wie uns ein Historiker berichtet, ‚mit Juwelen und Perlen von erstaunlicher Größe, nicht nur an Schnüren um den Hals, sondern auch die Haartracht bedeckend und die Umhänge auf ihren Schultern‘. Auf der Speisekarte waren 1200 Gerichte verzeichnet, die 3.000 Gäste aßen alle von silbernem Geschirr, und die Tafeln waren mit Figuren aus Zucker dekoriert, die Päpste, Dogen, Götter, Tugenden, Tiere und Bäume darstellten, allesamt entworfen von einem berühmten Architekten und hergestellt von einem talentierten Apotheker. … Als das Mahl dem Ende entgegenging, wurden dreihundert verschiedene Sorten von Bonbons verteilt, und nach dem Essen erlebte der König die erste Oper, die je in Italien und damit auf der Welt aufgeführt wurde. Als er schließlich in die Nacht hinausschritt, entdeckte er, dass eine Galeere, die man ihm vorher in Einzelteile zerlegt gezeigt hatte, während des Banketts draußen am Kai zusammengesetzt worden war. Als er den Palast verließ, wurde sie, fix und fertig, in die Lagune hinaus vom Stapel gelassen ...“ (Morris) Heinrich sei laut einigen Berichten nach diesem Erlebnis nie mehr ganz zu sich gekommen und lebte den Rest seines Lebens im Zustand ständiger Benommenheit dahin. Weiterhin wird überliefert, dass er geäußert haben soll, wenn er nicht König von Frankreich wäre, so wollte er am liebsten Bürger von Venedig sein. Zu dieser Äußerung mag vielleicht auch ein diskret behandelter Besuch bei Veronika Franco, der damals berühmtesten Kurtisane der Stadt, beigetragen haben – für Heinrich, wie berichtet wird, nicht nur der Höhepunkt seines Aufenthaltes in der Stadt, sondern sogar der seines Lebens.
In der Raumflucht folgt nun das Anticollegio, also das Vorzimmer zum Collegio, zum Staatsrat. Das wundervolle Ensemble erhielt seine heutige Form und Ausstattung erst im Jahre 1713, damals kamen Gemälde Tintorettos, Veroneses und Bassanos hierher. Es wurde in Anbetracht der Tatsache, dass der Raum als Wartezone für hochgestellte Gäste der Republik diente, besonders kostbar ausgestattet. Die vier beinahe quadratischen Gemälde über den Türen stammen von Tintoretto und entstanden in den Jahren 1577/78. Ihre Themen sind: Minerva trennt Krieg und Frieden, Vulkan schmiedet mit Hilfe des Kyklopen Waffen, Die drei Grazien und Merkur und Bacchus bietet Ariadne den Hochzeitsring an. Letzteres bezeichnet Hubala als das schönste Werk des Meisters überhaupt: „ein honiggelbes Schimmern fasst die lautlose, wie verzauberte Szene zusammen, in der sich die Figuren von herrlicher Freiheit der Leiber und hohem Adel des seelischen Ausdrucks wie Meereswesen zu bewegen scheinen.“ An der Wand hängt der Raub Europas von Veronese, ein Bild, das mit reicher, ja üppiger Farbigkeit gestaltet ist und ein wenig auf französische Rokoko-Idyllen vorausdeutet. Daneben sei noch auf Bassanos in erdigen Farben gehaltenes Gemälde Jakobs Rückkehr von Kanaan hingewiesen. Aufmerksamkeit verdient ebenso die übrige, sehr würdevolle Ausstattung des Raumes mit üppiger Stuckdekoration, dem Kamin sowie dem Portal zum Collegio, das aus dunklen Steinen zusammengefügt ist und einen gesprengten Dreiecksgiebel besitzt. Auf ihm stehen von Vittoria geschaffene Figuren: In der Mitte sitzt Venezia auf einem Löwenthron und wird von den allegorischen Darstellungen von Eintracht und Ruhm flankiert, die deutlich ihre Herkunft von Michelangelos Medici-Gräbern in der Neuen Sakristei von San Lorenzo in Florenz zeigen.
Der folgende Raum, die Sala del Collegio, war seit 1574 der Versammlungs- und Tagungsort der Serenissima Signoria, des Staatsrates, der sich aus dem Dogen selbst, sechs Ministern (den Savi – weise Ratgeber mit verschiedenen Aufgabenbereichen), den höchsten Richtern und dem Großkanzler (dem cancelliere grande, der die Staatskanzlei leitete) zusammensetzte. Die Versammlung dieser Männer muss auf den Eintretenden großen Eindruck gemacht haben, zumal die noch heute herrschende Pracht durch Verkleidungen der Rückenlehnen mit kostbaren Teppichen zusätzlich verstärkt war. Die Ausstattung des Saales ist ausgewogen und edel bis ins kleinste Detail. Ein reich geschnitzter und vergoldeter Soffitto überspannt den Raum. In diesen soffitto sind elf Gemälde Veroneses mit allegorischen Darstellungen von Tugenden eingelassen, bei deren genauerer Betrachtung man erstaunt die Virtuosität erkennt, mit der der Maler seine Kompositionen in die zum Teil überaus schwierigen Bildformate eingepasst hat. In den drei Mittelbildern werden staatstragende Themen symbolisch dargestellt. So wird über dem Dogenthron mit Venetia zwischen Justitia und Pax das Sinnbild der Herrschaft Venedigs gezeigt, der Christliche Glaube im Mittelbild bildet das Fundament des Staates, Mars und Neptun symbolisieren schließlich im dritten Bild die Macht Venedigs zu Lande und zu Wasser. An der Wand hinter dem Dogenthron findet sich Veroneses Gemälde des Dogen Sebastiano Venier, des Siegers in der Seeschlacht von Lepanto. An der gegenüberliegenden Wand ist Tintorettos Darstellung des Dogen Andrea Gritti zu sehen, der vor der Madonna und Heiligen kniet. Die drei großen Dogen-Votivbilder an der Längsseite des Saales stammen überwiegend aus der Werkstatt Tintorettos.
Durch eine Tür gegenüber der Fensterwand gelangt man in die unmittelbar angrenzende Sala del Senato. Wirkt das Collegio fast intim, so ist dieser Saal, der weit mehr Teilnehmern Platz bieten musste, nämlich den Mitgliedern des Collegios und den Senatoren und somit mehr als 300 Personen, sehr weitläufig, von hoher Feierlichkeit und einer solchen Versammlung von Männern, die in rote Roben gekleidet waren, würdig. Auch dieser Raum ist auf das Feinste ausgestattet, wobei der herrliche soffitto wohl der schönste des Palastes ist. In den Gemälden der Decke lässt sich Venedig – wie im Collegio – selbst darstellen. Das Mittelbild stammt von Tintoretto und seinem Sohn Domenico. Wiederum bedecken Dogen-Votivbilder die Wände.
Der weitere Weg führt erneut durch die Sala delle Quattro Porte, von der über einen L-förmigen Gang die Sala del Consiglio dei Dieci erreicht wird. Über diesen Rat der Zehn, aus heutiger Sicht eine Art Verfassungsschutz und -gericht, existieren viele und oft genug gruselige Geschichten, was dessen Amtsführung, Willkür und Geheimniskrämerei betrifft – Geschichten, die zumeist nicht oder nur teilweise zutreffen. Im Raum fällt eine Rundung auf, die an die Apsis einer Basilika der römischen Kaiserzeit erinnert, vermutlich eine gewollte Allusion. Die sala mit ihrer Ausstattung aus dem Jahre 1553 hat den Brand des Jahres 1574 weitgehend unbeschadet überstanden. Durch die frühere Entstehungszeit ist ihr Stil deutlich strenger als in den vorangegangenen Sälen, was ohne weiteres am soffitto und an dessen einfachem Kassettensystem zu erkennen ist. Die ornamenierten Bilderrahmen fassen drei Gemälde Veroneses, der durch sie im Alter von 25 Jahren in Venedig berühmt wurde (und mit der Ausgestaltung der Kirche San Sebastiano einen Anschlussauftrag erhielt). Das Original des Mittelbildes Jupiter schleudert Blitze gegen die Laster wurde 1797 nach Paris verschleppt und befindet sich bis heute im Louvre. Das rechteckige Bild links Juno übermittelt Venezia die Dogenmütze, den Cornu Ducale, und ein kleines Oval mit der Darstellung eines alten Orientalen sind dagegen Originalwerke Veroneses. An den Wänden hängen drei Historienbilder: an der Stirnseite Anbetung der hl. Drei Könige von Antonio Vassilachi, genannt Aliense (ca. 1600), rechts segnet Papst Alexander III. den Dogen Sebastiano Ziani (von Leandro und Francesco Bassano 1592), links sind Venedigs Gesandte vor Papst Clemens VII. und Kaiser Karl V. in Bologna zu sehen (von Marco Vecellio 1604).
Die folgende Sala della Bussola hat ihren Namen von dem dreiseitigen hölzernen Einbau in der rechten Ecke (bussola bedeutet u. a. Windfang und Drehtüre). Durch ihn betrat man das Beratungszimmer der drei monatlich wechselnden Vorsteher der Zehn, die Sala dei tre Capi, die nicht zugänglich ist. Die Sala della Bussola diente als Warteraum für die vom Consiglio dei Dieci (später von der Inquisition) Vorgeladenen. Den schönen Marmorkamin soll Sansovino entworfen haben. Im Weitergehen durchquert man die Sala d’Armi, in der eine reichhaltige Waffensammlung gezeigt wird.
Die vorgegebene Führungslinie führt über die Scala dei Censori in den zweiten Stock und links der Mündung dieser Treppe in den breiten, fensterlosen Andito del Maggior Consiglio. An den schließt sich im rechten Winkel nach links der Liagò an, der durch zwei große Fenster einen freien Blick auf den molo bietet. Hier werden die Originale von Rizzos Adam und Eva vom Arco Foscari und der ebenfalls von dort stammende Schildknappe aufbewahrt. Rizzo, der von 1430 bis 1499 lebte und eigentlich Antonio Bregno hieß, war aus Verona gebürtig und einer der wenigen wirklich schöpferisch tätigen Bildhauer der Stadt. Die im Liagò gezeigten Figuren sind seine wichtigsten Werke. Schon zur Zeit ihrer Entstehung wurden sie in Gedichten gefeiert und müssen damals von den Venezianern als revolutionär empfunden worden sein. Albrecht Dürer hat sie gezeichnet und eingehend studiert. Obwohl sie Nischenstatuen sind, hat Rizzo sie als Freifiguren gearbeitet. Eva bedeckt ihre Blöße mit der Hand, eine Geste, die aus der Formensprache der Antike stammt. Adam, dessen Gestalt vom mittelalterlichen Typus des Johannes unter dem Kreuz abgeleitet ist, blickt nach oben (am ursprünglichen Platz war sein Blick hinauf zur Statue des hl. Markus auf der Spitze des Arco Foscari gerichtet). Während Eva weiche, fließende, fast üppige Formen zeigt, ist die Figur von Adam hart, kantig und scharf gegliedert. Die beiden Werke gehören dem sogenannten Übergangsstil zwischen Spätgotik und Renaissance an und werden vor 1471 datiert.
Vom Vorraum zum großen Ratssaal geht die linke Tür zur Sala della Quarantia Civile Vecchia, in der sich früher die vierzig Richter des Zivilgerichtes versammelten. Der Saal birgt Gemälde des 17. Jahrhunderts. In der benachbarten Sala del Guariento finden sich die Reste des Monumentalgemäldes, das der Paduaner Maler Guariento in den Jahren 1365–67 für die östliche Wand des Großen Ratssaals geschaffen hat. Als es beim Palastbrand von 1577 stark beschädigt wurde, bekam Tintoretto den Auftrag, als Ersatz sein Paradies zu malen. Guarientos Wandgemälde blieb lange Zeit verdeckt, bis es 1903 abgelöst und wieder zugänglich gemacht wurde. Es zeigt eine für das Trecento typische figurenreiche Komposition mit der Krönung Mariens.
Die nun folgende Sala del Maggior Consiglio betritt man von deren Stirnseite aus. Der „Große Rat“ war das oberste Regierungsorgan Venedigs, so dass dieser Saal eine besondere Bedeutung besaß. Hier versammelten sich die nobili, die als einzige stimmberechtigt waren, regelmäßig an den Sonntagvormittagen.
Voraussetzung für die Zugehörigkeit zum Großen Rat war die Eintragung in das sogenannte „Goldene Buch“ der Stadt, ein Verzeichnis aller nobili. Im Jahre 1297 hat die Republik mit dem Eintrag in dieses Buch definitiv entschieden, welche Bürger Venedigs sich zum Adel zählen durften. Die folgende Schließung des Buches wurde in der venezianischen Geschichte als serrata bezeichnet. Belanglos für die Eintragung in das Goldene Buch waren die Vermögensverhältnisse des Einzelnen, ausschlaggebend war einzig die Abstammung. Es gab genügend arme Adelige, die als sogenannte barnabotti von der Republik in der Nähe der Kirche des hl. Barnabà alimentiert und oft genug zu einem erheblichen Unruheherd im Staate wurden. Umgekehrt war es reichen Nichtadeligen nur in relativ seltenen Ausnahmefällen möglich, sich in den Adel einzukaufen und ins Goldene Buch eingetragen zu werden, und wenn, dann für den exorbitanten Preis von 150.000 Dukaten. Die Mitglieder des Großen Rates mussten außerdem mindestens fünfundzwanzig Jahre alt sein. An den Sitzungen nahmen bis zu 1.800 Personen teil. Beschlussfähigkeit war erst ab mindestens 600 teilnehmenden Personen gegeben.
Der große Ratssaal hat Ausmaße von 54 x 25 x 15,40 Meter. Beim Betreten dieses riesigen Raumes entsteht förmlich das Gefühl eines Eintauchens, das sich auch bei späteren Besuchen immer wieder mit gleicher Intensität einstellt. Er ist ein schlichtes Gebilde auf rechteckigem Grundriss, das von einer freitragenden Decke überfangen wird. Deren Konstruktion führten die Schiffsbauer des Arsenals in drei Jahren aus, sie ist im Rahmen der Führung itinerari segreti zu besichtigen und lässt das handwerkliche Können der Epoche ahnen. Weiches Licht, das durch die großen Fenster fällt, erfüllt den Raum. Früher war er nicht so leer, wie er sich heute zeigt, sondern besaß ein in Reihen angeordnetes Gestühl, wie es z. B. Canaletto dokumentiert hat. Einen Vorgängerbau aus dem 14. Jahrhundert hatten die größten Maler mit ihren Gemälden ausgestattet. So gab es Werke von Bellini, Gentile da Fabriano, Pisanello, Vivarini, Carpaccio, später kamen Bilder Tizians, Tintorettos und Veroneses dazu. Das alles ging beim Palastbrand 1577 verloren (mit Ausnahme der Reste der Marienkrönung Guarientos, die nur deshalb nicht völlig zerstört wurde, weil sie al fresco gemalt war), aber die Wiederherstellung des Raumes wurde umgehend angeordnet. Tizian war zu diesem Zeitpunkt bereits tot, doch konnten noch Tintoretto, Veronese und Palma il Giovane beauftragt werden.
Entscheidend für die Wirkung des Raumes ist der herrliche Soffitto, die Holzdecke. Diese riesige Fläche ist in drei große Zonen gegliedert, die wiederum von den seitlichen Gruppen der Trabantenbilder begleitet werden. Eine kraftvolle, großzügige Rahmung verbindet die Bilder und fasst sie wiederum zu einem Ganzen zusammen. An den Wänden hängen über einem niedrigen hölzernen Dorsale Bilder, die Ereignisse aus der Geschichte Venedigs erzählen. Die Stirnseite des Raumes nimmt das riesige Paradies Tintorettos ein. Eine Besonderheit stellen die Dogenbildnisse dar, die paarweise unterhalb der Decke angeordnet sind – gezeigt werden die Dogen, die von 804–1556 regiert haben. Unter dem Paradies erhebt sich auf einem Stufenpodest das Gestühl für die Serenissima Signoria, in dessen Mitte ein siebenteiliges Dorsale mit dem Dogenthron steht, der nur durch einen schlichten Dreiecksgiebel hervorgehoben ist. Bedeutendstes Werk des soffitto ist das ovale Mittelbild über dem Dogenthron, Veroneses Triumph Venedigs. Der Maler hat das Geschehen in zwei Ebenen angeordnet. Die untere Hälfte des Gemäldes wird von einem Gedränge von Schaulustigen angefüllt. Eine Balustrade grenzt den oberen Teil ab, wo Venezia, von Personifikationen von Tugenden umgeben, auf ihrem Thron vor einer triumphbogenartigen Loggia schwebt und aus der Hand eines Engels eine Krone empfängt. Das Kompositionsschema Veroneses mit der Zweiteilung der Bildfläche hat der jüngere Palma im anderen ovalen Hauptbild übernommen und darauf die Huldigung der Provinzen an Venedig dargestellt, es bleibt aber in der Qualität der Komposition, in der deutlich stumpferen Farbgebung und auch an Ausdruckskraft hinter Veronese zurück. Auf dem riesigen rechteckigen Mittelbild, das sicher überwiegend von Händen aus Tintorettos Werkstatt stammt, ist dargestellt, wie Venezia dem Dogen Nicolò da Ponte (1578–85) einen Ölzweig überreicht.
Unterhalb der Decke umläuft den Saal der bereits genannte Fries mit sehr differenziert gemalten Dogenbildnissen. An einer Stelle überdeckt ein schwarzes Tuch ein Portrait des Dogen Marino Falier. Es trägt die Aufschrift „Hic est locus Marini Faletri decapitati pro criminibus – hier ist der Platz des Marino Fallier, enthauptet für seine Verbrechen“ – ein spätmittelalterliches Beispiel einer damnatio memoriae, einer Bestrafung über den Tod hinaus durch Auslöschen seines Andenkens. Marino Falier machte 1355 den Versuch, eine Monarchie zu installieren und wurde wegen dieses Hochverrates nach kurzem Prozess hingerichtet.
Eine Reihe großformatiger Wandbilder feiert außenpolitische und militärische Triumphe der Republik. An der Nordwand (rechts des Dogenthrons) wird die Rolle der Venezianer in der Geschichte der Versöhnung zwischen Papst Alexander III. und Kaiser Friedrich Barbarossa 1177 geschildert. An der südlich gelegenen Fensterwand sind Bilder mit den Ereignissen des Vierten Kreuzzuges bei der Eroberung Konstantinopels zu sehen. Natürlich bediente man sich hier tendenziöser Darstellungsweisen und auch der Wiedergabe von legendären Ausschmückungen. Die Bilder können jedoch einen guten Einblick geben in die damals üblichen Zeremonien einerseits und in das Kriegshandwerk (Seeschlachten) andererseits.
Die Ausschreibung für ein Gemälde über dem Dogenthron gewannen zunächst Veronese und Bassano, deren Entwurf aus den Jahren 1578–82 vorsah, dass Veronese die zentralen Partien, Bassano den Rest ausführen sollte. Möglicherweise war die Teilung der Aufgaben der Grund, warum der Entwurf nicht realisiert wurde. Veronese starb 1588, weshalb nun der damals 70-jährige Tintoretto, der zwei Entwürfe vorgelegt hatte, die Aufgabe übernahm. Ein Entwurf hat sich im Louvre erhalten und gilt als die bessere Lösung als die, die dann verwirklicht wurde. Mit Ausmaßen von 7 x 22 Metern handelt es sich um das größte Ölgemälde der Welt. Es wurde auf einzelne Leinwände gemalt (in der >Scuola della Misericordia) und dann an Ort und Stelle zusammengesetzt. Sicher hat man das Werk immer bewundert, jedoch nie uneingeschränkt, und auch deutliche Kritik wurde laut. So meinte Grillparzer, dass es „von Figuren wimmelt, die kaum ein Ganzes ausmachen.“ Und Marc Twain berichtet, bei seinem ersten Venedigbesuch habe ihm ein Fremdenführer erzählt, es sei auf dem Gemälde ein Aufstand im Himmel dargestellt! – Im Gegensatz z. B. zu den Fresken Michelangelos in Rom ist das Bild offenbar deutlich nachgedunkelt, und deshalb dominieren heute dunkle Farbtöne wie Schwarz, Dunkelblau und Braun, was die Beurteilung erschwert. Es sind zahllose Figuren dargestellt, die segmentförmig in drei Zonen (außen die Seligen, in der Mitte die Heiligen, innen die Engel) das Zentrum umgeben, in dem Maria vor dem lichtumflossen thronenden Christus kniet. Das Bild enthält eine eindeutige Botschaft: „In einer absoluten Behauptung der Größe, der Macht und der Gottesfürchtigkeit einer der dauerhaftesten Republiken der Geschichte, werden alle wichtigen Entscheidungen des Staates unter der Schirmherrschaft von Christus und der Jungfrau Maria mit der Inspiration der himmlischen Heerscharen gefällt.“ (Fortini Brown)
Rechts hinten betritt man die Sala della Quarantia Civile Nuova (Gerichtshof, der für die terraferma, die Besitzungen auf dem Festland, zuständig war). Die Gemälde dieses Raumes beziehen sich thematisch auf das Richteramt.
Hinter dieser Sala öffnet sich ein weiterer Riesenraum, die Sala dello Scrutinio, die unter dem Dogen Francesco Foscari (1423–38) erbaut wurde und deren ursprünglicher Zweck unbekannt ist. Lange Zeit (bis 1553) barg er die von Kardinal Bessarion gestiftete Bibliothek, bevor die libreria Sansovinos fertiggestellt war. Später tagten hier die Ausschüsse des Großen Rates, besonders die Wahlkommissionen (z. B. die für die Wahl des Dogen) – scrutinio bedeutet im Venezianischen „Abstimmung“. Ein enger funktioneller Zusammenhang zwischen diesem Saal und der Sala del Maggior Consiglio kann somit angenommen werden, wofür auch die Ähnlichkeit der Ausstattung der beiden Räume spricht. Dominierend ist auch hier der soffitto, wobei die Rahmung der längsrechteckigen und querovalen Gemälde noch üppiger, „barocker“, ist. Dagegen steht die Qualität der Bilder hinter denen in der Sala del Maggior Consiglio zurück. Hingewiesen sei lediglich auf Die Einnahme Paduas 1405 von F. Bassano, ein Queroval im soffitto über der Eingangswand. Unterhalb der Decke wird die Galerie der Dogenportraits fortgesetzt. An den Wänden hängen weitere Historienbilder, unter ihnen eine riesige Darstellung der Seeschlacht von Lepanto 1571 von A. Vicentino und an der gleichen Wand gleich neben dem Eingang die Einnahme von Zara 1346 von J. Tintoretto mit höchst eindrucksvoller Komposition und dichter Darstellung des Kampfgeschehens. An der Schmalseite über dem Tribunal ist das Jüngste Gericht des jüngeren Palma zu sehen, der im Wettbewerb um den Platz im vorangehenden Saal, den heute das Paradies Tintorettos einnimmt, unterlegen war. In der Bildkomposition lehnt sich Palma deutlich an Tintoretto an. Früher, so heißt es, sei hier einmal ein Gemälde Tintorettos mit gleichem Thema zu sehen gewesen, das 1577 jedoch verbrannt sei.
Zu der Entstehung dieses verlorenen Gemäldes gibt es eine kleine Geschichte. Tintoretto habe nämlich eines Tages, als er an dem Bild mit der für ihn typischen Schnelligkeit arbeitete, Besuch von einigen Senatoren und anderen Würdenträgern bekommen, die ihm eine Zeitlang bei der Arbeit zuschauten. Sie meinten schließlich, dass andere Maler wie zum Beispiel Bellini bedächtiger und akkurater in ihrer Maltechnik gewesen seien. „Das mag durchaus sein“, soll Tintoretto geantwortet haben, „aber diese anderen Künstler hatten auch keine solchen lästigen Typen zwischen den Beinen gehabt, wie ich jetzt.“ So habe er gesprochen und dann noch schneller weitergemalt als zuvor.
An der gegenüberliegenden (westlichen) Schmalseite findet sich ein eigenartiges Monument, ein Triumphbogen, den der Senat für Francesco Morosini, den Peloponnesiaco, als Dank für die Wiedergewinnung der Peloponnes 1694 errichten ließ (möglicherweise nach Plänen von A. Tirali). Das Auftauchen eines persönlichen Ehrenmonuments im Dogenpalast ist etwas Einzigartiges. Bis dahin stand die einzelne Persönlichkeit nie im Zentrum von Darstellungen, sondern hatte nur dienenden Charakter vor San Marco, seinem Löwen oder vor Venezia, also vor den Symbolen der Republik.
Man kehrt durch die Sala del Maggior Consiglio zurück, passiert den Raum für die Quarantia criminale (Gerichtshof für Strafprozesse) und erreicht anschließend den Corridoio, eine breite Galerie, die sich nach links zum Innenhof des Palastes öffnet. An ihm sind zwei Räume gelegen, in denen eine kleine Galerie mit Gemälden des Niederländers Hieronymus Bosch (ca. 1450–1516) eingerichtet ist. Diese Bilder stellen für den Venedigbesucher eine ziemliche Überraschung dar, da keine Verbindungen mit der venezianischen Kunst erkennbar sind. „Alle Bilder zeigen die für H. Bosch charakteristische Verbindung von genauer Naturbeobachtung auf der einen Seite mit einer ins Surreale hinüberspielenden Traumhaftigkeit auf der anderen Seite.“ (Th. Droste).
Die offizielle Führungslinie weist über einen längeren schmalen Gang zur Seufzerbrücke und von dort in die Prigioni und anschließend wieder auf den Korridor, in dessen rechter Ecke eine Treppe in den kleinen Hof neben der Gigantentreppe führt, in den Cortile dei Senatori. Von dort verlässt man den Dogenpalast durch den Arco Foscari, um durch die Porta della Carta auf die Piazzetta zu gelangen.
Erwähnt sei noch, dass heute im Erdgeschoss des Süd- und Westflügels, im Museo dell’Opera, diejenigen Originale der Architekturteile des Dogenpalastes untergebracht sind, die 1876 abgenommen und durch Kopien ersetzt wurden, so z. B. zahlreiche Säulen und Kapitelle.
► Der Glockenturm
Der Porta della Carta, dem früheren Zugang zum Dogenpalast unmittelbar gegenüber ragt der Campanile in den Himmel, der mit 95 Metern höchste Kirchturm der Stadt. „Freistehend wie die meisten Glockentürme der Stadt und wie diese der Kirche und dem Platz gemeinsam dienend, ist der Campanile der ‚Herr des Hauses‘ („el paròn de caxa“), wie ihn die Venezianer treffend bezeichnen, Wahrzeichen der Stadt und Symbol des Gemeinsamen schlechthin. Er verkörperte für die Venezianer nicht nur den Ort des Wohnens als Heimat, sondern auch den Blick auf die Weite des Meeres und stellt die Richtung allen Strebens, das sich irdischer Grenzen bewusst bleibt, nach oben nämlich, unerschütterlich fest.“ (Hubala).
Geschichte: Der Legende nach wurde mit seiner Errichtung 912 begonnen, und zwar am Sankt Markus-Tag, dem 25. April. Erste Fundamente stammen schon aus dem 9. Jahrhundert, über denen sich ein mächtiger Ziegelbau erhob. Dieser wurde im 12. Jahrhundert erhöht, erhielt 1156–72 ein erstes Klangarkadengeschoss und im 15. Jahrhundert ein weiteres. Nach 1500 kam der Pyramidenhelm dazu. Bekrönt wurde das Ganze 1517 mit der drei Meter hohen, mit Goldblech verkleideten Holzfigur des Erzengels Gabriels, die sich frei im Winde dreht. Während der Kriege gegen die Genuesen im 14. Jahrhundert waren fünf Kanonen in der Glockenstube aufgestellt. Gleich nach der Vollendung des Bauwerks hatte man die Turmspitze mit vergoldetem Messing überzogen. Das war zwar recht praktisch für die Schifffahrt, die sich bis weit aufs Meer hinaus an diesem Leuchtzeichen orientieren konnte, doch schlug der Blitz so häufig ein, dass das Blech schließlich durch eine Außenfläche aus farbigen Steinen ersetzt werden musste. Dadurch wurden die Blitzeinschläge zwar seltener, führten aber auch weiterhin zu erheblichen Schäden. So wurde im Jahre 1745 die Engelsstatue getroffen, so dass sie auf die Buden stürzte, die den campanile an dessen Fuß umgaben. Im Jahre 1776 wurde erstmals ein Blitzableiter angebracht, der conduttore elettrico. Bis 1537 stand der Glockenturm im Verbund mit dem Vorgängerbau der heutigen Neuen Procuratien. Erst als Sansovino anfing, die Libreria zu errichten, hat er die südliche Front der Piazza zurückgenommen und dadurch den Turm freigestellt.
Die mehrfachen Erhöhungen des Turms hatten wohl dessen Statik ungünstig beeinflusst, außerdem hatte man irgendwann einmal Bauteile im Inneren des unteren Turmabschnittes beseitigt. All das führte letztlich dazu, dass der Turm am 14. Juli 1902 einstürzte. Die Statue des Erzengels Gabriel rollte vor das Hauptportal der Basilika „come portato da una forza superiore“, was als gutes Omen dafür angesehen wurde, dass der Kirche selbst nichts geschehen werde. Als einzige der Glocken blieb die Marangona erhalten. Von ihr erzählt man sich, dass sie aus Metall von höchster Qualität gegossen worden war und dass sie mit Sicherheit eine der ältesten Glocken auf dieser Erde sei. 1204 sei sie aus Konstantinopel nach Venedig gebracht worden, und schon die zeitgenössischen Dokumente sprechen von einem uralten Instrument, dessen Guss auf das 4. bis 6. Jahrhundert zurückgehen könne. Sie läutet jetzt um 12 Uhr und – als einzige der Stadt – um 24 Uhr.
Marangon ist die venezianische Bezeichnung für falegname, was „Zimmermann, Schreiner“ bedeutet. Aus den Trümmern des Campanile wurden auch sechs Hemden geborgen, die am Tag vor dem Einsturz noch gebügelt worden waren und sich in einem so gut wie unberührten Zustand befanden. Diese Hemden wurden beim Festbankett anlässlich der Einweihung des neuen Turmes (am 25. April 1912, auf den Tag genau tausend Jahre nach der ersten Grundsteinlegung) von sechs Gästen getragen. Außerdem hatte ein alter Mann eine wunderschöne Schale aus Muranoglas aus den Trümmern gezogen und aufbewahrt, die völlig unbeschädigt geblieben war. Am Tag der Einweihung durfte er die Schale mit einem köstlichen Wein füllen und dann den Inhalt des Glases auf die Erde gießen, somit einen Ritus vollziehen, der an Opferszenen der Antike erinnert. Das Glas wird heute im Museo Vetrario auf Murano aufbewahrt und gilt als ein kostbares Symbol für die unsterbliche Seele Venedigs.
Nach dem crollo, dem Einsturz, beschloss der Magistrat der Stadt umgehend die Rekonstruktion des Turms: „com’era dov’era – wie er war und wo er war“ sollte er wieder errichtet werden. Schon im Jahre 1885 hatte der Ausgräber des Forum Romanum, Giacomo Boni, das Fundament des Turms untersucht und dabei festgestellt, dass es noch völlig intakt war. Überraschend war damals, dass das Fundament „nicht tiefer als etwa 28 Fuß war“ (Varè), also bei einer Turmhöhe von 320 Fuß nur etwas mehr als neun Meter. „Er entdeckte sieben Lagen Steine, auf die das folgte, was er ein ‚zatterone‘ aus Holz nannte, eine Art Floß, und schließlich Pfeiler wie bei einem vorgeschichtlichen Pfahlbau, ... wohingegen die lokale Legende davon sprach, dass das Fundament viel tiefer hinunterreichte und sich dann unter dem Pflaster der Piazza nach allen Seiten wie ein Stern ausbreitete.“
Der campanile wurde zwar „wo er war“ wieder aufgebaut, zum Teil wurde auch das alte Material wieder verwendet. Jedoch wurde die Form des Turmes etwas verändert, sie wurde kompakter und massiger, was sich ohne weiteres bei einem Vergleich mit Darstellungen auf älteren Gemälden erkennen lässt.
Exakt, wie die Venezianer sind, haben sie über Gewichte und verwendete Materialien genau Buch geführt. So beträgt das Gewicht des Turmes 8.900 Tonnen ohne, 12.970 Tonnen mit Fundament. Verwendet wurden 1.530 Kubikmeter istrischer Kalkstein neben den alten Blöcken, 1.204.000 Ziegelsteine, 11.860 Doppelzentner Zement, 39,38 Tonnen Metall für die Armierung des Stahlbetons, 6,23 Tonnen Eisen für die Glockenstube und die Aufhängung der Glocken und 4,5 Tonnen Kupfer für das Dach.
Trotzdem schwingt sich der massive Mauerbau mit erstaunlicher Leichtigkeit empor. Seine Wandflächen sind nur durch lange Lisenen gegliedert und durch vereinzelte weiß gefasste Fensterchen unterbrochen. Dieser Eindruck der Leichtigkeit wird durch das blendende Weiß der Glockenstube verstärkt, über der sich der Helm förmlich im Licht des Himmels auflöst, so dass der Erzengel Gabriel auf der Turmspitze zu schweben scheint. Der Ausblick von der Glockenstube über Stadt und Lagune auf die Adria auf der einen, bis hin zu den Dolomiten, die bei gutem Wetter deutlich zu sehen sind, auf der anderen Seite, gehört zu den stärksten Eindrücken, die die Stadt vermitteln kann. „Es war um Mittag und heller Sonnenschein, dass ich ohne Perspektiv Nähen und Fernen genau erkennen konnte. Die Flut bedeckte die Lagunen, und als ich den Blick nach dem sogenannten Lido wandte ... sah ich zum ersten Mal das Meer und einige Segel darauf...“, schreibt Goethe in seiner „Italienischen Reise“. Galilei benützte den großen Glockenturm als Plattform für seine astronomischen Studien und entdeckte von hier aus am 21. August 1609 die Trabanten des Jupiter.
Früher war der Turm von Holzbuden umgeben, in denen auch Weinhändler ihre Verkaufsstände hatten. Die Bezeichnung ombra (ein wichtiges Wort in Venedig!), die für ein kleines Glas Wein oder eine ähnliche Menge eines anderen alkoholischen Getränkes steht, kommt vermutlich daher, dass die Weinhändler mit ihren Ständen im Schatten des Turms mitgewandert sind, um ihre Getränke möglichst kühl zu halten – „andare al ombra“ in der ursprünglichen Bedeutung des Ausdrucks, der heute eher eine kleine Kneipentour bedeutet.
Zu Füßen des campanile liegt feingliedrig und elegant die Hauptwache, die Loggetta. Sie steht in einer langen italienischen Bautradition: „Offene Bogenhallen auf Pfeilern oder Säulen, wo sich die Vornehmen treffen und Geschäfte besprechen, finden sich in allen oberitalienischen Städten und stellen ein antikes Fossil in mittelalterlicher oder neuerer architektonischer Gestaltung dar, lagen gewöhnlich an Platz- oder Straßenecken und sind auch für den Markusplatz seit dem 14. Jahrhundert bezeugt.“ (Hubala). Die Loggetta, die möglicherweise einen Vorgängerbau hatte, wurde 1537–40 von Jacopo Sansovino errichtet, während der Vorbau mit der Balustrade erst später entstand und das Bronzegitter 1733–35 hinzukam. Architektonischer Grundgedanke des Bauwerkes ist der des antiken Triumphbogens. Er wurde hier mit drei gleich hohen und gleich weiten Bögen gestaltet, denen Säulen vorgestellt wurden, die wiederum eine mächtige, reliefgeschmückte Attika tragen. Die vier wundervollen Bronzefiguren in den Nischen, die als Sinnbilder der Tugenden des Staates Minerva, Apollo, Merkur und Pax darstellen, schuf Sansovino selbst. Das Mittelrelief in der Attika symbolisiert die Gerechtigkeit in der Gestalt Venedigs. Die beiden seitlichen Reliefs stehen für die Herrschaft über Zypern (Aphrodite) und Candia = Kreta (Zeus). Die Errichtung Bauwerkes kostete den Staat die vergleichsweise geringe Summe von 400 Dukaten. Im Innern der Loggetta versammelte sich nach 1589 während der sonntäglichen Sitzungen des Großen Rates die Palastwache. Im Übrigen war die Loggetta das einzige bauliche Opfer des crollo. Obwohl der Campanile sie vollständig unter sich begraben hatte, konnte sie aus den Trümmern perfekt rekonstruiert werden.
Die Bauten an der Piazza und der Piazzetta
Die Piazza vor der Markuskirche wird gefasst von den Alten Prokuratien rechts, den Neuen Prokuratien links und auf der Westseite begrenzt durch die sogenannte Ala Napoleonica, den später erbauten Napoleon-Flügel – hier stand bis zum Ende der Republik, korrespondierend mit S. Marco, die Kirche S. Geminiano von Sansovino, der ursprünglich in dieser Kirche auch begraben war.
Das Amt der Prokuratoren, das wohl auf das 11. Jahrhundert zurückgeht, war das begehrteste nach dem des Dogen und diente häufiger als Sprungbrett zur Dogenwürde. Zum Aufgabenbereich der Prokuratoren gehörten zunächst Verwaltung und Pflege von San Marco und seines immensen Schatzes. Später weiteten sich die Amtsbefugnisse auf einen großen Teil der Innenverwaltung des Staates, seines Immobilienbesitzes und seines sozialen Wohnungsbaus aus.
Der Bau der Procurazie Vecchie wurde um 1500 vermutlich nach Plänen von Mauro Codussi begonnen und seit 1517 von Bartolomeo Bon geleitet. Sie weisen auf einer Länge von 142 Metern eine fast unendlich erscheinende Reihung von fünfzig Arkaden im Erdgeschoss bzw. jeweils einhundert Bogenfenstern in den beiden Obergeschossen auf, wirken aber trotz dieser Ausmaße feingliedrig. Dieser Eindruck wird durch die konsequente Anwendung des für Venedig charakteristischen Motivs der Bogenarkade und durch die zarte Ausformung der Architekturglieder (Säulen, Bögen) erreicht.
Die Procurazie Nuove gegenüber wurden 1583 von Vincenzo Scamozzi begonnen und 1616–40 von Baldassare Longhena, dem Erbauer der Kirche Santa Maria della Salute, vollendet. Auch hier wurde das Motiv der Arkadenreihe übernommen, wobei das dritte Stockwerk einen Wechsel von Rund- und Giebelfenstern zeigt. Die Procuratie Nuove stellen eine Fortsetzung der an der Piazzetta gelegenen Markusbibliothek Sansovinos dar, deren Architektur sie übernehmen. In dem Flügel der Neuen Prokuratien ist heute das Museo Civico Correr zur Stadtgeschichte untergebracht.
Mit den beiden procuratie stehen sich zwei unterschiedliche architektonische Auffassungen gegenüber, die zu Zeiten der Republik an der Westseite der Piazza fast direkt aufeinandertrafen und nur durch die schlichte Renaissancefassade der Kirche S. Geminiano voneinander getrennt waren. Die Alten Prokuratien vertraten eine demonstrativ alt-venezianische Richtung, die Neuen Prokuratien waren dagegen alla romana gestaltet.
Ihr heutiges Aussehen erhielt die Piazza erst nach dem Ende der Republik ab 1807, als Napoleon die ursprüngliche Bebauung an ihrer Westseite mit der Kirche S. Geminiano niederlegen ließ, um einen neuen westlichen Flügel, die Ala Napoleonica, wie sie heute zu sehen ist, aufführen zu lassen. Das Gebäude beinhaltet ein monumentales Treppenhaus und einen großen Saal im Obergeschoss sowie den Zugang zu den für Napoleon bestimmten Privatgemächern, die in der Procurazie Nuove eingerichtet wurden. Napoleon hat die Fertigstellung der Räume aber nicht mehr erlebt – der österreichische Statthalter benutzte sie bis 1866.
Die Fassade des Bauwerks übernimmt in zwei Stockwerken die Architekturgedanken von Sansovino und Scamozzi. Darüber lastet schwer eine mächtige Attika, der auch der Statuenschmuck nur wenig von ihrer erdrückenden Wucht zu nehmen vermag. Gerade dieses architektonische Merkmal bringt ein der venezianischen Kunstauffassung zuwiderlaufendes Moment in die Stadt, und es ist ohne weiteres möglich zu studieren, wie empfindlich die architektonische Sensibilität Venedigs durch ein solches Bauwerk gestört wird. Ursprünglich war sogar an einen am Pariser Louvre orientierten Palast mit hohem Sockel oder an einen Durchgang zur Stadt mit riesiger Tempelfassade gegenüber der Staatskirche der besiegten Serenissima gedacht. Bei Betrachtung der entsprechenden Entwürfe bleibt nur zu konstatieren, dass Venedig letztlich noch einigermaßen gut weggekommen ist.
Die vielen Läden unter den Arkaden bestanden immer schon, doch gab es früher weit mehr Cafés als heute (es waren einmal mehr als zwanzig). Das älteste Café, das unverändert bis in die Gegenwart existiert, ist das Café Florian, gegründet 1720 von einem gewissen Floriano Francesconi, der es zunächst „Venezia trionfante“ nannte, ein Name, der sich jedoch nicht lange hielt. Illustre Geister verkehrten hier, so Goethe, Marcel Proust, Thomas Mann, Ernest Hemingway. Auch Mark Twain verbrachte hier viele seiner glücklichsten Stunden. Ebenso berühmt sind das Gran Café Quadri gegenüber und das Café Lavena, in dem Richard Wagner Stammgast war.
Am östlichen Ende der Procuratie Vecchie, schräg gegenüber der Fassade von S. Marco, befindet sich der Torre dell’Orologio, der aus einem Turm sowie zwei Flügelbauten besteht und der 1496–1506 vermutlich nach einem Entwurf von Codussi errichtet wurde. In der Zeit des Baubeginns an diesem Uhrturm stand die Serenissima eigentlich vor dem Bankrott. Doch sollten die feindlichen Spione mit der Errichtung eines so aufwendigen Bauwerks über diese Tatsache hinweggetäuscht werden. Der Turm hat zwei Funktionen: Mit ihm beginnt, wie schon beschrieben, die nach Süden gerichtete Bahn zum molo hin, und außerdem mündet hier die belebteste Geschäftsstraße der Stadt, die Merceria auf die Piazza. Von großer Bedeutung ist das alte Uhrwerk, das der Turm birgt und das die Zeit auf zwei Uhrblättern anzeigt. Das zur Merceria hin gelegene Blatt ist einfacher und zeigt nur die Stunden an. Weitaus aufwendiger ist die Anlage, die auf die Piazza zeigt. Im Zentrum findet man die Erde, was dem geozentrischen Weltbild der Entstehungszeit entspricht. Sie wird umkreist vom Mond, der die jeweiligen Phasen anzeigt, sowie von der Sonne. Diese ist am Uhrzeiger angebracht, der auf die Stundenzahlen weist und außerdem mit dem Zodiacus korrespondiert. Die Anlage ist in ziemlich reduzierter Form auf uns gekommen. Ursprünglich umkreisten die Erde auch noch die fünf damals bekannten Planeten, wobei ihre jeweiligen Umlaufzeiten exakt den tatsächlichen astronomischen entsprachen. Zum alten Bestand gehörten auch die Heiligen Drei Könige, die ursprünglich jede Stunde um die Sitzfigur der Madonna kreisten und sich vor ihr verneigten. Sie wichen im 17. Jahrhundert der „digitalen“ Anzeige der Zeit, die heute zu Seiten der Madonna zu sehen ist. Die Statue der Madonna im dritten Stockwerk stammt vermutlich von Pietro Lombardo und seiner Werkstatt. Darüber steht vor blauem, bestirntem Hintergrund der Markuslöwe, vor dem bis 1797 in Analogie zur Porta della Carta die Statue des Dogen Agostino Barbarigo kniete, der den Uhrturm errichten ließ. Ein besonderer Akzent für das Gesamtbild der Piazza sind die beiden mori von 1497, zwei kolossale Bronzefiguren auf der Terrasse des Turms, die mit Hämmern auf einer Glocke die Stunden schlagen. Es handelt sich um zwei Männer verschiedenen Alters, die der Legende nach Kain und Abel sein sollen.
Die Mori verursachten eines Tages einen Unfall, von dem Thomas Coryate (1577–1617) berichtet: „Ganz oben stehen neben einer Uhr die sehr kunstvoll und naturgetreu ausgeführten Bronzefiguren von zwei Wilden. Bei dieser Uhr ereignete sich am 25. Juli, einem Montag, um etwa neun Uhr morgens, ein tragischer und beklagenswerter Unfall. Ein Mann, dem die Sorge für diese Uhr oblag, war mit der Glocke beschäftigt, um bei seiner täglichen Gewohnheit das, was fehlerhaft sein sollte, in Ordnung zu bringen. Da traf ihn plötzlich einer der beiden wilden Männer, die jede Viertelstunde ausholen, um die große Glocke anzuschlagen, mit seinem bronzenen Hammer so heftig auf den Kopf, dass er auf den Platz hinunterfiel und tot liegenblieb und keinen Laut mehr von sich gab.“ Ferner berichtet eine Legende, dass die beiden Männer, die die berühmte Uhr mit den komplizierten Tierkreiszeichen auf dem Markusplatz konstruiert hatten, später auf Anordnung des Staates hin geblendet wurden, damit sie nicht noch einmal eine solche Uhr für einen anderen Auftraggeber bauen konnten (nach Morris).
Ein paar Schritte vom Uhrturm nach rechts steht an der Piazzetta dei Leoncini die kleine, profanierte Kirche S. Basso. Das Bauwerk besitzt keine große Bedeutung, ist aber eine liebenswürdige „Nebenstimme“ im Architektur-Konzert der Stadt. Die kleine Piazzetta dei Leoncini hat ihren Namen von den beiden Löwen aus rotem Veroneser Marmor, die schon von unzähligen Kindern beritten wurden und deren Rücken dadurch blankpoliert sind. Auf dieser Piazzetta fand früher der mercato delle erbe (Kräutermarkt) statt. Ihre Stirnseite wird durch den klassizistischen Patriarchen-Palast begrenzt und abgeschlossen. Die Errichtung dieses Gebäudes wurde notwendig, als die Cappella Ducale, also S. Marco, Kathedrale und Bischofskirche wurde. Architekt war Lorenzo Santi, ein damals sehr bekannter und erfolgreicher Künstler. Zu beneiden war er um diesen Auftrag sicher nicht, da er sich auf einem extrem schwierigen Terrain bewegen musste angesichts der Tatsache, dass das Gebäude neben S. Marco und unmittelbar an der Piazza entstehen sollte. Wie schwierig das Projekt war, beweist die Tatsache, dass Santi etwa zwanzig verschiedene Entwürfe erarbeitet hatte, die alle unendliche Diskussionen und Polemiken auslösten. Noch im späteren 19. Jahrhundert meinte Tassini, der Palast, der zwischen 1837 und 1850 entstand, mache „wahrlich der Architektur unserer Tage wenig Ehre“ – ein Urteil, das heute als zu hart erscheint.
Die Piazzetta dei Leoncini war einmal Schauplatz eines Wunders. Ein Sklave sollte hier einst zur Bestrafung durch Feuer geblendet werden, doch ließ das der hl. Markus nicht zu. Er stürzte sich kopfüber in die versammelte Menge hinein und ließ den glühenden Brand gefrieren.
► Die Staatsbibliothek
Folgt man der oben genannten Bahn vom Uhrturm nach Süden in Richtung auf die beiden Säulen, so erhebt sich auf der rechten Seite der Piazzetta die Libreria Vecchia di San Marco oder Libreria Marciana, wie sie heute heißt. Jakob Burckhardt bezeichnete dieses Bauwerk, mit dessen Errichtung Sansovino 1537 begonnen hatte, als das „prächtigste profane Bauwerk Italiens“, und Kretschmayr spricht von dem „anmutigsten Heim, das je einer Bibliothek gebaut worden ist“. Mit ihr sollte für die kostbare Büchersammlung, die Kardinal Bessarion 1468 dem Staate geschenkt hatte, ein würdiger Rahmen geschaffen werden. Solche Schenkungen hatten in Venedig bereits Tradition, denn schon 1362 hatte Francesco Petrarca seine Bibliothek der Stadt vermacht: „Es wünscht Franziskus, den heiligen Evangelisten Markus, wenn es Christus so genehm ist, zum Erben zu haben für eine unbestimmte Anzahl von Büchern, die er jetzt besitzt oder die er vielleicht besitzen wird. Die Bücher sollen nicht verkauft und nicht zerstreut, sondern an einer dafür zu bestimmenden Stelle verwahrt werden, die vor Brand und Regen geschützt ist ...“. Petrarca wollte mit diesem Vermächtnis ein Vorbild geben und andere Bürger der Stadt anregen, diesem Beispiel zu folgen, wie es dann auch geschah. Auf diese Weise kam eine hochbedeutende Sammlung zusammen, die heute nur für Forschungszwecke zur Verfügung steht.
Als Kuriosum wird in der Marciana der sogenannte Fondo Tursi aufbewahrt. Ein gewisser Angiolo Tursi war nämlich auf den Gedanken verfallen, alle Bücher zu sammeln, in denen das Wort „Venedig“ auftauchte, und sei es auch nur einmal. Dabei war es ihm gleichgültig, ob sich das jeweilige Buch auch wirklich mit Venedig beschäftigte. Es ist anzunehmen, dass auf diese Weise eine gewaltige Sammlung entstand.
1545 stürzte das Gewölbe des zentralen Saales ein. Sansovino wurde für den entstandenen Schaden verantwortlich gemacht, letzteres nicht ohne Grund. Wurden doch „gemauerte Wölbungen … in der Stadt wegen der dünnen Mauern auf unsicherem Baugrund nur selten und niemals in den Obergeschossen realisiert“, schreibt Wolters, der Sansovino der Dickköpfigkeit zeiht und meint, er habe es den provinziellen Venezianern eben einmal zeigen wollen. Für seinen Fehler wanderte der zunächst ins Gefängnis und kam erst durch eine gemeinsame Intervention Tizians, Aretinos und des kaiserlichen Gesandten wieder frei. Die Vollendung des Bauwerks zog sich hin, 1554 war es bis zur 16. Arkade vollendet, während die letzten sieben Arkaden erst 1582–88 unter Scamozzi entstanden, der mit der Verlängerung des Gebäudes möglicherweise Sansovinos ursprüngliche Intentionen außer Acht ließ. Vermutlich sollten die Arkaden ursprünglich nur bis zu dem Punkt geführt werden, der in einer Flucht mit der Südfassade des Dogenpalastes liegt, also bis zum 17. Joch, mit dem Sansovino seine Arbeiten auch beendet hatte. Noch um 1560 stand zwischen Libreria und Zecca ein zierlicher Bau, die sogenannte Beccaria, wodurch ein Aufeinandertreffen dieser zwei recht heterogenen Fassaden vermieden wurde. Durch die Verlängerung der Libreria stehen die beiden Gebäude nunmehr unmittelbar nebeneinander, ein Zustand, durch den „das Auge beleidigt wird“, wie Huse schreibt und fortfährt: „Wie auch sonst an der Piazza, hätte Sansovino bestehende Zusammenhänge geklärt, verstärkt, auch neu gewichtet, aber immer mit einem ausgeprägten Sinn für die Potentiale des Ortes, an dem er baute. So hätten hier mit Münze und Bibliothek zwei der Bauten, die seit der Antike zu einem Forum gehörten, einen Raum gefasst, der den vor der Südseite des Palazzo weitergeführt hätte. Aus dem Ufer wäre wirklich ein Platz geworden, eine Bereicherung nicht nur für das Gefüge der Plätze um S. Marco, sondern auch eine Klärung der Bezüge zum Canal Grande und zum Bacino di San Marco.“
Grundidee der Architektur der Libreria ist wiederum die Venedig seit Jahrhunderten prägende Arkadenwand mit offener, tonnengewölbter Arkadenhalle, wobei Sansovino, der in Rom geschult war, dortige Vorbilder wie Colosseum und Marcellustheater aufgriff und umsetzte. Bei der Pfeilerarkatur im Erdgeschoss sind den Pfeilern dorische Halbsäulen vorgeblendet, während im Obergeschoss Säulen ionischer Ordnung stehen. Diesen großen Ordnungen sind in beiden Geschossen Bogenstellungen bzw. Bogenfenster einbeschrieben, die im Erdgeschoss von Pfeilern, im Obergeschoss von ionischen Säulen getragen werden. Die so entstehenden Zwickel sind mit Liegefiguren gefüllt, deren Details mit bewundernswerter Fantasie und Leichtigkeit gestaltet wurden. Über den Geschossen verläuft ein kräftiges Gebälk mit kleinen Mezzaninfenstern und opulenten Fruchtgirlanden, die zauberhafte Putti hochstemmen. Nach oben hin wird die Fassade durch eine Balustrade abgeschlossen, auf der Statuen stehen. Sie wiederholt die optische Trennung der beiden Geschosse. Alles ist „mit der gediegensten plastischen Pracht durch und durch belebt“ (J. Burckhardt), und das Bauwerk kann als „eine der vollkommensten Schöpfungen der italienischen Renaissance“ (Th. Droste) angesprochen werden.
Der südliche Teil des Gebäudes ist heute noch eine wissenschaftliche Bibliothek, die nur Fachbesuchern offen steht; der repräsentative große Bibliothekssaal im nördlichen Teil beherbergt Prachtbände und historische Weltkugeln der Seefahrernation Venedig. Er ist vom Museo Civico Correr in den Neuen Procuratien aus zugänglich.
Am Molo schließt sich die Zecca an, die staatliche Münzprägestätte (Zecca kommt vom Arabischen sicca – Münze), deren Architektur für die venezianische Formensprache ungewöhnlich verschlossen ist und die 1537–45 ebenfalls unter Sansovino entstand, und zwar als dessen erstes Werk im Umfeld der Piazza. Der verschlossene Eindruck, den das Gebäude macht, lässt sich ohne weiteres verstehen, wenn man das erhöhte Sicherheitsrisiko einer Münzanstalt berücksichtigt. Die Fassade war zunächst zweistöckig und erhielt das dritte Geschoss erst dreißig Jahre später. Im Untergeschoss steht eine verblendete Bogenreihe, die früher offen war, während die Fenster der Obergeschosse hochrechteckig sind. Der „wehrhafte“ Charakter wird durch die Rustika im Erdgeschoss und durch die von Rustikabändern umgebenen Halbsäulen in den Obergeschossen betont. Das Ganze wird von einem Zeltdach überfangen und durch eine zierliche Laterne bekrönt. Das Gebäude ist heute Teil der Bibliotheca Marciana.
Der Bereich links neben der Zecca hat sein Aussehen im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert. Vor langer Zeit gab es hier an der riva vor den Gärten Käfige, in denen wilde Tiere gehalten wurden, daneben auch Schiffswerften, bis diese im Jahre 1340 ins Arsenal verlegt wurden, sowie Gefängnisse, u. a. für die Gefangenen, die im Chioggia-Krieg gegen Genua gemacht wurden. Später wurden an der Stelle mächtige Getreidespeicher mit einfachen Fassaden errichtet, die Napoleon niederlegen ließ, um Platz für einen Park, die heutigen Giardini Reali, zu bekommen und um von seinen Gemächern aus einen freien Blick auf die Lagune zu haben. Die Gärten sind heute vernachlässigt und wenig einladend. Außerdem stört die recht unansehnliche Rückseite der Procuartie Nuove, die nicht als Schauseite gedacht war, das Ensemble empfindlich.
Der Blick zur Lagune hin und zum sog. Bacino, das heißt zur Wasserfläche vor dem molo, bietet eine unvergleichliche Kulisse: Ganz rechts sind die Kuppeln der Salute-Kirche zu sehen, links daneben liegt die figurenbekrönte Dogana da mar. Neben dieser wiederum säumen die Palladio-Kirchen Il Redentore und Zitelle die Ufer der Giudecca, während weiter links die Kirche San Giorgio Maggiore steht. In der Ferne sind die Konturen des Lido zu sehen, und ganz zur Linken schließlich dehnt sich der Bogen der Riva degli Schiavoni weit hin bis zu den giardini publici und dem Stadtteil San Elena.