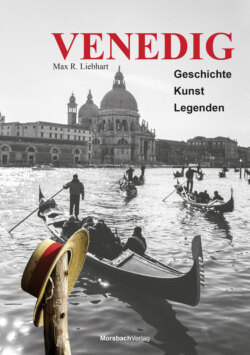Читать книгу Venedig. Geschichte – Kunst – Legenden - Max R. Liebhart - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinführung in den Aufbau der Stadt
Johann Wolfgang von Goethe hat auf seiner ersten Italienreise nur wenige Wochen in Venedig verbracht. Trotzdem ist er tief in das Wesen der Stadt eingedrungen und hat Grundlegendes zu ihrem Aufbau niedergeschrieben, wovon hier einiges zitiert sei:
„Dieses Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln geflüchtet, es war keine Willkür, welche die Folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen; die Not lehrte sie ihre Sicherheit in der unvorteilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Düstern gefangen lag; ihre Vermehrung, ihr Reichtum war notwendige Folge. Nun drängten sich die Wohnungen enger und enger, Sand und Sumpf wurden durch Felsen ersetzt, die Häuser suchten die Luft, wie Bäume, die geschlossen stehen, sie mussten an Höhe zu gewinnen suchen, was ihnen an Breite abging. Auf jede Spanne des Bodens geizig und gleich anfangs in enge Räume gedrängt, ließen sie zu Gassen nicht mehr Breite, als nötig war, eine Hausreihe von der gegenüberstehenden zu trennen und dem Bürger notdürftige Durchgänge zu erhalten. Übrigens war ihnen das Wasser statt Straße, Platz und Spaziergang. Der Venezianer musste eine neue Art von Geschöpf werden, wie man denn auch Venedig nur mit sich selbst vergleichen kann.“ Und etwas später: „Alles, was mich umgibt, ist würdig, ein großes respektables Werk versammelter Menschenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines Volks. Und wenn auch ihre Lagunen sich nach und nach ausfüllen, böse Dünste über dem Sumpfe schweben, ihr Handel geschwächt, ihre Macht gesunken ist, so wird die ganze Anlage der Republik und ihr Wesen nicht einen Augenblick dem Beobachter weniger ehrwürdig sein. Sie unterliegt der Zeit, wie alles, was ein erscheinendes Dasein hat“.
Ein Wort von Jakob Burckhardt sei dem hinzugefügt: „Venedig erkannte sich selbst als eine wunderbare, geheimnisvolle Schöpfung, in der noch etwas anderes als Menschenwitz von jeher wirksam gewesen.“
Diese Zitate sollen vorbereiten auf das, was den Besucher Venedigs erwartet, wenn er sich dem wirklich zu öffnen vermag, was auf diesen Laguneninseln entstanden ist und sich davon noch erhalten hat.
Schon beim ersten Blick auf eine Karte der Stadt lässt sich mühelos feststellen, dass Venedig aus verschiedenen Teilen besteht. So teilt der Canal Grande mit umgekehrt S-förmigem Verlauf den Stadtorganismus, während die Insel Giudecca vom gleichnamigen breiten Kanal, die Insel San Giorgio Maggiore durch die weite Wasserfläche des Bacino abgetrennt wird. Seit 1169 ist Venedig in sechs Stadtbezirke unterteilt, die sogenannten sestieri, wobei die Grenzziehungen zwischen den einzelnen Quartieren aus heutiger Sicht nicht immer nachvollziehbar, wirkliche Grenzen an manchen Stellen gar nicht erkennbar sind. In der Zeit der Republik erfolgte die Orientierung offenbar fast ausschließlich an Hand der Namen von Gassen und Plätzen. Das heute gültige System der Nummerierung geht auf Napoleon zurück. 29.254 Hausnummern sind für die ganze Stadt vergeben, in jedem der sestiere beginnt die Zählung bei 1. Doch da die Nummern ohne jedes erkennbare System verteilt sind, ist es schwierig oder gar aussichtslos, eine bestimmte Nummer zu suchen. Auch in den gängigen Stadtplänen ist außer den Namen der Gassen nichts vermerkt. Auf der Suche nach einer bestimmten Hausnummer ist man auf die Hilfe des sogenannten Indice anagrafico angewiesen, der im Buchhandel erhältlich ist. Ferner sollte man bedenken, dass einige Gassennamen in Venedig bis zu sechsmal vorkommen können, nämlich einmal in jedem sestiere.
Schon alleine deshalb wirkt die Stadt verwirrend und es ist teilweise recht schwierig, sich in ihr und ihren einzelnen Bezirken zu orientieren. Ein Stadtplan mag zwar nützlich sein, stellt aber nur bedingt eine zuverlässige Hilfe dar, ebenso wenig wie die Auskünfte der Venezianer, die, sofern man sie überhaupt antrifft, auf die Frage nach dem Weg meist nur mit einem „sempre diritto“ antworten. Wie aber sollte der unerfahrene Venedig-Besucher einen solchen Rat befolgen in einer Stadt, in der es fast nirgends „geradeaus“ geht!
Es ist nicht möglich, die einzelnen Stadtteile mit einem einzigen Rundgang vollständig zu erschließen und dem Besucher alles Sehenswerte näher zu bringen. Das ist auch gar nicht die Intention dieses Führers, der ja eigentlich eher anregen möchte, auch auf eigene Faust auf Entdeckungsreise zu gehen. Ein Reiseführer kann nur besonders schöne Wege aufzeigen, auf das Bedeutende und Außergewöhnliche hinweisen, Anregungen geben, neugierig machen. Es ist ohne weiteres verständlich, dass es in einem kurzen Zeitraum unmöglich ist, die Stadt auch nur in groben Zügen kennen zu lernen. Wer die Stadt kennenlernen will, der muss sie erleben, und das ist nur dem möglich, der in ihr wohnt, sei es im Hotel, sei es in den mittlerweile reichlich angebotenen Mietwohnungen.
Das unumstrittene Zentrum der Stadt ist die Piazza San Marco und ihre Umgebung. Es kann nichts Schöneres geben, als einen Lebenstag mit einem Besuch dieses unglaublichen Ensembles zu beginnen, indem man es langsam durchschreitet und es sich erschließt, und eben diesen Lebenstag auf dieselbe Art zu beenden. Auf Grund dieser Überlegung und Erfahrung wurde als Ausgangspunkt für die Rundgänge wenn möglich die Piazza gewählt.
Eine Besichtigung der Stadt ist sehr wesentlich eine Besichtigung von Sakralbauten. Leider sind immer mehr Kirchen praktisch nicht mehr geöffnet. Die Institution Kirche (nicht die Religion) wurde zwar stets aus dem politischen Leben und aus den entsprechenden Gremien sorgfältig herausgehalten. Es galt während der gesamten Zeit der Republik der Satz „prima Veneziani, poi Cristiani – zuerst ist man Venezianer, dann erst Christ“, die kirchliche Präsenz in der Stadt war jedoch groß. Es gilt zu bedenken, dass es in Venedig im Jahr 1581 (laut Francesco Sansovino in seinem Buch „Venezia città nobilissima e singolare“) 70 Pfarrkirchen sowie 59 Klöster gab, wobei die Hospitale, die Oratorien, die Scuole und andere Bruderschaften sowie weitere zahlreiche soziale Einrichtungen noch gar nicht mitgerechnet sind. In diesen Sakralbauten hat vieles die Jahrhunderte und auch das Ende der Republik überdauert, nach dem allerdings etwa 40 Kirchen demoliert wurden. Dagegen dient fast keiner der Paläste mehr seinem ursprünglichen Zweck, es sind also nicht mehr Wohngebäude – und sollten sie es noch sein, so sind sie zumeist in viele kleinere Wohneinheiten aufgeteilt. Kaum eines dieser Bauwerke ist zugänglich, sieht man von den wenigen Palästen, in denen Museen untergebracht sind, einmal ab (Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Ca’ d’Oro und natürlich der Dogenpalast). Außer dem Besuch der Kirchen und dem Studium ihrer Kunstschätze geht es bei dem Besuch der Stadt also im Wesentlichen darum, sich an der Vielfalt der Ensembles zu erfreuen.
„Alle Menschen in Venedig gehen wie über die Bühne: in ihrer Geschäftigkeit, mit der nichts geschaffen wird, oder mit ihrer leeren Träumerei tauchen sie fortwährend um eine Ecke herum auf und verschwinden sogleich hinter einer andern und haben dabei immer etwas wie Schauspieler, die rechts und links von der Szene nichts sind, das Spiel geht nur dort vor sich und ist ohne Ursache in der Realität des Vorher, ohne Wirkung in der Realität des Nachher ... Selbst die Brücke verliert hier ihre verlebendigende Kraft. Sie leistet sonst das Unvergleichliche, die Spannung und die Versöhnung zwischen den Raumpunkten wie mit einem Schlage zu bewirken, zwischen ihnen sich bewegend, ihre Getrenntheit und ihre Verbundenheit als eines und dasselbe fühlbar zu machen. Diese Doppelfunktion ... ist hier verblasst, die Gassen gleiten absatzlos über die unzähligen Brücken hinweg, so hoch sich der Brückenbogen spannt, er ist nur wie ein Aufatmen der Gasse, das ihren kontinuierlichen Gang nicht unterbricht ... Und ganz ebenso gleiten die Jahreszeiten durch diese Stadt, ohne dass der Wandel vom Winter zum Frühling, vom Sommer zum Herbst ihr Bild merklich änderte. Sonst spüren wir doch an der blühenden und welkenden Vegetation eine Wurzel, die an den wechselnden Reaktionen auf den Wechsel der Zeiten ihre Lebendigkeit beweist. Venedig aber ist dem von innen her fremd, das Grün seiner spärlichen Gärten ... ist dem Wechsel wie entzogen. Als hätten alle Dinge alle Schönheit, die sie hergeben können, an ihre Oberfläche gesammelt und sich dann von ihr zurückgezogen, so dass sie nun wie erstarrt diese Schönheit hütet, die die Lebendigkeit und Entwicklung des wirklichen Seins nicht mehr mitmacht ... Es gibt wahrscheinlich keine Stadt, deren Leben sich so ganz und gar in einem Tempo vollzieht ... Und dies ist die eigentliche Ursache des ‚traumhaften‘ Charakters von Venedig, den man von je empfunden hat.“ (Georg Simmel, „Venedigs Doppelleben“)