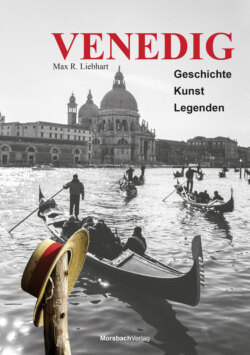Читать книгу Venedig. Geschichte – Kunst – Legenden - Max R. Liebhart - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGeschichte Venedigs
Die Gründungslegende – Erste Selbständigkeit der Siedlungen – Wirtschaftlicher und politischer Aufschwung – Niedergang der Republik – Verfassungsentwicklung und
Staatsorgane
Die Geschichte Venedigs kann hier nur mit den wichtigsten Ereignissen und in groben Zügen geschildert werden. Weitere Informationen bietet die Zeittafel am Ende dieses Buches. Es handelt sich dabei um ein Gebiet mit einer geradezu ungeheuren Fülle von Fakten, was zum einen daran liegt, dass ein Zeitraum von 1100 oder gar 1400 Jahren zu erfassen ist, zum anderen ganz wesentlich an der Tatsache, dass Venedig über lange Zeit das absolute Zentrum der damaligen Welt war. Es stieg zunächst langsam aus dem Schatten von Ostrom bzw. von Konstantinopel, der Erbin des römischen Weltreiches, empor, um diese Stadt nach und nach zu überflügeln, sie schließlich 1204 zu erobern und einen großen Teil des oströmischen Reiches zu annektieren. In der Folgezeit war Venedig die bei weitem größte Stadt der damaligen Welt, die allen Reichtum an sich zog, um schließlich in der Spätzeit der Republik politisch zwar immer bedeutungsloser, jedoch geradezu zur „Hauptstadt“ des Vergnügens und der Lebenslust zu werden, zur „feuchten Vulva Europas“, wie sie Zeitgenossen lasziv genannt hatten.
Die Gründungslegende
„Am Anfang steht natürlich eine Legende. Ein weißes Segel, wie sie auf dem Mittelmeer Brauch sind, zieht langsam über die mit gelben und roten Segeln bevölkerten Wasser der Adria; in dem Schiffchen reist Johannes, der Markus genannt wird und Jünger von Petrus und Paulus ist. Der kehrt just aus Aquileia zurück, wohin ihn Petrus selbst geschickt hat, auf dass er dort den Samen der neuen Botschaft ausstreue. Als das Boot die Höhe der Mündung des großen Medoaco erreicht hat, wird es plötzlich vom Sturm ergriffen und vom Wind zwischen die Sandbänke der Mündungslagune getrieben. Der Heilige legt an einem grünen Ufer an und streckt sich auf dem Boden aus, um sich auszuruhen. Und wie er so schläft, erscheint ihm ein Engel und spricht: ‚Friede sei mit Dir, Markus; und wisse, dass hier Dein Körper ruhen wird. Ein großer Weg liegt noch vor Dir, oh Evangelist Gottes, viele Mühen musst Du noch ertragen im Namen Christi; doch nach Deinem Tode werden die gläubigen Völker, welche diese Lande bewohnen, hier eine wunderbare Stadt erbauen und sich würdig zeigen, Deinen Leib zu besitzen, dem sie dann höchste Verehrung erweisen werden ...‘ – Das weiße Segel setzt später die Reise fort und bringt den Heiligen nach Alexandria, wo er die Erlösung verkündet, gemartert wird, den Tod erleidet und sein erstes Grab erhält.“ (Diego Valeri)
Diese Legende klingt überzeugend, sie hat allerdings den Nachteil, dass sie nach heutiger Erkenntnis frühestens im 7. Jahrhundert, vermutlich aber erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstanden ist, zu einer Zeit also, in der Venedig schon längst Weltmacht war und im Begriff stand, sich immer prächtiger zu entfalten und mit Bauten zu schmücken.
Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Anfänge der Stadtgeschichte am Rande einer Region abspielten, die in den Stürmen der Völkerwanderung fortwährend von den verschiedensten Invasoren heimgesucht wurde. Aus diesem Grunde zogen die schwer zugänglichen Lagunen Menschen an, „die hier Sicherheit für ihr Leben und ihre Arbeit suchten. Die dramatischen Ereignisse, die sich im Hinterland abspielten, und der Mangel an fruchtbarem Boden haben diese Leute zum Meer hin gedrängt, zur einzigen Gegend, die noch eine Ausdehnung zuließ. Die Seefahrt, für die Kommunikation unentbehrlich, hat die Erfolgsaussichten noch erhöht und gesteigert. Daneben haben die schwierigen Umweltbedingungen den Lagunenbewohnern nicht nur den Unternehmungsgeist, sondern auch den Gemeinsinn geradezu aufgenötigt. Diese beiden, mit der Zeit noch gereiften Tugenden erklären im Grunde, warum Venedig als unabhängiger Staat so ungewöhnlich lange überleben konnte. Sie unterscheiden seine Zivilisation von dem Individualismus und Partikularismus, der die italienische Geschichte und das italienische Leben zutiefst kennzeichnet und der auch Geschichte und Leben des venetischen Festlandes prägte, mit Ausnahme der relativ kurzen Zeit, in der es Venedig unterworfen war.“ (Zorzi)
Der Legende nach wurde Venedig am 25. März 421 um 12 Uhr mittags gegründet. M. Antonio Sabellico hat dieses Datum im 15. Jahrhundert mit hymnischen Worten gefeiert, indem er einen der fiktiven Gründer den Himmel anrufen lässt: „Wenn wir einst Großes wagen, dann gib Gedeihen! Jetzt knien wir nur vor einem armen Altar, aber wenn unsere Gelübde nicht umsonst sind, so steigen dir, o Gott, hier einst hundert Tempel von Marmor und Gold empor.“ Das Datum selbst ist in ähnlicher Weise einzuschätzen, wie das Jahr 753 v. Chr., das legendäre Gründungsdatum Roms. Es lässt sich nämlich weder ein historischer Akt für dieses Jahr nachweisen, noch gibt es ein sonstiges Ereignis, das eine „Stadtgründung“ bewirkt haben könnte. Im Übrigen lagen die ersten Siedlungen im Gebiet der Lagune gar nicht dort, wo später Venedig entstand. Die flachen Inseln, auf denen sich die Stadt heute erhebt, waren bis ins 5. Jahrhundert Niemandsland ohne Geschichte und gewannen ihre spätere Bedeutung erst im Jahr 810, in dem der Regierungssitz von Malamocco nach Rialto verlegt wurde.
Die Welt der Antike – Venetien wurde 42 v. Chr. der Provinz Italien einverleibt und unter Augustus als die 10. regio venetia ein eigener Verwaltungsbezirk – veränderte sich in den Stürmen der Völkerwanderung dramatisch und nachhaltig. In das Jahr 482 datiert der Einfall der Hunnen unter Attila, wodurch eine erste Fluchtbewegung der Landbevölkerung in die Lagunenregion ausgelöst wurde, da die schwer zugänglichen Inselgruppen zwischen Land und Meer Schutz boten. Zunächst nur temporär, war die Besiedlung im 6. Jahrhundert offenbar schon dauerhaft. In einem Brief Cassiodors, des Kanzlers des in Ravenna residierenden Ostgotenkönigs Theoderich, wird 537 eine „landschaftliche und soziale Idylle“ (Lebe) geschildert. Cassiodor sprach von Fischerhütten „gleich Nestern von Wasservögeln“, lobte das weitausgreifende Transportgewerbe („ihr legt oft riesige Strecken zurück ... Eure Boote fürchten rauhe Winde nicht. Sicher erreichen sie das Land, und sie können im seichten Wasser nicht untergehen“), er pries den Fischreichtum der Lagune, von dem sich alle sättigen könnten, stellte fest, dass Arm und Reich mit gleichem Recht zusammenlebe („die gleiche Speise ernährt alle, alle Häuser gleichen sich, man kennt keinen Neid“), und berichtet schließlich, das ganze Bemühen der Bevölkerung gelte der Salzherstellung.
Zu einer dichteren und definitiven Besiedelung der Lagunengebiete führte der Einfall der Langobarden unter König Alboin im Jahr 568. Sie vernichteten mit besonderer Härte und Grausamkeit alles, was ihnen in den Weg kam, um dann selbst in den eroberten Gebieten zu siedeln, so dass den früheren Bewohnern eine Rückkehr aus den Lagunen kaum mehr möglich war. So löste dieser Volksstamm die Gründung Venetiens aus, nicht jedoch die Venedigs im heutigen Sinn. Das Lagunengebiet blieb noch für etwa zwei Jahrhunderte ohne eigentliches Zentrum, allenfalls das Ur-Malamocco am Lido könnte als solches betrachtet werden. Weitere Zerstörungen von Siedlungen auf dem Festland erfolgten 637, die Städte Aquileia, Concordia und Altino gingen unter. Auch ein Bischof Magnus von Oderzo ging vom Festland fort und suchte Schutz in der Lagunenstadt Cittanova.
Dieser Bischof Magnus war ein interessanter Mann. Denn um ihn rankt sich eine Reihe von Geschichten, von denen jede zur Gründungslegende einer Kirche auf den Inseln wurde, auf denen sich heute Venedig erhebt. So erschien dem Magnus zunächst einmal der hl. Petrus, der ihm befahl, eine Kirche dort zu bauen, wo er Rinder und Schafe würde weiden sehen. Magnus beobachtete das dann am östlichsten Ende der Inseln, nämlich auf der Insel Olivolo, wo er die Kirche S. Pietro (in Castello) erbauen ließ, die dann zwölf Jahrhunderte lang die Bischofskirche Venedigs war. Die zweite Erscheinung war die des Erzengels Raphael, der eine Kirche dort haben wollte, wo sich viele Vögel versammeln würden – es entstand daraufhin die Kirche San Raffaele Arcangelo auf dem Dorsoduro. Danach ordnete Christus selbst die Errichtung der Kirche San Salvador an und zwar an der Stelle, über der Magnus eine rosa Wolke am Himmel schweben sehen würde. Die Jungfrau Maria erschien dem Magnus als molto formosa, und die entsprechende Kirche wurde an der Stelle erbaut, über der er eine weiße Wolke hatte schweben sehen. Johannes der Täufer war noch anspruchsvoller, denn er forderte gleich zwei Kirchen, die eine für sich, die andere für seinen Vater – die entsprechenden Kirchen sind S. Giovanni in Bragora und S. Zaccaria. Auch die Zwölf Apostel erhoben Anspruch auf eine Kirche und erschienen dem Magnus in Form von zwölf Kranichen. Schließlich erbat sich eine Santa Giustina ein Gotteshaus, und zwar dort, wo man zu ungewöhnlicher Zeit reife Trauben finden würde (diese Kirche stand im östlichen Teil des Castello und existiert heute nicht mehr). Diese Fülle von außergewöhnlichen Geschichten lässt den Schluss zu, dass der Himmel damals der Erde und insbesondere Venedig eben noch viel näher war, als das heute der Fall ist. (Außerdem soll schon hier erwähnt werden, dass sich die Tradition solcher himmlischen Erscheinungen auch noch in späteren Jahrhunderten fortgesetzt hat. 700 Jahre später nämlich geschah das dem Dogen Andrea Dandolo, dem befohlen wurde, die Kirche SS. Giovanni e Paolo zu errichten.)
Erste Selbständigkeit der Siedlungen
Das Lagunengebiet stand politisch unter dem Schutz der Exarchen von Ravenna. Es war seit 539 Teil des oströmischen Reiches, das jedoch nur mit Mühe seine Besitzungen in Italien behaupten konnte. Der Exarch wiederum bestellte einen Militärtribun, der mit weitgehenden Vollmachten ausgestattet war. Dieser Tribun wurde 697 durch einen selbstgewählten duca, seit 747 doge genannt, ersetzt, der zwar noch formell einer Bestätigung durch Ostrom bedurfte, faktisch aber bald selbständiger Volksführer und Kriegsherr war, wie es die Bezeichnung „Herzog“ auch ausdrückt. Vom ersten dieser Herzöge, dem ersten der insgesamt 120 Dogen Venedigs, ist heute nur noch der Name Paulutius Anafestus bekannt.
828 war das Jahr der sogenannten translatio marci, bei der zwei venezianische Kaufleute den mutmaßlichen Leichnam des hl. Markus in Alexandrien geraubt und ihn nach Venedig überführt hatten. Auf diese Weise habe sich die Prophezeiung des Engels an den hl. Markus erfüllt, von der dieser (siehe oben) erfuhr, als er laut der Legende im 1. Jahrhundert in der Lagune weilte. Das Datum 828 erscheint deshalb von herausragender Bedeutung, weil der werdende Staat nicht nur eine Reliquie von außerordentlichem Wert bekam – Reliquien waren in der damaligen Zeit so etwas wie „himmlische Aktien“ (Lebe), und der Besitz des Leichnams eines Apostels war in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen, – sondern auch weil Venedig eine Integrationsfigur erhielt, um die Staat und Bürger bis 1797 und darüber hinaus geschart blieben.
Welche Bedeutung der hl. Markus für die Venezianer hatte, lässt sich aus der Tatsache ersehen, dass im Jahr 1442 ein Gesetz erlassen wurde, das jeden, der einen Fluch gegen Gottvater ausstieß, mit einer Strafe von drei Lire bedrohte, während ein Fluch gegen den hl. Markus mit fünf Lire geahndet werden konnte (das Gesetz wurde allerdings nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen).
Der translatio vorausgegangen war eine für Venetien außerordentlich gefährliche Situation durch die Auseinandersetzungen mit Ostrom einerseits, mit den Langobarden und etwas später mit den Franken unter Pippin dem Kleinen und dessen Sohn Karl dem Großen andererseits. Letzterer dehnte 788 sein Reich bis nach Istrien aus, was zu einer Umklammerung Venedigs führte. 809 schließlich griff Karls Sohn Karlmann (der sich später wie sein Großvater ebenfalls Pippin nannte) Venetien an und siegte dabei offensichtlich auf ganzer Linie, wenngleich eine Eroberung der Lagunenregion in der venezianischen Geschichtsschreibung später bestritten und die tatsächlichen Ereignisse dahingehend umretuschiert wurden, dass die Eroberung eigentlich doch gar nicht stattgefunden habe. De facto aber waren die Veneter vorübergehend Untertanen des Kaisers in Aachen. Allerdings erreichte Byzanz auf diplomatischem Wege – und zwar im Friedensvertrag von Aachen von 812 – unter anderem die Rückgabe Venetiens, indem es die Kaiserwürde Karls des Großen als gleichberechtigt mit der des oströmischen Kaisers anerkannte.
Seit dieser Zeit saß Venedig quasi zwischen zwei Stühlen – was sich in diesem Fall jedoch nicht als Nachteil erwies, sondern als Chance gesehen und genutzt wurde. Die Stadt konnte sich im Machtvakuum zwischen dem westlichen und dem immer schwächer werdenden östlichen Reich formen und stabilisieren und schließlich auch expandieren.
Wirtschaftlicher und politischer Aufschwung
Etwa ab dem Jahr 1000 begann dann ein märchenhafter Aufstieg, der in erster Linie durch die Brückenfunktion Venedigs zwischen Ost und West begründet war. Der Aufstieg betraf sowohl die wirtschaftliche als auch die kulturelle Seite. 1177 erlebte die Stadt den ersten Höhepunkt ihrer Geschichte, als der Doge Sebastiano Ziani in der Stadt die Versöhnung zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Papst Alexander III. herbeiführte, ein Ereignis, das zur Selbstdarstellung genutzt und mit einer märchenhaften Prachtentfaltung verbunden wurde. Die weitere geschichtliche Entwicklung, von massiven Provokationen Venedigs durch Byzanz erheblich gefördert, gipfelte in der Eroberung von Konstantinopel im Jahr 1204 durch den 90-jährigen, angeblich blinden Dogen Enrico Dandolo, der trotz Blindheit und Alter an der Erstürmung der Mauern an der Spitze seines Heeres beteiligt war. Dem Dogen war es gelungen, das Heer des Vierten Kreuzzuges, das sich auf dem Lido versammelt hatte, um mit venezianischen Schiffen ins Heilige Land transportiert zu werden, umzulenken und für seine Ziele zu verwenden. Die Kreuzfahrer hatten mit der Republik einen Vertrag über den Transport des Heeres geschlossen. Für 85.000 Silbermark sollten 4.500 Ritter, 9.000 Knappen, 20.000 Mann Fußvolk sowie Tausende von Pferden ins Heilige Land gebracht und auf der Fahrt verpflegt werden. Doch als es so weit war, kamen weit weniger als ursprünglich angenommen, nämlich nur etwa ein Drittel. Weil dieses kleine Heer die vertraglich vereinbarte Summe nicht aufbringen konnte, erhielt Dandolo die Möglichkeit, dem Heer Bedingungen zu diktieren und die Zielrichtung des Kreuzzuges zu ändern. Nicht verschwiegen werden soll, dass sowohl die Kreuzfahrer als auch die Venezianer bei der Eroberung und der anschließenden mehrtägigen fürchterlichen Plünderung Konstantinopels vor keiner Freveltat zurückschreckten. Venedig übernahm von Byzanz außer unermesslichen Reichtümern das sogenannte „Venezianer-Drittel“ („ein Viertel und die Hälfte eines Viertels“), zu dem auch die Inseln der Ägäis einschließlich Kreta und die Peloponnes gehörten. Außerdem setzte nach 1204 ein Strom von Kunstgegenständen (z. B. die Pferde von San Marco) und antiken Spolien nach Venedig ein, mit denen die Stadt geschmückt wurde – so besteht die säulengeschmückte Fassade von San Marco fast durchweg aus Material, das aus Byzanz stammt. Auf längere Sicht gesehen war der militärische Erfolg Venedigs jedoch von zweifelhaftem Wert, da sich Konstantinopel von dieser Niederlage und der erlittenen Plünderung nie mehr erholte und schließlich 1453 von den Osmanen eingenommen wurde, welche schon seit langem begonnen hatten, Schritt für Schritt venezianische Besitzungen zu erobern.
Die drei Jahrhunderte von 1204 bis etwa 1508 waren die Epoche der größten Machtentfaltung in der Geschichte der Republik, die sich 1297 mit der sogenannten serrata, der endgültigen Festlegung der Namen der politisch entscheidungsberechtigten Adelsfamilien im Goldenen Buch der Stadt, eine bis 1797 nicht mehr wesentlich veränderte Verfassung gab, die allerdings niemals kodifiziert wurde. Natürlich gab es in diesem langen Zeitraum auch einige größere Probleme: 1310 einen Umsturzversuch durch Bajamonte Tiepolo (den Enkel eines Dogen) und 1355 eine Verschwörung des amtierenden Dogen Marino Falier, der eine Monarchie nach Vorbildern in Mailand, Padua oder Verona anstrebte und nach kurzem Prozess hingerichtet wurde. Daneben gab es mehrere kriegerische Auseinandersetzungen mit Genua, die im sogenannten Chioggia-Krieg von 1378–81 gipfelten, in dem Venedig bereits von allen Seiten umzingelt war und dem Untergang ins Auge blickte, sich aber in letzter Sekunde doch noch behaupten konnte. In diese Zeit fiel auch die Ausdehnung des Besitzes der Republik auf dem Festland, wofür besonders der Name des Dogen Francesco Foscari (1423–57) steht, dessen territoriale Forderungen einen Krieg von dreißig Jahren Dauer heraufbeschworen. Diese Hinwendung auf das Festland war ein zweischneidiges Schwert. Zwar wurde durch sie der Reichtum der Stadt erheblich vermehrt und auch die schmale Basis der Bevölkerungszahl verbreitert, aber zugleich gab Venedig seinen Charakter als Inselstaat auf und geriet als Territorialmacht in Konfrontation und Rivalität mit den italienischen Nachbarn; es wurde hineingezogen in die fast undurchdringlichen Verflechtungen der politischen Verhältnisse auf der italienischen Halbinsel, die ein Historiker mit einem „Schlangennest“ verglichen hat. Letztlich führte das zur „Liga von Cambrai“, die sich 1508 formierte und in der sich politisch die ganze damalige Welt, also Papst, Mailand, Spanien, Frankreich, Deutsches Reich und Ungarn gegen Venedig zusammenschloss – und die Osmanen nahmen die Gelegenheit gerne wahr, ihrerseits über Venedig herzufallen. Nach einer verheerenden Niederlage, die die Venezianer 1509 bei Agnadello erlitten, eroberten die Truppen der Liga praktisch das gesamte venezianische Hinterland und bedrohten Venedig unmittelbar. Doch war auch damals nichts so verlässlich, wie die Unzuverlässigkeit der Starken, wodurch die Liga rasch wieder auseinanderbrach. Auf diese Weise konnte sich Venedig noch einmal retten und die alten Besitzungen fast vollständig zurückgewinnen, ging aber aus dem Krieg letztlich als zweitrangige Macht hervor – das Zeitalter der Nationalstaaten mit ihren Volksheeren war angebrochen.
Kurz vor diesem Krieg gab es 1498 mit der Umrundung Afrikas durch Vasco da Gama und der damit verbundenen Entdeckung des Seeweges nach Indien ein Ereignis, das die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Venedig nachhaltig veränderte. Der Preis für den Pfeffer brach am Rialto zusammen und zog einige Banken mit in den Ruin. Das Mittelmeer verlor seine zentrale Bedeutung für Schifffahrt und Weltwirtschaft. Die wirtschaftlichen Folgen waren so tiefgreifend, dass die Republik damals ernsthaft erwog, einen ersten Suezkanal zwischen Ägypten und der Sinai-Halbinsel zu bauen.
Der politische Abstieg Venedigs zur Mittelmacht war jedoch nicht mit einem entsprechenden wirtschaftlichen Niedergang verbunden. Im Gegenteil war der Reichtum größer als zuvor. Ende des 16. Jahrhunderts befand sich Venedig in einem wirtschaftlichen Zustand, den Zorzi wie folgt beschrieb: „Venedig war damals so überreich und bis an die Grenze des Unbehagens überladen, dass es an eine prächtige, schon überreife Frucht erinnerte“. Eine solche Entwicklung konnte auf die Dauer nicht gut gehen, weil durch sie geradezu zwingend Begehrlichkeiten geweckt werden mussten. Als dann die Französische Revolution neue Ideen in die Welt setzte und das revolutionäre Frankreich einen General hervorbrachte, der keinerlei Skrupel kannte, war die Zeit reif für den Untergang der Republik.
Niedergang der Republik
Dieser erfolgte gewaltsam 1797, in dem Jahr, in dem Lodovico Manin, der 120. und letzte Doge, sein Amt niederlegte, der Große Rat das Ende der Republik erklärte und vor Napoleon kapitulierte. Der Weg bis zu diesem Ereignis war durch zunehmende politische Machtlosigkeit gekennzeichnet, wobei die Besitzungen auf der terra ferma noch relativ stabil blieben, das levantinische Besitztum jedoch unaufhaltsam Stück für Stück durch die Türken erobert wurde. Daran konnte auch ein Seesieg wie der von Lepanto 1571 durch die vereinten Flottillen Venedigs, Spaniens und des Papstes unter dem Oberkommando von Don Juan d’Austria, Sohn Kaiser Karls V., nichts ändern. 1718 setzte der Friede von Passarowitz, der bezeichnender Weise zwischen Österreich und den Türken, aber ohne venezianische Beteiligung geschlossen wurde, einen Schlusspunkt, durch den die Stadt sämtliche Besitzungen im östlichen Mittelmeer verlor. Venedig war keine Macht mehr, die man an Vertragsabschlüssen beteiligte, entschieden wurde in Wien, Istanbul, Madrid, Paris und London. Venedig war schließlich einfach zu klein, um sich gegen die sich bildenden Nationalstaaten zu behaupten. Außerdem waren wohl auch einige der früheren Tugenden, die den Aufstieg ermöglicht hatten, wie Entschlusskraft und unbedingter Einsatzwille, abgeschwächt oder ganz abhandengekommen. Vermutlich kam es so zu der fatalen Entscheidung, sich mit einer „unbewaffneten Neutralität“ gegen ein französisches Revolutionsheer unter Napoleon bzw. gegen die Expansionsgelüste von Frankreich und Österreich behaupten zu wollen.
Bis 1866, mit Ausnahme der Jahre 1804–14, in denen die Stadt Napoleon unterstand, war Venedig österreichisch. Ein Aufstand unter Daniele Manin 1848 wurde nach langer Belagerung und massivem Artilleriebeschuss niedergeschlagen. Ab 1866 gehörte Venedig zum Königreich Italien. Der Verlust der terra ferma hatte schon vorher durch den damit verbundenen Wegfall der wirtschaftlichen Grundlagen zu einem dramatischen Niedergang geführt, aus dem Venedig als die morbide Stadt hervorging, als die sie in der Dichtung häufig geschildert wird. Einen gewissen Ausgleich stellt der zunehmende Tourismus dar, der allerdings die Entwicklung zur Museumsstadt mit anhaltendem Bevölkerungsrückgang vorantreibt.
Verfassungsentwicklung und Staatsorgane
Die Entwicklung der Verfassung verlief über mehrere Jahrhunderte, in denen zunächst die Loslösung von Byzanz betrieben wurde, während später, genauer gesagt seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, sich der Adel gegen Dogen und Bürgertum durchsetzte und die Gremien der aristokratisch-oligarchischen Machtausübung entstanden. Höhepunkt dieser Entwicklung war das Wahlgesetz des Jahres 1297, das auch als die sogenannte serrata in die Geschichte eingegangen ist. Darunter ist die Schließung des Großen Rates zu verstehen, bei der festgelegt wurde, welche Familien in das „Goldene Buch“ der Stadt eingetragen wurden und somit dem Adel angehörten, dem Teil der Bevölkerung der Republik, der alleine bei Regierungsgeschäften mitbestimmungsberechtigt war. Die Verfassung, die sich bis dahin herausgebildet hatte, blieb dann bis zum Ende der Republik im Jahr 1797 im Wesentlichen unverändert, war also 500 Jahre stabil, was man als eine außerordentlich erstaunliche Tatsache würdigen muss. Hier können nur die Grundzüge dieser Verfassung nachgezeichnet werden.
Die verfassungsrechtliche Ordnung der Anfänge des venezianischen Staatsgebildes entsprach der einer byzantinischen Grenzprovinz, zu der außer Venetien und die Lagunen auch noch Istrien, die Emilia, die Küste von Ravenna bis tief nach Süditalien, zeitweise auch Neapel, Teile der Toskana und Ligurien gehörten. Eine Veränderung ergab sich erst mit dem Machtverfall von Byzanz, der gegen Mitte des 8. Jahrhunderts immer deutlicher wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die byzantinische Provinz durch den Exarchen von Ravenna regiert, der oberster Befehlshaber in allen Militär- und Zivilbelangen war. Ihm unterstanden die von ihm ernannten magistri militum, die für die einzelnen Grenzprovinzen (limites) zuständig waren und einzelne Aufgaben an duces delegieren konnten. Bestimmte Verteidigungsanlangen wie Festungen unterstanden tribunen. Waren die duces zunächst den magistri militum unterstellt, so verwischte sich dieser Rangunterschied nach und nach, bis schließlich der Titel magister militum nur mehr ein Ehrentitel war. Im Jahr 697 wurde Paoluccio (Paulutius) Anafestus vom Exarchen von Ravenna als dux eingesetzt. Die Chronik berichtet, dass der Patriarch von Grado eine Versammlung der Tribunen und Kirchenfürsten einberufen haben soll, die den neuen Herzog durch Akklamation bestätigte. An dieser Versammlung sollen zwölf Mitglieder der später sogenannten (etwa 90) case vecchie (Adelsgeschlechter) teilgenommen haben, nämlich die Badoer, Barozzi, Contarini, Dandolo, Falier, Gradenigo, Memmo, Michiel, Morosini, Polani, Sanudo und Tiepolo, die deshalb die „apostolischen Familien“ hießen.
747 entstand aus dem dux das Amt des Dogen, der folgerichtig der Mächtigste im Staate Venedig wurde, aber angewiesen blieb auf die Unterstützung durch den lokalen Adel, dem einzelne Staatsgeschäfte delegiert wurden. So entstanden schon früh die Voraussetzungen für eine Dualität und damit für ein Kräftemessen zwischen dem Herzog (Dogen) und dem Adel. Von Anfang an setzte letzterer alles daran, die Entstehung einer Erbmonarchie einer bestimmten Familie zu verhindern, wobei solche Intentionen natürlich im Interesse der jeweiligen Dogen gelegen haben. Mit solchen Bestrebungen sind recht viele Dogen gescheitert. Wie heftig die Auseinandersetzungen gewesen sein müssen, ergibt sich aus der Tatsache, dass von den ersten 50 Dogen 19 getötet, verbannt oder abgesetzt wurden. Sieger blieb letztlich der Adel. 1032 erging ein erstes Staatsgrundgesetz, das dem Dogen verbot, Nebenherrscher zu ernennen. Damit erhielt der Doge gewissermaßen erstmals einen gesetzlichen Rahmen, was gleichbedeutend war mit dem Ende der absoluten Dogenmacht. Außerdem wurde ihm im gleichen Jahr ein beratendes – und kontrollierendes – Kollegium beigeordnet. In der Folgezeit erfolgte Schritt für Schritt die Einengung der Macht der Dogen durch weitere gesetzliche Regelungen, gleichzeitig wurden Organe der Gerichtsbarkeit und Verwaltung zunehmend unabhängig vom Staatsoberhaupt. 1172 wurde die bis dahin noch politisch aktive Volksvertretung entmachtet, und zwar zu Gunsten der Adelsvertretung, die sich nunmehr in Großem und Kleinem Rat konstituierte. 1192 musste Enrico Dandolo, der spätere Eroberer von Konstantinopel, eine erste promissio ablegen, worunter ein Eid auf die Verfassung zu verstehen ist, durch den Rechte und Pflichten des Dogen festgelegt waren. In diese Wahlversprechen wurden später immer mehr Einschränkungen und Auflagen aufgenommen. Ein Verstoß gegen sie galt als schweres, ja sogar als todeswürdiges Verbrechen. Der Große Rat war seit Ende des 12. Jahrhunderts oberste Instanz des Staates und blieb dies auch bis zum Ende der Republik. 1297 wurde die Macht der Adelsfamilien durch die schon erwähnte serrata, die Schließung des Großen Rates, zementiert. Das Goldene Buch blieb künftig grundsätzlich geschlossen, eine Regelung, von der Ausnahmen nur gegen die Zahlung exorbitanter Summen gemacht wurden. 1310 erfuhr die Republik noch einmal eine gewaltige Erschütterung durch die Verschwörung des Bajamonte Tiepolo, der einen der letzten Versuche unternahm, eine Erbmonarchie zu errichten, wie sie in anderen Städten Italiens üblich war, z. B. in Florenz mit den Medici. Dieser Aufstand, der niedergeschlagen wurde, führte zum Einsetzen einer obersten Kontrollbehörde, des „Rates der Zehn“, als Ergänzung und Gegengewicht zu den bis dahin schon bestehenden Gremien. Der Vollständigkeit halber sei noch die Verschwörung des Dogen Marino Falier angeführt, der derentwegen 1355 hingerichtet wurde.
Im venezianischen Staatsgebilde herrschte das Prinzip des Misstrauens, das Kontrolle und Gegenkontrolle notwendig machte. Dabei überschnitten sich die Kompetenzbereiche der einzelnen Staatsorgane häufig und in retrospektiv ziemlich undurchsichtiger Weise. Um dem Einzelnen nicht zu viel Macht zuwachsen zu lassen, waren die Amtszeiten relativ kurz, und je wichtiger das Amt war, desto kürzer die Amtszeit. Für die capi des Rates der Zehn betrug sie beispielsweise nur einen Monat. Auf Lebenszeit gewählt wurden der Doge (der aber vom Großen Rat abgesetzt werden konnte), die Prokuratoren von San Marco, die politisch machtlos waren und im Wesentlichen nur zu repräsentieren hatten, und der Großkanzler, eine Art Bürochef des Dogen, der in keinem Gremium Stimmrecht besaß. Die einzelnen Gremien seien im Folgenden skizzenhaft dargestellt:
Der Große Rat als oberstes Organ des Staates besaß grundsätzlich unbeschränkte Macht, insbesondere hinsichtlich der Gesetzgebung, des Einsetzens von Behörden und Beamten sowie der Entscheidung über Krieg und Frieden. „Die wohl wichtigste Aufgabe des Großen Rates war die Wahl des Dogen und aller höheren Staatsfunktionäre aus seinen eigenen Reihen.“ (Lebe) Er war aber auf Grund seiner Größe mit mehr als 2.000 Personen viel zu schwerfällig, um alle Entscheidungen selbst treffen zu können, weshalb er Aufgaben an Unterinstanzen delegierte, die natürlich alle aus Mitgliedern des Großen Rates bestanden. In den Großen Rat wurde man seit der serrata nicht mehr gewählt, sondern hineingeboren. Jeder mindestens 25-jährige Angehörige einer adeligen Familie war berechtigt, in das Gremium einzutreten.
Der Doge war das Staatsoberhaupt und der oberste Repräsentant der Republik Venedig. Er wurde jedoch schon von Petrarca, also im 14. Jahrhundert, als Sklave der Republik bezeichnet und bildlich oft knieend vor dem Markuslöwen dargestellt. Er fungierte als primus inter pares, sein Einfluss war aber einfach dadurch größer als der anderer Staatsfunktionäre, dass er in allen Gremien den Vorsitz hatte. Die Dogenwahl erfolgte nach dem kompliziertesten System, das die Geschichte kennt, wodurch Bestechungen vermieden werden sollten. Wahlmänner waren alle Mitglieder des Großen Rates, von denen durch Los (das Losverfahren erfolgte durch ballotage, bei der ein Knabe, der ballotino del doge, aus einer Urne für jeden Wähler eine Kugel zog) zunächst 30 ausgewählt wurden. Erneut durch Los wurden von diesen dann 9 bestimmt, die wiederum 40 andere benannten. Von diesen wurden 12 durch Los gezogen, die dann 25 Personen bestimmten. Im nächsten Losverfahren blieben 9, die 45 Kandidaten ernannten. 34 davon wurden wieder durch Los eliminiert. Die verbliebenen 11 Personen schließlich ernannten die 41 eigentlichen Wahlmänner, die den Dogen aus den angetretenen Kandidaten auswählten, wofür eine Mehrheit von mindestens 25 Stimmen erforderlich war. Die ganze Wahlprozedur erfolgte unter den Bedingungen eines rigorosen Konklaves im Dogenpalast. Der Gewählte war verpflichtet, die Wahl anzunehmen. Er wurde der völlig entmachteten Volksvertretung, dem arrengo in San Marco zur Akklamation vorgeführt mit den Worten: „Dies ist euer Doge, wenn es euch beliebt“, ein Satz von lediglich rhetorischer Bedeutung, dem das Volk mit einem „Sia, sia!“ (es sei) zu antworten hatte. Ein leichtes Leben hatte der Gewählte dann nicht mehr, was sich einerseits an der Fülle seiner Aufgaben, andererseits angesichts der Einschränkungen, wie sie sich aus den Promissionen ergaben, gut nachvollziehen lässt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Doge schrittweise entmachtet, bis er schließlich praktisch nur mehr als Repräsentationsfigur fungierte.
Neben dem Großen Rat gab es den Kleinen Rat, der am Anfang aus sechs consiglieri, Räten aus den sechs Stadtbezirken Venedigs, bestand. Diese Männer umgaben – und überwachten – den Dogen bei allen seinen Amtshandlungen. Dieser ursprünglich Kleine Rat wurde im 13. Jahrhundert um die drei Vorstände der quarantia erweitert. Im 14. Jahrhundert kam noch die sechzehnköpfige Kommission der savi, der „Weisen“ hinzu, wodurch die Signoria, die „Herrschaft“, entstand. Der signoria kam eine besondere politische Bedeutung zu und sie besaß bis zur Gründung des Senats die Funktion der obersten Staatsführung. „Die Hauptaufgabe der Signoria bestand darin, die Aufgaben eines Staatsoberhauptes mit dem Dogen zu teilen. Die Dogenberater und die Capi der Quarantia waren somit nicht nur Berater des Dogen, vielmehr konnte der Doge seine Aufgaben nur in Zusammenarbeit mit der Signoria erfüllen. Der Doge war Primus in der Signoria, gleichzeitig aber das Objekt der Kontrolle durch diese.“ (Heller)
Der Senat entstand im 13. Jahrhundert auf Grund der Schwerfälligkeit des Großen Rates und setzte sich zunächst aus 60 Mitgliedern zusammen, die natürlich alle Adelige waren. Er wurde bis zum 16. Jahrhundert schrittweise auf 300 Mitglieder erweitert. Zu seinen Mitgliedern gehörten auch die der Signoria, also auch der Doge. Der Senat war bis zum 16. Jahrhundert wichtigstes politisches Organ des Staates, in dem nahezu alle Fragen der äußeren und inneren Politik diskutiert und entschieden wurden. Er besaß umfassende Kompetenzen. Als sich schließlich erwies, dass auch der Senat zu groß und damit zu unflexibel geworden war, sah sich dieser gezwungen, einzelne Aufgabe zu delegieren. Das geschah durch Gründung von Kommissionen, die meist nur aus drei oder fünf Mitgliedern bestanden. Diese Kommissionen wurden meist als collegio bezeichnet, ihre Mitglieder hießen provveditori oder auch savi, Bezeichnungen, denen jeweils eine Kurzbezeichnung der Aufgaben folgte (z. B. provveditori alle acque, sopra gli ospedali, sopra banchi).
Der Rat der Vierzig, die quarantia, war ursprünglich eine Kommission des Großen Rates, besaß im 13. Jahrhundert umfangreiche Kompetenzen und entwickelte sich im 14. Jahrhundert zum obersten Gerichtshof Venedigs und Berufungsgericht. Im 15. Jahrhundert wurde sie in vier mit verschiedenen Zuständigkeiten verbundene Abteilungen aufgegliedert, von denen die quarantia criminale die wichtigste war. Seit dieser Zeit büßte dieses Gremium langsam an Bedeutung ein. So verfügte der Kleine Rat seit dieser Zeit über das Recht, bestimmte Verfahren an sich zu ziehen. Erwähnt seien in diesem Zusammenhang auch die signori di notte, die „Herren der Nacht“. Es handelte sich dabei um einen Strafgerichtshof, der für Sicherheit und Sittlichkeit zuständig war und Gassen und Kanäle der Stadt nachts überwachte.
Der Rat der Zehn, der consiglio dei dieci, wurde 1310 nach dem Umsturzversuch Bajamonte Tiepolos zunächst als eine vorübergehende Einrichtung gegründet. Er entwickelte sich jedoch rasch zu einer hochbedeutenden Regierungsbehörde, der fünften neben Großem und Kleinem Rat, Senat und dem Rat der Vierzig. Im Jahre 1335 wurde er zur ständigen Einrichtung erklärt. Er wurde zum wichtigsten Kontrollorgan, wobei letztlich alle anderen Staatsorgane seiner Kontrolle unterlagen. Man könnte auch vom obersten Verfassungsschutz sprechen, dessen Kompetenzen faktisch uneingeschränkt waren. Es handelt sich um das Gremium der Republik, um das sich die meisten, überwiegend gruseligen Geschichten ranken.
„Die undurchsichtige Tätigkeit des Rats der Zehn, die nächtlichen Verhöre und mitunter auch Folterungen, die er im Dogenpalast durchführen ließ, das von ihm entwickelte Informations- und Erkundungssystem sowie die von ihm verwendeten – nur zum Teil finsteren – Kerker im Dogenpalast haben dieses Verfassungstribunal natürlich bald zum Gegenstand phantasievoller und abenteuerlicher Spekulationen im Volk, im Ausland und später besonders in der Literatur gemacht. Um so mehr, als im 16. Jahrhundert dann aus den Dieci die venezianische Staatsinquisition hervorging, der man besonders schreckliche Dinge nachsagte. Indessen ist völlig einwandfrei bewiesen, dass der Rat der Zehn trotz aller hinterhältigen Maßnahmen aus den Grauzonen besonders der Sicherheits- und Außenpolitik, wie sie allgemein zum zeitgenössischen Repertoire gehörten, seine Prozesse und Verfolgungen vergleichsweise korrekt und ohne auffallende Willkür betrieben hat.“ (Lebe)
Aus dem Rat der Zehn gingen 1539 die Staatsinquisitoren hervor. Deren Geschichte reicht bis in das Jahr 1310 zurück, in dem der Rat der Zehn gegründet wurde. Schon damals wählte man aus dem Kollegium zwei Inquisitoren mit einer Amtszeit von nur einem Monat, mit der Funktion von Untersuchungsrichtern, die jedoch zunächst keine besondere Machtstellung hatten. Das änderte sich erst, als historische Ereignisse die Existenz des Staates zu bedrohen schienen, wie es um die Mitte des 16. Jahrhunderts aufgrund der Expansionspolitik der Türken unter Suleiman II. dem Prächtigen geschah. Im Rahmen der kriegerischen Auseinandersetzungen kam es im September 1538 zu einer Seeschlacht zwischen den Türken und einer überlegenen christlichen Flotte bei der Insel Lefkas, die die Christen überraschenderweise verloren. Es entstand der dringende Verdacht, die Niederlage sei durch Verrat bedingt gewesen. Diesen Verdacht aufzuklären erwies sich jedoch als schwierig bzw. unmöglich, weil zu viele Personen über die Vorgänge im Rat der Zehn Bescheid wussten. „Um die Bedrohnung Venedigs durch den Verrat von Staatsgeheimnissen in Zukunft zu verhindern, war es also notwendig, dass man die besonders geheimen Angelegenheiten nur mehr einem kleinen Gremium von bloß drei Personen anvertrauen sollte.“ (Heller) Die Befugnisse dieser Staatspolizei, welche die Venezianer i tre babài nannten, zu durchschauen, ist aus heutiger Sicht ausgesprochen schwierig. Auch ihr Aufgabenbereich lässt sich nur ungefähr beschreiben. Die Inquisitoren verfolgten alle gegen den Staat begangene Verbrechen wie Hochverrat, Spionage, Beleidigung der Regierung sowie verdächtigen Kontakt zu Ausländern. Sie besaßen das Recht, Spitzel einzusetzen und zu bezahlen. Auch konnten sie Verräter von Staatsgeheimnissen verurteilen, seit 1605 auch zum Tode. Nach und nach zogen sie wesentliche Teile der Macht der Zehn an sich und waren letztlich die Institution, deren Wirken heute noch in Form vieler – erfundener oder wahrer – Gruselgeschichten in den Vorstellungen der Menschen spukt. Zur Zeit der Staatsinquisition gab es in Venedig durchaus Tendenzen, die in Richtung eines Polizeistaates gingen. So „konnten die Inquisitoren jene verurteilen, die die Republik verächtlich machten, eine Maßnahme, die für moderne Diktaturen geradezu charakteristisch werden sollte.“ (Heller) Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung konnten die Inquisitoren ihre Machtbefugnisse immer weiter ausdehnen. Seit 1612 waren sie den Capi des Rates der Zehn gleichgestellt, seit 1673 beachteten sie das Einspruchsrecht der avogadori nicht mehr, gingen auch dazu über, ihnen missliebige Personen ohne Gerichtsverfahren heimlich umbringen zu lassen. In der Spätzeit der Republik kontrollierten die Staatsinquisitoren nicht mehr nur die Staatsgerichtsbarkeit, sondern auch noch den Verkehr mit Botschaftern, das Glücksspiel, die Glasproduktion (zum Schutz vor Industriespionage), den Tabak- und Salzhandel sowie die Rekrutierung von Soldaten. Es gab allerdings auch wirksame Sperren gegen Machtmissbrauch, zum einen in Form der kurzen Amtsdauer, zum anderen weil sie nur geschlossen vorgehen konnten – jeder der Inquisitoren hatte gewissermaßen ein Vetorecht. Auch gab es später immer stärkere Bemühungen, die Machtausweitung der Inquisitoren zu steuern. Ein Licht auf deren unheimliche Machtfülle wirft die Tatsache, dass der vorletzte Doge, Paolo Renier, einmal gegen die Macht der Inquisitoren wetterte, sich aber dadurch sehr unbeliebt machte und schließlich gefragt wurde, ob er sich denn seines Lebens noch sicher wähnte, wenn er die Inquisitoren angreife. Das Gefängnis der Staatsinquisition waren im Übrigen die piombi, die Bleikammern unter dem Dach des Dogenpalastes, die u. a. auch Casanova kennenlernte.