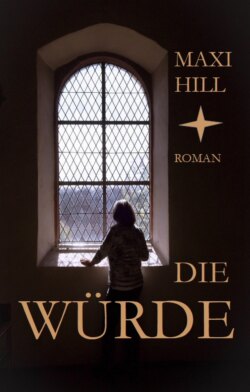Читать книгу Die Würde - Maxi Hill - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Im Pflegeheim
Оглавление»Keine Angst, hier passiert nichts Schlimmes«, beruhigt die nette Schwester im Altenpflegeheim den Neuzugang.
»Danke«, sagt Irma Hein und schaut sich zum ersten Mal vorsichtig um. Dieses rotbraune Backsteinhaus kennt sie bisher nur von außen. Nun hat sie es betreten und sofort kommt ein Gefühl in ihr auf, das sie nicht erklären kann, das sie einengt, das sie rechtlos macht. Ihre Beine wie Gummi drohen einzuknicken wie Streichhölzer. Doch Bettina hilft ihr, den Rest ihrer Habe zu verstauen, was Irma um keinen Preis von John erledigt wissen wollte. Geduldig hört Bettina zu, wie Irma ihr Leid klagt. Sie wollte nicht in dieses Heim, sie habe genug Geld, um häusliche Hilfe bezahlen zu können. Seit Kurzem aber denke sie, ihre Söhne spekulierten auf ihr Geld, das sie nicht bekommen würden, wenn sie es vor dem Ableben für Pflegeleistungen aufbrauchte. Am liebsten wäre es ihr, wenn sie beide eine Zeitlang nicht sähe.
Trotz chronischen Zeitmangels übt sich Bettina heute in Ruhe. Sie streicht geduldig über den letzten Stapel Unterwäsche, den sie für die Alte in den Schrank schiebt, registriert die Inkontinenzeinlagen, die Irma im Krankenhaus für die Nächte bekommen, aber nie gebraucht hatte.
»Für Extrageld bekommt man auch hier Extrawünsche erfüllt«, sagt die Schwester wie beiläufig, und sofort beginnen Irmas Augen zu leuchten.
»Dann schieben Sie dieses Bett hinaus. Ich möchte ein Einzelzimmer«, flüstert sie Bettina zu und schielt abwechselnd auf das leere Bett an der kurzen Wand. Das Zimmer bildet einen rechten Winkel um die eingebaute Badezelle. Noch unschlüssig greift sie zur Tasche, in der sie ihr Portemonnaie und eines ihrer Sparbücher aufbewahrt. Zum Glück hatte sie es sich zur Angewohnheit gemacht, eins der Sparbücher immer bei sich zu haben. John war sehr oft anderer Meinung als sie, aber sie denkt gar nicht daran zuzulassen, ihrer finanziellen Entscheidungen beschnitten zu werden.
»Aber … Sie sind doch allein«, sagt die Schwester schnell. Zum Glück war Nummer 42 gestern nach langem Kampf endlich verstorben, nicht auszudenken, es wäre in der ersten Nacht des Neuzuganges passiert.
»Übrigens, wir reden uns hier mit Du an, das ist leichter für alle.«
Bettina geht zu einem der zwei Fenster und öffnet es um jenen schmalen Spalt, um den man die Fenster hier öffnen kann. Die Ärmel des Kittels rutschen ein wenig herunter und entblößen böse blaue Flecken an Bettinas Oberarm. Irma traut sich zunächst nicht, doch dann fragt sie:
»Sie haben sich verletzt?«
»Sag einfach Du, das ist wirklich leichter. Wirst sehen, in ein paar Tagen fällt es nicht mehr schwer und du wunderst dich, warum du dir einmal großen Abstand von hier gewünscht hast.«
Irmas Blicke hängen noch immer an den dunklen Flecken. So schnell kann sie nicht mehr auf Worte reagieren, auf Neues umschalten. Bettina merkt es und lächelt: »Da hat sich wieder mal jemand vor der Morgenwäsche gesträubt.« Sie beugt sich zu Irma, führt ihren Finger behutsam über das welke Fleisch der Wange im Trost suchenden Gesicht. »Ich weiß, meine Gute, Ihr alle wollt eure Würde behalten. Aber wir Fachleute wissen um die Verantwortung für Patienten wie dich. Es wäre leichtfertig, dich zu Hause hilflos in deinen vier Wänden zu lassen.« Sie umarmt die alte, ein wenig beleibte Frau kurz und heftig. »Ich glaube, dich werde ich sehr lieb haben können.«
Dann huscht sie in die Badezelle und schiebt den Krankenstuhl heraus, der bislang der gestern Verstorbenen gehört hat. Es bereitet Mühe, Irma zu bewegen, in das Gefährt zu steigen und es kostet noch mehr Überredungskunst, sie mitzunehmen in den Speisesaal. Erst draußen vor der Tür mit der Nummer 42 bemerkt Irma, das letzte Zimmer im langen Gang bekommen zu haben. Wenigstens darüber ist sie froh. Zu Hause war es ihr manchmal passiert, dass sie nicht mehr wusste, welche Haustüre die richtige war. Das zumindest könne ihr hier nicht passieren, sie muss nur laufen bis zum bitteren Ende.
Bettina schiebt den Rollstuhl mitsamt Irma über den grünen Bodenbelag des langen Ganges. Die Gummisohlen ihrer Galoschen quietschen. Scheu schaut Irma sich um. Offene und geschlossene Türen zu beiden Seiten des Flures, hölzerne Türen mit vielen Kratzern von all den Rollstühlen und Gerätschaften, die hin und her geschoben werden. An den Türen keine Namen — nur Nummern, Nummern für Schicksale, die sich hier vollenden werden. Am anderen Ende des Ganges, hinter zwei gläsernen Flügeltüren, gibt es noch einen Gang und noch ein Fenster, wie das gleich neben ihrem Zimmer 42.
»Vor Kurzem ist hier renoviert worden«, sagt Bettina und meint, die Wände seien frisch gestrichen worden. Hell ist es wenigstens, denkt Irma, aber glatt scheint der Boden zu sein. Zu Hause in ihrem Schlafzimmer hatte sie einen ähnlichen Boden. Immerzu rutschte sie aus, einmal war sie mitsamt dem Läufer weggerutscht und auf die Bettkante geknallt. Seitdem versucht sie, vor jedem Schritt erst festen Halt zu finden — auch wenn es ihr peinlich ist, weil es tapsig aussieht, ist sie allemal froh, sicheren Boden unter sich zu spüren.
Einer Bewohnerin des Heimes scheint es gerade ähnlich zu gehen. Sie steht an der Wand und tastet sich an der abgegriffenen Holzleiste entlang, die es zu beiden Seiten des Flures gibt, die aber weder geeignet ist, als Handlauf genutzt zu werden, noch als brauchbare Stoßkante. Die Frau setzt einen Fuß vor, zieht ihn wieder zurück, geht keinen Schritt weiter. Einen Meter vor ihr stehen, an ein fahrbares Bett gelehnt, zwei Gehhilfen. Dass es jene sind, die die Frau dringend brauchen würde, weiß Irma nicht. Niemand ist da, der sie der Frau reicht. Auch Bettina reicht sie ihr nicht. Neben der Tür 47 sitzt ein Mann halbnackt im Rollstuhl. Ängstlich schaut er auf die Neue und legt seine Hände schamhaft in den Schoß.
»Der wird gleich geduscht«, flüstert Bettina und wirft einer anderen Schwester mit weniger weicher Stimme die Worte zu: „Dein Pflegenotstand wartet!«
Die andere prustet genervt, rennt im Eiltempo an dem alten Mann vorbei durch die Pendeltür in das Zimmer mit der Aufschrift Personal.
Erst später, viel später, wird Irma erfahren, dass sich dieser Mann über die Zustände im Heim beschwert hat. Geändert hat er nichts, nichts zu seinen Gunsten und zu niemandes Gunsten.
Die Essenszeit ist längst vorbei, aber im Speisesaal sitzen noch Leute herum, dösen vor sich hin oder starren zur Tür. Einige haben noch die Serviette um den Hals gebunden, ein anderer hat seinen Kopf in die verschränkten Arme auf der Tischplatte gelegt und scheint zu schlafen.
»Wann gibt es denn Essen«, fragt die piepsende Stimme einer Frau, als sie Bettina kommen sieht. Ihr spärlich weißes Haar ist bekleckert wie der Latz um ihren Hals.
»Hättest dir nicht alles ins Haar schmieren sollen, dann wärst‘e auch satt geworden«, lacht Bettina und die Frau lacht jetzt mit. »Sie ist voll dement«, erklärt Bettina. Jetzt kann auch Irma lächeln, aber Hunger hat sie nicht. Hier wird sie wohl nie Hunger haben. Wie lange wird es dauern, bis John sie wieder in ihr gemütliches Zuhause holt?
Es ist Montag und Feierabendzeit. John Hein reckt seinen Kopf weit aus dem Fenster eines Hauses jener Wohnanlage, die in den sechziger Jahren abseits der Fernstraße gebaut wurde und nicht —wie seine eigene Wohnung — am Fernheizungsnetz angeschlossen ist. Der Lastwagen müsste längst hier sein, stattdessen biegt das Auto eines Nachbarn von Irma Hein um die Ecke. Der Mann steigt aus, sein Blick streift über die Fenster des Hauses. In diesem Eingang wohnen acht Familien, man kennt sich, aber man hält Distanz. Hin und wieder wechselt man freundliche Worte, einmischen will sich niemand in die Angelegenheit des anderen. Das gute Gefühl der Vertrautheit und Nächstenliebe ist der Vorsicht gewichen. Nur Not ist stärker als Vorsicht; Hilfe leistet nur noch, wer gebeten wird, doch dann jederzeit. Das ist der Rest vom Ehrenkodex einer kleinen Nation, die in Wahrheit nicht einmal eine halbe Nation ausmacht.
»Tach-schön«, grüßt er zu John hinauf. »Ist Ihre Mutter wieder gesund?«
»Schön wär’s. Sie ist verlegt auf die Pflegestation.«
»Ach!«, entfährt es ihm, doch er besinnt sich schnell. »Grüßen Sie Irma von uns, von meiner Frau und mir. Alles Gute.« Der Mann schließt das Garagentor ab und stapft über die Wiese, dem Hintereingang zu. Weil John noch immer am Fensterbrett lehnt, entschließt er sich doch noch zu ein paar Worten: »Heute kann man froh sein, wenn man heil zu Hause ankommt. Das Volk demonstriert mal wieder.«
Das Volk klingt abfällig, aber John weiß: Jeden Montag treffen sich die, die etwas ändern wollen in diesem Land. Manchmal hört man deren Parolen vom Zentrum bis hinauf in die Wohnsiedlungen. Er kann da nicht mit, er arbeitet gerade nach Feierabend am Haus eines der Bonzen von der Kreisparteileitung. Er baut die Fenster ein, viele Fenster und große Fenster. Das bringt einen guten Schein extra, von dem Gerlinde nichts weiß. Allein die Besorgung der Fenster aus seiner Firma — unter der Hand, versteht sich — hatte ihm einen Hunderter eingebracht. Nein, Beziehungen zu den Bonzen dürfe man nicht aufs Spiel setzen. Wer weiß, wofür man mal einen von denen braucht. Wenn der Auftraggeber erfährt, dass man gegen ihn und seinesgleichen demonstriert — nicht auszudenken.
Eines aber macht ihm doch Sorgen. Mit der heutigen Fracht müssen die Männer später ins Zentrum zurück. War vielleicht doch kein so guter Termin …?
Von der schmalen Straße her schiebt sich ein Robur-Transporter dicht an der Hecke einseitig auf die Gehwegplatten. Zwei Männer springen heraus, einer schiebt die Ärmel bis zum Ellenbogen und ruft nach oben:
»Ich denke, hier türmen sich schon Berge von Inventar!«
»Du Schlawiner«, ruft John zurück und droht grinsend mit der Faust. »Ich warte schon ’ne geschlagene Stunde.«
»Gegen Sechs war ausgemacht.« Der Mann schaut noch einmal genau: »Was willst du, wir sind immer noch im Limit!«
Der andere der beiden schlägt kräftig die Fahrertür zu und poltert los:
»Hättest dir lieber einen anderen Tag aussuchen sollen. Wer weiß wie lange die da unten noch so herum grölen. Vielleicht fliegen noch Pflastersteine!«
Die Ladeklappe scheppert laut. Seine Worte: »Zum Glück liegt die Bude im ersten Stock«, gehen im Lärm unter.
Oben, als er auf John Hein trifft, besinnt sich der Mann darauf, weswegen sie gekommen sind, und fragt: »Hast du Trauer oder so?«
»Na vielleicht«, entrüstet John sich, wie er es gewöhnlich tut und er meint damit, das hätte ihm gerade noch gefehlt. »Meine Mutter ist zum Pflegefall geworden. Ich hab sie im Altenheim untergebracht.«
»Na, das ist doch ’ne Lösung!«
»Endlösung. Sie weiß es nun noch nicht!«, dröhnt seine Stimme durch die Räume, die ohne Gardinen und jeglichen Zimmerschmuck, aber vollgestopft mit Kisten und Bündeln einen hässlichen Anblick bieten.
Der überflüssigen Floskeln waren es damit genug, die Männer wollen keine Zeit verlieren. Zuerst tragen sie das schwere Möbel über die Treppen nach unten. Der dritte Mann führt Regie und lässt sich von Zeit zu Zeit eine der gepackten Kisten oder ein weiches Bündel reichen, je nachdem, ob es etwas zum Abpolstern gibt oder zum Füllen von Zwischenräumen.
Mitten auf der Treppe bricht von einer der Kisten der Boden durch. Klirrend stürzt der Inhalt die Treppe herunter und der Träger hat Mühe, noch festen Tritt zwischen all den Utensilien zu behalten, die verstreut herumliegen. Ein Fluch hallt von den kahlen Wänden. Mühsam beginnt er ganze Berge von Besteck einzusammeln, auf dessen Vollständigkeit Irma Hein immer großen Wert gelegt hatte. Zu guter Letzt ramscht er die vielen silbernen Messer, Gabeln, Löffel, Suppenkellen, Zuckerzangen und Tortenheber — alles durcheinander — wahllos in ein großes Tuch.
»Was macht eine alte Frau mit so viel Messern und Gabeln?«, zetert er.
»Vielleicht Gabelstapeln«, feixt der dritte Mann, der den edlen Intarsientisch aus dem Intershop, den Piet seiner Mutter vor zwei Jahren geschenkt hatte, vorsorglich in eine weiche Decke hüllt und behutsam beiseite stellt. Solch gute Stücke gehen nicht dorthin, wo diese Fahrt heut enden soll, bei allem guten Zweck, den Gebrauchtwaren erfüllen.