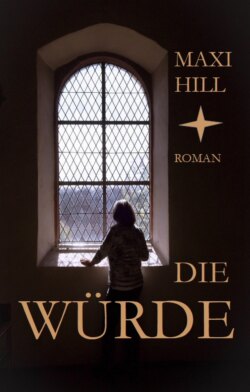Читать книгу Die Würde - Maxi Hill - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Treffen
ОглавлениеBettina Zonn löffelt einen Eiskaffee. Immer wieder schielt sie durch den luftigen Stoff der halbhohen Gardine auf die belebte Straße. Der Keks, der gewöhnlich das Erste ist, was sie zwischen ihre rot gefärbten Lippen schiebt, liegt zerbröselt auf dem Tablett. Sie ist nervös. Dieser Dienst bringt sie noch um. Wer kann das aushalten — tagein, tagaus nur Alte und Gebrechliche, sabbernde Münder und stinkende Ärsche. Nein, alt möchte sie nie werden. Wenn der Docht des Lebens runtergebrannt ist, will sie gehen, sang- und klanglos. Diese Unwürde könnte sie nicht ertragen. Bettina ist außerstande, ihre Hände ruhig zu halten. Der Krach mit der Schenck, ihrer Chefin, liegt ihr noch im Magen. Es ist einfach zu wenig Personal da. Sie kommen gerade zu den notwendigsten Dingen; Waschen, Betten machen, Verbände und Katheter legen. Schlimm. Noch schlimmer: Sie vom Personal sind nicht die Einzigen, die über diese Missstände Bescheid wissen. Peinlich bei ihrem Ethos, der Mensch stehe im Mittelpunkt. Bettinas Lippen verziehen sich schräg. Wenn ihr früher jemand gesagt hätte, dass sie jedes Mal beten würde, es möge nichts passieren, wenn sie allein Nachtwache hat, hätte sie ihn schallend ausgelacht. Heute betet sie, nicht richtig zwar, nur eben so, wie man flehentlich hofft. Nur weiß sie nicht, für wen sie fleht, für wen sie hofft. Für sich, um sich Aufregung vom Leib zu halten? Für die Alten, um denen Leid und Ängste zu ersparen? Einer alleine für so viele Alte ist Irrsinn und der wiederum entwickelt sich zur Regel. Trotzdem geht es ihr noch besser als ihrer Freundin Fanny auf der Intensivstation im Krankenhaus. Tauschen möchte sie mit der nicht. Dort sterben sie auch alle naselang, aber einen Unterschied gäbe es dabei, sagt Fanny: Für sterbende Patienten kostet eine Stunde Lebenserhaltung mehr als das Monatsbudget für einen Pflegefall im Heim. Ist das gerecht?
Die Stadt liegt grau und düster. Sie sieht es nicht, sie kennt es nicht anders. Das schöne Stadtzentrum mit der Hauptkirche lag einst östlich der Neiße, das haben ihr die Alten erzählt. Es sei zerstört von den darüber hinweg rollenden Panzerarmeen und den abräumenden Russen danach. So etwas vergessen die nicht, ihre Alten. Wenn man denen aber sagt, sie sollen sich schon mal ausziehen, wenn man sie waschen will, das vergessen sie gleich wieder, noch ehe man den Satz zu Ende geredet hat.
Nicht weit vom Café entfernt, die Straße ein Stück ostwärts, dort an der Grenze hat Simon jetzt Dienst. Schenkt sie ihm Glauben, ist sein Dienst noch stressiger als ihrer. Am schlimmsten sei es gewesen, als der visafreie Reiseverkehr aufgehoben wurde. Das hätten die aufständischen Polen verursacht, dieser Walesa mit seiner Solidarnosc. Jaruzelski habe über das Land Kriegsrecht verhängt, um die kommunistische Herrschaft zu erhalten. Wahrscheinlich wären sonst die Russen einmarschiert. Das alles erzählt Simon und noch viel mehr. Das meiste ist lange her, neun Jahre und länger. Es kümmert sie nicht, sie findet es schlimm genug, dass sie sich dauernd so etwas anhören muss. Lieben und Reden sind ein jämmerliches Gespann. Wenn dieser Jumbo dabei redet, versteht sie es wenigstens nicht. Simon aber sagt, vielleicht wären ohne den ganzen Stress noch mehr Polen hier. Wenn es nach ihr ginge, könnten die alle bleiben, wo der Pfeffer wächst. Im Kombinat sollen es zweitausend sein, die dort arbeiten. Manche von denen gehen täglich über die Grenze zurück, andere aus dem Landesinneren bleiben die ganze Woche hier, in einem Wohnblock in der Oberstadt, genau wie Waclaw und Oxana. Wären die Polen und die Tschechen nicht, müsste sie todsicher noch öfter Nachtdienst schieben. Das weiß sie nur zu gut. Wenigstens das hat die Schenck im Griff. Nachts muss ja keiner mit den Alten reden, da können die Polen ruhig Wache halten. Bei Tage muss man zu viel reden mit den Alten …
Ein Farbklecks huscht durch das graue Bild. Das war er, dieser Typ von Samstagabend, denkt sie. Schon klappt die Tür hinter dem Windfang aus dicken Pferdedecken.
Amadou tritt ein, blitzschnell huschen seine Blicke durch den Raum, niemand sieht, wie scheu die Augen an einer Stelle verharren, wie er zögert, doch dann tänzelt er zum Tisch am Fenster und fragt wie beiläufig:
»Ist der Platz noch frei?«
Die Frau bewegt nur eine Hand und nickt. Auch sie tut wie er, als sei niemals dieser gewisse Abend gewesen, niemals sein Bekenntnis über die kleine Schwester und niemals ihr Zwinkern, das ihn warten ließ, bis die Zeit ihrer dahin gehauchten Bemerkung gekommen war.
»Ich bin Ricardo«, sagt er mit gutem Grund. Es ist genug, wenn seine Landsleute ihm einen Spitznamen verpasst haben. Amado – Der Verliebte. Was sollte diese Nsamba von ihm denken? Er spürt beim ersten Blick, dass diese Frau es nicht verstehen würde.
»Betty«, sagt sie ein wenig forsch. »Beinahe wäre ich wieder abgezischt. Ich habe mich mit gewissen Unannehmlichkeiten herumzuschlagen, da fehlt einem die Geduld …«
Er schaut sie an, doch er hört nicht hin. Nur eines bleibt haften — Betty. Die helle Haut macht sie noch schöner als Nsamba, noch zarter, und er ist ihr so nah, so nah, dass er sie riechen kann. Sie riecht sehr gut, besser, als ihre trotzige Sprache klingt. Ein peinliches Gefühl kriecht ihm die Kehle hoch, lässt ungesagte Worte sterben und ganz andere gebären, die er nie hätte herauswürgen sollen.
»Verzeihung. Wir haben ein wichtige Konferenz.«
»Sie hatten eine wichtige Konferenz?«, verbessert sie ihn, er aber hörte nur die Frage, nicht die Feinheiten in der Sprache.
»Ja. Wir machen neue Produktionslinie. Ich Ingenieur.«
»So?«
Amadou zuckt zusammen. Eines hatte er nicht bedacht. Sie könnte selbst im Kombinat arbeiten und bekäme den Schwindel ganz leicht heraus. Vielleicht muss er jetzt seine Hoffnung auf das Gefühl von Geschwisterliebe wieder begraben?
»Merde«, presst er lautlos in sich hinein. Dieses Wort kommt ihm am leichtesten von der Zunge. Amadou streckt seinen Kopf erhaben in ihre Richtung. Er ahnt, diesmal hat sie das Nachsehen, was das Verstehen betrifft. Sowie er sieht, dass ihre Augen sich weiten, wie ihr Mund sich spitzt, fasst er endlich Mut, auf den wahren Kern seiner Absicht zu kommen.
»Ich allein hier lebe, und aussehen wie meine Schwester Nsamba. Ich habe — wie sagt man — vergucken?«
»Verknallt«, lacht Bettina und sieht ihn an, wie ein Erwachsener auf ein Kind schaut. Danach ist auch ihre Sprache milder, angenehmer.
»Wollen Sie nichts bestellen?«
Sie gibt der Serviererin ein Zeichen und reicht Amadou provokant, aber mit breit gezogenen Lippen die Karte. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, denkt Amadou. Noch kann er bei der Frau weder Widerwillen noch überschwängliche Freude erkennen. Nicht der kleinste Zweifel scheint sie zu befallen. Er bestellt einen Tee und redet so gut er kann über das Wetter, was dasjenige sei, das er am meisten hasse in diesem Land.
Die Unterhaltung fließt zäh. Zum Glück hat Bettina sich noch einen heißen Kaffee bestellt und so füllen sie die Pausen mit trinken und rühren. Für das, was er ihr gerne sagen würde, gibt es keine Worte. Er kennt keines. Keines das sie verstehen würde, sie ist ja nicht Nsamba. Nur ein einziger Satz geistert in seinem Kopf herum. Des Nachts hatte er Tausende Male gegen die kahle Zimmerdecke geraunt, bis er ihm flüssig und fehlerfrei von den Lippen rutschte. Doch für diesen Satz ist die Zeit noch nicht reif.
»Trinkt man im Kaffeeland lieber Tee?«, fragt sie mit eigenartig schläfrigem Blick.
Amadou, tief gebeugt über dem dampfenden Glas, schüttelt seinen Kopf, hält ihn schräg und schaut von unten zu ihr auf:
»Kaffeeland?« Er richtet sich auf, streckt sich locker. »Angola hat Krieg, man sagt, wegen Öl, wegen Diamanten. Nicht Kaffee. Reichtum ist auch Fluch. Bei uns für Menschen zu wenig bleibt über.«
Über diese Worte muss Betty ein wenig nachdenken. Vielleicht weil sie so fremd klingen. Vielleicht, weil sie mit dem anderen Typen, mit dieser Dampframme, nie über sein Land gesprochen hat. Nie. Warum eigentlich? Weil sie mit ihm fast nie spricht.
»Wenn ich Afrika höre, denke ich nur an Katastrophen, an Hitze und an Trockenheit. Und an die Wüste…«
Amadou lacht.
»In Angola es gibt nur kleines Stückchen Wüste, ein Stück Namib.«
»Ich kenne mich in der Geografie nicht aus, ich würde Angola auf der Landkarte nicht finden. Aber was ich von guten Freunden so höre …« Betty hebt eine Hand und dreht ihre Finger wie einen Fächer vor ihrer Tasse hin und her. »Ist es eigentlich wahr, das mit dem Lynchen?«
Amadou zögert. Er weiß nicht, was für gute Freunde sie hat, er weiß nur eines: Auf eine solche Frage antwortet man nicht, eine solche Frage ist verletzend. Doch er weiß auch, wenn er ihr das sagt, sieht er sie nie wieder.
»Es kommt vor«, stammelt er. »Manchmal es ist gerecht.«
»Ist der Tod gerecht?«
»Schreckt ab vor Bösem.«
»Jeder Tod, den Menschen andern Menschen aufzwingen, ist unwürdig.«
»DDR hatte lange Strafe von Tod.«
Betty reißt ihre Augen auf, kann nicht verstehen, ob er es wissen will, oder ob er sich dessen sicher ist. Von der Todesstrafe in der DDR hat sie noch nie etwas gehört.
»Ist kein Unterschied, ob Gesetz oder nicht Gesetz. Tod ist Tod. Mein Land nicht ist schlechter als Deutschland«, sagt er, während Bettys Gedanken der Bewegung des Löffels folgend in der Kaffeetasse rotieren. Er schweigt. Ist er zu weit gegangen? Klagen seine Worte an oder kann diese Frau erkennen, wie sehr er sein Land liebt?
Seine Augen werden feucht, die Bilder vor ihm verschwimmen. Das braune Laub an den Bäumen vor dem Haus formiert sich zu Wedeln, zu schönen grünen Palmenwedeln. Der heiße Wind treibt ihm den Schweiß auf die Stirn. Nsamba kommt atemlos gelaufen, nimmt ihn beim Arm und flüstert ihm zu: »Dein Antrag ist zurück. Komm, lies selbst.«
Das war ein glücklicher Tag und ebenso aufregend wie dieser.
»Sie haben Sehnsucht nach Ihrer Heimat, oder?«
Amadou fährt zusammen. Sie hat eine Hand auf seinen Arm gelegt, eine weiße Hand auf seiner dunklen Haut. Was bringt ihn nur so durcheinander? Jetzt lächelt sie sogar. Niemals würde er dieses Schütteln spüren, wenn ihn Nsamba berührt, niemals das Frösteln unter der Haut. Er würde Wärme spüren, Zufriedenheit und Ruhe. Alles das spürt er nicht und er hat Mühe zu begreifen, warum.
»Sie sind nicht besonders glücklich hier, oder?«
Immer dieses oder. Was bedeutet es? In den Büchern von Günther steht nirgendwo ein oder hinter einer Frage.
»In deutsches Buch ich habe gelesen, die Absicht, dass Mensch glücklich ist, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten.«
Die Frau reißt ihren Kopf so heftig herum, dass die Haarkringel auf dem Hinterkopf wippen. Aus ihrem Mund, einem kindlich unschuldigen Mund, erfährt Amadou die ersten anerkennenden deutschen Worte. Er hatte von anderen gehört, dass es Deutsche gäbe, die nett und höflich zu seinesgleichen sind, aber gesehen mit eigenen Augen und gehört mit eigenen Ohren hatte er diese Nettigkeit noch nie. Mit einer Ausnahme —Günther.
»Sie sind mir ja einer«, kichert Betty. Es war das gleiche Kichern wie damals vor dem Schaufenster. Ihre Wangen glühen, ihre Augen blicken um einiges freundlicher, um einiges argloser, als sie schwärmt: »Ist das vielleicht Klasse. Das muss ich gleich morgen meiner Chefin unter die Nase reiben. Super, einfach super.«
Die Frau lacht, doch sie schaut dabei schon das dritte Mal auf ihre kleine, mit winzigen Zeigern versehene goldene Uhr. Zwischen den Worten über das Kreuz, das man mit den Chefs zu tragen habe, spürt man die Unruhe in ihr und bald drängt sie zum Aufbruch. Jeder zahlt für sich, auch wenn die Frau noch so zögert, Amadou bemerkte es gar nicht. Inzwischen wird ihm klar, es könnte das erste und das letzte Mal gewesen sein, dass er und sie gemeinsam...
Jetzt ist sie gekommen, die Zeit für seinen Satz.
»Ich fände es gut, wenn wir uns einmal wieder sehen.«
Die Frau stutzt. Sein Deutsch war beinahe korrekt. Sie streckt ihre Hand aus und lächelt seltsam schräg:
»Ich auch – Gute Nacht!«
»Wo?«
»Was wo?«
Immer wenn die Frau ihren verträumten Augen diesen eigentümlichen Ausdruck gibt, verscheucht sie seine Erinnerung an Nsamba.
»Wo wir sehen uns?«
Die schöne Frau tritt ganz dicht an ihn heran. Der Geruch von Moschus steigt in seine Nase, die Wärme ihrer Haut kitzelt die seine. Der Wimpernkranz ihrer schläfrigen Augen verengt sich zu einem winzigen Spalt, als sie flüstert:
»Das mit deiner Schwester war nur eine Finte?«
Amadou senkt seinen Kopf. Wie das Blut ihm in die Schläfen stürzt, darf sie nicht sehen, das Pochen muss er ignorieren. Je länger er sie anschaut, umso verwirrter dreht sich ein Wort in seinem Kopf: Finte. Verdammt, was ist eine Finte? Lüge war es jedenfalls nicht, aber was sie vermutlich meint, das war es auch nicht. Amadou gesteht sich kein noch so geringes Zeichen einer inneren Erregung ein, kein anderes als das gewöhnliche Zeichen seines Heimwehs und seines unbändigen Willens, wenigstens jemanden wie Nsamba in seiner Nähe zu wissen. Zwar brodelt eine Unruhe in ihm, verschüttet in dem Wirrwarr nächtlicher Träume von Esperanza, das aber kann sie nicht sehen, nicht spüren, auch wenn sie noch so ihre müden Augen verdreht Nsamba hat immer wache, immer fragende Augen. Im Nu verblasst Nsamba an seiner Seite und das Heute schleicht sich ein in die unendlichen Abgründe seiner Zweifel, das Heute in Gestalt dieser Betty.
»Nein. Aber wenn Du ‚Sie’ sagen, das ist Finte. Für Menschen hier wir sind nur Dreck. Zu Dreck man sagt nicht Sie.«
Sie schaut ihn an, zum ersten Mal wohl richtig. Das Gemisch aus Stolz, Trotz und Traurigkeit in seinen Augen hat etwas Erotisches, etwas, was nur ganz besonderen Männern eigen ist, Männer mit dunkler Hautfarbe und Männern, die das Leben aus der Bahn geworfen hat.
»Komm mit«, sagt sie. Ihre Blicke aus verkniffenen Augen wandern an ihm herab und wieder hinauf zu den blitzenden Augen im tiefschwarzen Gesicht. Irgendetwas beginnt aus ihm herauszutröpfeln. Sein Mut? Sein Lebensgeist? Wenn er doch jetzt einfach gehen könnte zu Eduardo und Silva. Er geht nicht, seine Gedanken sind hier bei der fremden Frau, die mit einer Stimme flüstert, weich und doch sehr bestimmt: »Na komm schon.«
»Wohin?«, flüstert auch er.
Sie legt einen Finger über ihre leicht verschmierten Lippen: »Ich dachte, du willst es.« Auf ihrem fleischigen Gesicht liegt ein Ausdruck von Belustigung, auf ihren weichen Lippen ein winziges Schmollen.
Sie verlassen das Café gemeinsam, sie gehen die Straße entlang. Er läuft neben ihr wie in Trance, kann nicht verstehen, was sie vorhat. Sie warten gemeinsam an einer Bushaltestelle und reden über belangloses Zeug, an das sich Amadou nach diesem Abend, nach dieser Nacht, nie wieder erinnern wird, zu unwichtig wird es für ihn sein. Nach dieser Nacht nimmt sein kleines Leben eine unverhoffte Wendung. Er war doch nur von der großen Hoffnung beseelt, weil ihn zu viel Heimweh für kurze Zeit aus der Bahn geworfen hat. Dieses Heimweh hat ihm die Bekanntschaft mit einer weißen Frau beschert. Das aber, was ihm heute Nacht geschehen sollte, hatte er in seinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Nein, so kühn zu träumen hätte er niemals gewagt!
Zu denken war er nicht fähig. Zu wünschen, dass alles nur ein Traum sei, aus dem er erwachen könne und ihm nichts bliebe als die Erinnerung an diesen Traum, verbot er sich. Zu unverhofft war der Traum gekommen und zu überraschend war er ausgegangen.
Er hat Mühe, seine Mundwinkel ruhig zu halten, ohne genau zu wissen, warum sie so wild zucken und die Nasenflügel sich blähen, als er durch die Morgendämmerung den Weg zu Fuß geht, den er sonst mit seinen Freunden im Werksbus fährt.
»Es ist keine Schande«, murmelt er immer wieder.
Es ist noch zu früh für die Schicht, aber zu spät, noch bis zur Unterkunft zu fahren. Peinliche Fragen kann er jetzt nicht gebrauchen. Er wird ihnen sagen, ihm sei übel geworden und man habe ihn über Nacht auf der Bahnhofsmission behalten, bis es ihm besser ging. Ja, das wird er sagen. Das hat auch Oscare schon einmal gesagt, dieser Schakal.
»Es ist keine Schande«, macht er sich Mut, jetzt, wo der kalte Wind in die offene Jacke bläst, bis zur Haut durchdringt. Jetzt, wo er wieder nüchtern überlegen kann und die Dinge so sieht, wie sie sind; es ist keine Schande, denn es geschah nicht mit Nsamba, sondern mit Betty.
»Betty«, haucht er durch die zitternden Lippen. Seine Haut friert, doch in den Lenden brodelt es noch heiß, fast wie damals bei Esperanza.
Den ganzen Tag über kann er an nichts anderes als an Betty denken. Er fühlt sich zu unerwarteter Höhe erhoben. Seine Stunden vergehen wie Tage, die Tage wie Wochen. Immer wenn er bemüht ist, besonders aufmerksam seine Arbeit zu machen, irren seine Phantasien hinweg, weg zu ihr, weg zu diesem Zufall, den er ein Wunder nennt. Er schiebt Karren mit giftigem Granulat vor sich her und sieht Betty. Er beschickt ätzend stinkende Zentrifugen, heute macht ihm das nichts aus, er riecht nur Betty. So, wie er sich völlig verliert in der Erinnerung, macht es ihn ganz rasend, weil er manches Wort nicht kennt, das sie benutzt hatte. Er muss noch besser diese Sprache lernen. Gleich heute wird er sich darum kümmern.
Seine Gedanken an diese Nacht verlieren sich langsam in der gleichen Dunkelheit, in der alles geschehen war. Aber dieses Gesicht, das Gesicht seiner Schwester Nsamba, das auch bei Dämmerlicht auf Betty hört, das verfolgt ihn. Es flüstert mit ihm und es tobt wie wild. Es flüstert »Ricardo« - so zuckersüß; ach, was hätte Amadou für einen zuckersüßen Klang gehabt. Sie küsst ihn und sie beißt ihn, sie kneift ihn und sie kichert leise. Dann weint sie an seiner Brust. Warum hat sie geweint? Amadous Lippen straffen sich, die Lider zucken, dann ist es wieder da, das Bild, das er verdrängen wollte. Diese helle Haut, sogar im Dunkeln war sie noch hell. Ein dumpfes Gefühl drückt ihm die Kehle zu.
Wenn sie weint, weil der Mann, mit dem sie über die Tanzfläche gelaufen kam, ihr Mann ist, dann wird der mich lynchen.