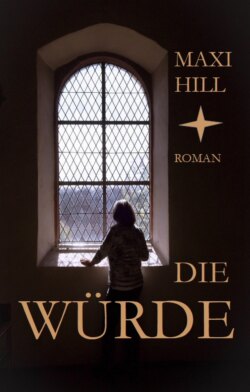Читать книгу Die Würde - Maxi Hill - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Toni Hein
ОглавлениеDie afrikanische Sonne brennt erbarmungslos auf der Haut, ihr Gesicht ist braun gebrannt, ihre feuchten Augen rötlich, das dunkle Haar glänzt im Gegenlicht des ewigen Sommers. Sie spürt das alles nicht mehr. In Gedanken vertieft tritt sie vom Balkon zurück ins Zimmer. Drinnen erscheint es dunkler als es ist. Das Licht des grellen Tages hat die Pupillen verengt. Beinahe schrickt sie zusammen, als ein Schatten sich nähert. Es ist Piet. Mit einem zufriedenen Lächeln drückt er ein paar Briefe an seine Brust, als er Toni flüchtig umarmt. Längst hat er sich blitzschnell umgesehen, wie immer, wenn er nach Hause kommt.
»Gib nicht schon jetzt alles aus der Hand. Wer weiß, wie lange wir diesmal hier hängen bleiben.«
Gelegentlich hat sie den Eindruck, sie sei auch in den Augen ihres Mannes nur noch die Hausfrau. Wie konnte er anders denken? Es gab kaum eine Entscheidung, die sie allein traf, solange sie in diesem Land waren. Immer hatte sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, immer hatte sie sich seiner Meinung gebeugt, weil es etwas gab, das sie ums Verrecken nicht aufgeben wollte und das, wenn es publik geworden wäre, auch ihm Scherereien eingebracht hätte. Die heimlichen Besuche bei Ntumba waren verboten, der bairro war verbotenes Gebiet.
»Ich weiß«, entfährt es ihr ein wenig zu heftig. Seine Mahnung hatte etwas in ihr berührt, was sie seit langem verdrängt. Schon einmal waren sie hängen geblieben. Schon einmal sind Dina und Thom zu Hause beinahe verzweifelt, als die Eltern erst Wochen später ihren Urlaub antreten konnten, weil der Krieg sie gehindert hatte. Was würde sein, blieben sie diesmal ganz hängen. Es ist Krieg und der ist unberechenbar. Gerade an Dina wollte sie jetzt nicht denken, nicht so jedenfalls. Sie schaut Piet an und sieht sein Schmunzeln auf den Lippen und die Briefe in seiner Hand. Er nimmt ihr also den kratzigen Ton nicht übel, er weiß nur zu gut, wie sehr sie unter der Trennung von ihren Kindern gelitten hat, mehr als er. Doch er weiß auch, wie viel sie hier noch gerne erledigen würde für die Menschen, die sich an ihre Hilfe gewöhnt hatten. Er muss verstehen, dass sie es nicht erwarten kann, ihr Hab und Gut zu verteilen.
»Haben wir noch Zeit für die Post?«, fragt er.
»Klar«, sagt sie und greift rasch nach den Briefen, die, so lange wie sonst nie, unbeachtet geblieben sind. Für gewöhnlich wird die Post hastig geöffnet und hastig gelesen. Später lesen sie dann noch einmal Wort für Wort, Zeile für Zeile in Ruhe. Flink gleiten vier Briefe durch ihre Finger. Den einen von Dina schiebt sie auf ihren Schoß, einen anderen, den von Schwager John, reicht sie Piet. Die anderen haben Zeit. Dann herrscht gespannte Stille im Raum, nur das Hupen der donnernden Lastwagen auf der holprigen Straße vier Stockwerke unter ihnen hält Toni davon ab, ihre Gedanken locker zu lassen. Sie schließt die Balkontür und wirft einen Blick auf das Foto im Schrank, Dinas junges Gesicht, ihr Lächeln mit traurigem Blick. Sie ist entschlossen, ihre Nerven zu zügeln, der nächste Antwortbrief wird der letzte sein, für immer. Hoffentlich.
Neben ihr im Sessel atmet Piet beschwerlich. Seine Stirn glänzt feucht, er wischt mit dem Handrücken den Schweiß ab. Nein, müde sieht er nicht aus, eher zornig, allenfalls besorgt. Für eine Weile lehnt er sich zurück, doch mit einem Ruck reißt er sich hoch, seine Augen werden scharf, bitter. Mehr beiläufig als interessiert fragt sie ihn:
»Gibt’s was Besonderes?«
»Mutter liegt im Krankenhaus. Die Spritzenschwester hat sie gefunden… Morgens halb sechs lag sie auf dem Bettvorleger…«
Toni lässt den Brief ihrer Tochter auf den Schoß sinken. Die neue Zuversicht, die neue Vorfreude auf daheim weichen fragenden Augen. Sie wartet auf eine Erklärung, ein, zwei Worte mehr wenigstens. Dazu ist Piet nicht bereit, nicht in dieser Minute. Erst als Toni den Brief ihres Schwagers liest, wird ihr klar, was Piet bedrückt.
Seit sein Vater tot ist, würde Mutter Irma auch ihren Sohn Piet dringend brauchen. Er aber ist hier am 15. südlichen Breitengrad. Er kann ihr nicht helfen, noch nicht. Wie gut, dass John noch in der Heimatstadt lebt, und — wie er schreibt — opfert er sich auf, tut mehr als ein Mann ertragen kann. Seine Worte aber, »…es muss etwas passieren, ehe etwas passiert«, klingen wie ein Vorwurf, wie ein letztes Mahnen: Komm endlich nach Hause! Es gibt kaum einen Menschen, der dieses Gefühl besser kennt als Toni. Sie lebte ständig mit schlechtem Gewissen, weil sie ständig in der Fremde lebte. Sie war mit Piet in die Großstadt gezogen, hatte dort ihre Arbeit und ihre Familie und später das fünfjährige Studium. Für ihre Mutter war wenig Zeit. Die Reue war immer da, aber die traf sie doppelt, als Mutter früh starb.
»Hol sie zu dir. Du warst doch immer ihr Liebling.«
Tonis triumphierender Ton stört Piet, doch für Rechthaberei hat er nichts übrig. Seine Traurigkeit, so weit weg zu sein, würde Toni ihm sowieso nicht glauben. Für sie scheint er ein emotionaler Eiszapfen zu sein.
»Einen alten Baum verpflanzen? Das geht nicht gut«, sagte er wie zu sich selbst. Sein Kopf wiegt leise hin und her, doch der Blick bleibt starr. »John ist da und ihre Freundinnen.«
»Freundinnen«, wiederholt Toni und lässt ihre Stimme in der untersten Oktave der Abfälligkeit versinken. »Die kommen doch nur zum Kaffeeklatsch. Was Mutter braucht, ist nicht nur Unterhaltung. Sie braucht vor allem Hilfe, Pflege und natürlich auch Zuwendung.«
»Ich weiß, aber John kümmert sich und Lucie und Marga besuchen sie oft.«
Hat es Sinn, mit ihm über die Empfindung seiner Mutter zu reden? Über die Katastrophe, die Erwins Tod in ihr hinterlassen hat? Nie hat sie einen leisen Gedanken daran bei Piet gespürt, und nun mutiert er plötzlich zum Alterspsychologen?
»Heißt das, du lehnst es ab, dich um deine Mutter zu kümmern?«
Piet verharrt regungslos, nur seine Wangenmuskeln verhärten sich und hüpfen auf und nieder. Sie sieht genau, was ihr Tonfall in ihm auslöst. Er lässt seine Knie wippen und schnaubt verächtlich:
»Warum musst du immer so überziehen? Ich lehne es nicht ab, aber ich habe kein Recht, über sie zu bestimmen. John hat sich die letzten Jahre über um sie gekümmert. Er wird wissen, was das Beste für sie ist. Aber noch ist Mutter in der Lage, selbst zu bestimmen, was sie will. Nur das müssen wir respektieren und dann bin ich der Letzte, der etwas ablehnt.«
Plötzlich ist eine knisternde Spannung im Raum — lange Blicke, angespannte, starre Muskeln. Worte, die ungesagt bleiben und jeden Ansatz von Vernunft blockieren.
»Sie muss ja nicht direkt bei uns wohnen. Vielleicht in unserer Nähe. In unserem Block. Es gibt viele kleine Wohnungen. Irgendwann wird schon eine frei werden.«
Piet schaut weg, schüttelt den Kopf und schweigt. Solche Gespräche haben nie gut geendet. Noch vor zwei, drei Jahren hätte es solche Gespräche nicht einmal gegeben. Noch vor zwei, drei Jahren hätte Toni klein beigegeben, weil sie den Schlagabtausch, der immer einsetzte, wenn sie nicht nachgab, als Verrat an ihrer Ehe verstanden hätte. In diesem Land ist sie klüger geworden, spät, aber nicht zu spät. Hier hat sie das Aufbäumen gelernt, nicht gegen ihren Mann, beileibe nicht. Aber hier hat ihr das Aufbäumen geholfen, nicht die Selbstachtung zu verlieren. Freilich hatte ihr Eigensinn ihn erschreckt. Ihren heimlichen Gängen in den bairro hatte er aus gutem Grund nicht zugestimmt. Jetzt aber sieht sie nichts, was sie verstehen könnte.
»Es geht mich nichts an, es ist deine Mutter. Für meine Mutter musste ich immer alleine entscheiden.«
Sie ist überzeugt, dass es so war, aber genau weiß man ja nie, wie der andere handeln würde, wenn man ihn zu handeln aufforderte.
»Warum sagst du so etwas?«
»Weil ich es so empfunden habe. Darum. Und weil die Zeit einmal kommt, wo man zurückgeben muss. Aus Dankbarkeit…«
Der Satz bleibt in der Luft hängen. Die beiden schweigen eine Weile - im Raum ist nur ihr Atem ist zu hören.
Sie kann sein Gesicht nicht sehen und es macht ihr Mühe, den Überblick zu behalten, wenn sie sein Gesicht nicht sieht.
»Was weißt du von meiner Dankbarkeit für meine Mutter!«
Das war keine Frage, das war nicht einmal Schelte. Sie spürt genau, wie er sich in fernen Erinnerungen verliert und irgendwann, nach endlosem Nachdenken sagt er plötzlich in die Stille des Raumes hinein:
»Was habe ich zeitlebens die erwartete Dankbarkeit gehasst.«
Vor ihren erschrockenen Augen beginnt er irgendjemanden nachzuäffen und hebt seine Stimme höher als gewöhnlich: »Wir tun mehr für Euch, als Kinder verlangen dürfen!« Und dann senkt er die Stimme tiefer als gewöhnlich. »Ob wir uns über etwas gefreut haben oder nicht, wir mussten ihnen immer danken und wir haben ihnen immer gedankt.«
Inzwischen weiß Toni nicht mehr, was sie ihm eigentlich übel nimmt, die Art wie er spricht, die Worte, die er wählt. Manchmal kennt sie ihn nicht, kennt sich selbst nicht.
Toni erhebt sich ein wenig zu rasch. Sie reißt die Tischdecke aus der Schublade und befördert sie schwungvoll auf den großen Esstisch in der Ecke des Zimmers. Mit stampfendem Schritt eilt sie in die Küche. Erst an der Tür lässt sie die kratzigen Worte heraus:
»Dankbarkeit ist etwas anderes als das Wort Dankeschön.«
Wie stets will sie ihm nicht zu nahe treten und wie stets, wenn sie freiwillig das Feld räumt, will sie nicht mehr über ein Thema sprechen. Es ist eine Art Schutz, ehe sie die Achtung verliert.
Er hatte keine Chance, etwas zu erwidern. Sie bleibt länger als nötig in der Küche und kommt mit dem dampfenden Essen und erstaunlich fröhlicher ins Zimmer zurück.
»Was sagst du nun? «
Es war ein Glück, dieses Fleisch erstanden zu haben, und dieses Glück gilt es zu sehen, nichts sonst.
Erst am Abend, als ihre Gemüter sich wieder beruhigt haben und die Kerzen ihnen jene Hilflosigkeit erhellen, in die man schuldlos geraten kann, erst dann finden ihre Gedanken noch einmal zurück zu dem Brief von John und dem, was die Zukunft noch bringen kann.
Es ist amüsant, wie Piet sich müht, seine ganze Güte nach außen zu kehren, sieht er einen Fehler ein. Zu sagen, »Liebling, du hast Recht«, käme ihm nie über die Lippen. Wenigstens hätte er doch sagen können, man müsse darüber sprechen oder man könne es Mutter Irma vorschlagen. Stattdessen sagt er: »John hat seinen Nutzen davon. Jeden Gang, jede Fahrt mit dem Auto bezahlt sie ihm. Ein schönes Taschengeld, und wer weiß, vielleicht …«
»Er ist doch weiß Gott nicht darauf angewiesen«, fällt sie ihm ins Wort.
»Du weiß, wie Erwin uns immer etwas aufgedrängt hat. Jetzt wird sie es tun, und er wird es nehmen, so wie wir es genommen haben.«
Selbstverständlich nimmt Piet ihre Worte als Kritik:
»Kennst du einen Menschen, der kein Geld braucht?«
Hat er von Geld gesprochen? Geld, Geld! Alle reden nur von Geld und nun auch Piet. Liegt es daran, weil sein Bruder John denkt, sie kämen als Schwerreiche aus dem Armenhaus der Welt zurück? Was glauben die nur alle? Wegen der paar Forumschecks wird man schief angesehen.
Das alles geht ihr so ungeordnet durch den Kopf, dass sie beinahe den Faden verliert.
Die Lampe flackert, der elektrische Strom ist wieder da und hält ihn davon ab, über ihre Einmischung empört zu sein. Noch während er kunstgerecht die Dochte der Kerzen aufrichtet, damit sie nicht im Wachs ertrinken, fressen ihre Worte an seiner Seele. Er weiß, auch Irma hält ihn für undankbar, nur weil er diesem Auftrag gefolgt war. Wer ist ihm denn für dieses Opfer dankbar und überhaupt: Steht die Dankbarkeit jedem auf der Stirn geschrieben? Niemand konnte schließlich wissen, dass es Vater Erwin dahinraffen sollte und Irma die Lebenslust verlieren würde. Es könnte ihr noch gut gehen, würde sie sich ein wenig mehr zusammennehmen. Wäre John nicht in ihrer Nähe, stellte sich die Frage anders, aber John ist da und er bemüht sich um Irma.
»Ich dachte immer, du magst Mutter nicht.« Das war keine Frage, das war kein Vorwurf, das war nichts als Rechtfertigung.
»Man muss nicht alle Welt mögen. Man muss nur wissen, was für den Moment wichtig ist. Hier war es Ntumba und zu Hause könnte es Mutter sein, die meine Hilfe braucht.«
Piet beugt das Gesicht unmerklich nach vorn, doch er schweigt.
»Kaum anzunehmen, das mit Irma könnte mich mehr Kraft kosten, als meine verbotenen Gänge in den bairro.«
Piets lauernder Blick huscht über den Brillenrand.
»Bedauerst du gerade, dass du Ntumba begegnet bist?«
»Nein. Ich habe von Anfang an gespürt, dass ich etwas anderes tun muss, als man von mir erwartet. Ich wusste nur lange nicht, was es hätte sein können.«
»Angola ist bald Geschichte, deine Familie aber behältst du für ewig.«
Toni zuckt unmerklich zusammen. Ja Geschichte, denkt sie, Geschichte ist unumkehrbar.
Das war ein solcher Moment, der ihr sagt, im Grunde sind sie sich immer einig, nur ihre Blickwinkel sind zuweilen verschieden. Bei ihm ist das Unrecht ein weißer Fleck im Schatten der Justitia, bei ihr ist das Unrecht der viel zu schwarze Schatten in den ausgemergelten, darbenden Gesichtern der Hoffnungslosen in den bairros auf der dunklen Seite der Welt, die man Sonnenseite nennt.