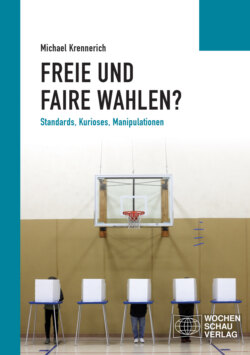Читать книгу Freie und faire Wahlen? - Michael Krennerich - Страница 10
2. WAS SIND „FREIE UND FAIRE“ WAHLEN?
ОглавлениеMit der Zunahme von Mehrparteienwahlen in Demokratien wie Autokratien stellt sich die Frage, wann Wahlen „kompetitiv“ oder „frei und fair“ sind. Versteht man „Kompetitivität“ nicht nur im engeren Sinne als reine Parteienkonkurrenz, sondern umfassender als Merkmal von Wahlen in Demokratien,34 dann sind die beiden Konzepte nahezu deckungsgleich und nicht einfach mit Mehrparteienwahlen gleichzusetzen. In beiden Fällen geht es darum, dass das allgemeine aktive und passive Wahlrecht sowie Vereinigungs-, Versammlungs-, Meinungsund Pressefreiheit rechtlich wie faktisch gewährleistet werden und dass die Kontrahentinnen und Kontrahenten gleichberechtigt und möglichst chancengleich um Wählerstimmen werben können. Auch müssen die Wahlberechtigten tatsächlich frei entscheiden können. Dazu muss die Stimmabgabe geheim sein und es darf im Vorfeld oder bei den Wahlen kein unzulässiger Druck auf die Wählerschaft ausgeübt werden. Eine korrekte, transparente und überparteiliche Organisation der Stimmabgabe, Stimmenauszählung und Dokumentation der Wahlergebnisse soll weiterhin sicherstellen, dass keine der kandidierenden Personen und Parteien bevorteilt oder benachteiligt werden. Wahlbeschwerden wiederum müssen neutral geprüft und geahndet werden. Auch ist wichtig, dass es sich um eine Wahlentscheidung auf Zeit handelt und das Wahlsystem nicht die Wählerentscheidung „auf den Kopf stellt“.
An solchen Kriterien für freie und faire Wahlen richten sich mehr oder minder deutlich auch die internationalen Standards aus, wie sie beispielsweise die Europäische Union (EU), der Europarat (CoE), die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit dem Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSZE/ODIHR), die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), die Afrikanische Union (AU) sowie die Vereinten Nationen (VN) an Wahlen anlegen. Entsprechende Prüffragen finden sich in Handbüchern zur Wahlbeobachtung internationaler Organisationen sowie in den Materialien vieler nicht staatlicher Organisationen, die wahlberatend tätig sind oder Wahlen beobachten.35 Sie betreffen den gesamten Wahlprozess – angefangen vom Wahlrecht und der Registrierung der Wahlberechtigten und der kandidierenden Personen und Parteien über den Wahlkampf bis zur Stimmenabgabe und -auszählung sowie der Behandlung etwaiger Wahlbeschwerden. Allerdings sprechen Wahlbeobachterinnen und -beobachter meist nicht mehr von „freien und fairen“, sondern von Wahlen, die internationalen (demokratischen) Standards genügen.
Freie und faire Wahlen
| Frei | Fair |
| Vor dem Wahltag | |
| Informations- und Meinungsfreiheit Versammlungsfreiheit Vereinigungsfreiheit Allgemeines aktives und passives Wahlrecht Allgemeine Registrierung der Wahlberechtigten Freie Registrierung von Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten | Keine Bevorteilung oder Benachteiligung von Wahlkontrahenten im Wahlrecht Unabhängige, transparente und neutrale Wahladministration Unparteiische Wahlkreiseinteilung Unparteiische Wahlinformationen Unparteiische Registrierung der Wahlberechtigten Unparteiische Registrierung von Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten Neutrale Haltung staatlicher Stellen gegenüber kandidierenden Personen und Parteien Gleichberechtigter Zugang für kandidierende Personen und Parteien zu öffentlichen Medien Gleicher Zugang für Wählerinnen und Wähler zu politischen und wahlbezogenen Informationen Kein Missbrauch staatlicher Ressourcen für Wahlkampfzwecke Unparteiische und transparente Parteien- und Wahlkampffinanzierung |
| Am Wahltag | |
| Möglichkeit für alle Wahlberechtigten, tatsächlich an den Wahlen teilzunehmen Geheime Stimmabgabe Keine unzulässige Einflussnahme auf oder Einschüchterung von Wahlberechtigten Friedliches Wahlklima | Möglichkeit zur Wahlbeobachtung Verständliche und neutrale Gestaltung der Stimmzettel Neutrale Hilfestellung für Wahlberechtigte, falls nötig Korrekte und transparente Ermittlung, Aggregierung, Dokumentation und Veröffentlichung des Wahlergebnisses Sicherer Transport von Wahlmaterial (Stimmzettel, Wahlurnen etc.) |
| Nach dem Wahltag | |
| legale und tatsächliche Möglichkeiten der Beschwerden gegen Wahlunregelmäßigkeiten, Manipulationen und Wahlbetrug | Unparteiische und rasche Prüfung von Wahlbeschwerden Komplette und detaillierte Veröffentlichung der offiziellen Wahlergebnisse Untersuchungen und Ahndung von Wahlrechtsverstößen |
Quelle: Krennerich 2004, angelehnt an Elklit/Svensson 1996, Elklit 2000a
Trotz aller Unterschiede im Detail besteht indes bemerkenswerter Konsens über die Kriterien bzw. Standards, die an demokratische Wahlen angelegt werden. Unterschiede treten eher bei der konkreten Beurteilung einzelner Wahlen auf. Besonders schwierig ist es, etwaige Unregelmäßigkeiten in den verschiedenen Phasen des Wahlprozesses zu gewichten und diese zu einer schlüssigen Gesamtbewertung der konkreten Wahl zusammenzuführen, die auch dem übergeordneten Wahlumfeld Rechnung trägt und etwaige Betrugsabsichten aufdeckt. Darüber hinaus gibt es gravierende Unterschiede dahingehend, wie deutlich die Kritik an den Wahlen formuliert werden soll. Die Präsidentschaftswahlen in Uganda 2016 wurden beispielsweise von Wahlbeobachtungsmissionen der Europäischen Union und des Commonwealth offen kritisiert. Die Kritik der Afrikanischen Union war bereits verhaltener. Kaum Versäumnisse monierten hingegen Wahlbeobachtungsteams einiger Regionalorganisationen wie der East African Community.
Während Fort- und Rückschritte in Bezug auf das jeweilige Land häufig benannt werden, verzichten selbst kritische Wahlbeobachtungsberichte bewusst darauf, Wahlen verschiedener Länder miteinander zu vergleichen. Dies ist politisch auch angebracht, um nicht ein Land gegen ein anderes auszuspielen, zumal die Staaten oft unter sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen Wahlen durchführen. Vor Vielländervergleichen und Rankings keine Scheu haben hingegen die Sozialwissenschaften, bei denen Indizes ohnehin hoch im Kurs stehen. Der Election Integrity Perception Index beispielsweise überträgt qualitative Einschätzungen von Expertinnen und Experten zu den jeweiligen Wahlen in numerische Werte. Die befragten Sachverständigen werden gebeten, jeweils Punkte auf insgesamt 49 Aspekte zu vergeben, welche die Wahlgesetze, das Wahlprozedere, die Wahlkreise, die Wählerregistrierung, die Parteien- und Kandidatenregistrierung, die Medienkampagnen, die Wahlkampffinanzierung, die Stimmabgabe, die Stimmenverrechnung, die Ergebnisse sowie die Wahlbehörden betreffen. Maximal 100 Punkte lassen sich erreichen. Die numerische Bewertung wiederum bildet die Grundlage für eine Fünferskala, die zwischen einer „sehr hohen“, „hohen“, „gemäßigten“, „niedrigen“ oder „sehr niedrigen“ Integrität des Wahlprozesses aus Sicht der Expertinnen und Experten unterscheidet.
Die nachfolgende Tabelle bildet das kumulative Ergebnis der Bewertung in 166 Staaten ab, dem insgesamt 3.861 Einschätzungen für 337 nationale Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zwischen dem 1. Juli 2012 und dem 31. Dezember 2018 zugrunde liegen. Nicht berücksichtigt wurden Kleinstaaten mit weniger als 100.000 Einwohnern, was eine Reihe europäischer Länder (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino) oder auch pazifischer Inselstaaten (Fidschi, Kiribati, Samoa, Vanuatu etc.) ausschließt, in denen kompetitive Wahlen durchgeführt werden. Außen vor bleiben weiterhin Staaten, die entweder keine allgemeinen und direkten Wahlen zum Parlament vorsehen (z. B. Brunei, China, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate), zumindest im Untersuchungszeitraum keine durchgeführt haben (z. B. Eritrea, Somalia, Südsudan) oder in denen keine Mehrparteienwahlen stattfinden, da nur die Regimepartei antritt. Auch sind einige Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aus technischen Gründen noch nicht in die Erhebung aufgenommen worden (wie etwa die Demokratische Republik Kongo).36
Integritätsindex von Wahlen weltweit
| Integrität | Länder (Punkte, Maximum: 100) |
| Sehr hoch | Dänemark (86), Finnland (85), Norwegen, Schweden (beide 83), Island (82), Deutschland, Niederlande (beide 81), Costa Rica, Estland, Schweiz (alle 79), Litauen, Österreich, Slowenien (alle 77), Luxemburg, Tschechische Republik (beide 76), Frankreich, Kanada, Neuseeland, Portugal, Uruguay (alle 75), Israel, Polen, Slowakei (alle 74), Irland, Lettland, Südkorea, Taiwan (alle 73), Belgien, Chile, Kap Verde (alle 71), Australien, Benin (beide 70). |
| Hoch | Spanien, Zypern (beide 69), Italien, Japan, Tunesien (alle 68), Jamaika (67), Bhutan, Griechenland, Großbritannien (alle 66), Argentinien, Barbados, Ghana, Kroatien, Malta (alle 65), Brasilien, Mauritius, Mongolei, Timor-Leste, Tonga (alle 64), Republik Südafrika (63), Lesotho, Peru, Vanuatu (alle 62), Grenada, Oman, Panama, USA (alle 61), Kolumbien, Namibia (beide 60). |
| Mittel | Indien, Mikronesien (beide 59), Botsuana, Bulgarien, Georgien, Ruanda (alle 58), Indonesien, Marokko, Salomon-Inseln (alle 57), Bolivien, Nepal, Republik Moldau (alle 56), Armenien, Fidschi, Rumänien (alle 55), Albanien, Bahamas, Guinea-Bissau, Kuwait, Liberia, Myanmar, Ungarn (alle 54), Belize, Burkina Faso, Guyana, Kirgistan, Nigeria, Sierra Leone, Zentralafrikanische Republik (alle 53), Malediven, Montenegro, Niger, São Tomé und Príncipe, Sri Lanka (alle 52), Suriname, Ukraine (beide 51), Ecuador, Paraguay, Philippinen (50). |
| Niedrig | Iran, Jordanien, Serbien (alle 49), Antigua und Barbuda, Guatemala, Laos, Malawi, (Nord-)Mazedonien (alle 48), Pakistan, Russische Föderation (beide 47), Bosnien und Herzegowina (46), Kasachstan, Sambia, Türkei (alle 45), Dominikanische Republik, Tansania (beide 44), Algerien, Kenia, Mali, Senegal, Sudan (alle 43), Guinea, Libanon, Madagaskar, Swasiland (alle 42), Aserbaidschan, Venezuela (beide 41), Ägypten, Bahrain, Belarus, Kamerun (alle 40) |
| Sehr niedrig | Angola (39), Bangladesch, Irak, Mauretanien, Togo, Usbekistan, Zimbabwe (alle 38), Honduras, Uganda (beide 37), Aserbaidschan, Nicaragua, Turkmenistan (36), Malaysia, Mosambik, Tadschikistan (alle 35), Afghanistan, Papua-Neuguinea, Vietnam (alle 34), Haiti (32), Dschibuti, Tschad (beide 31), Kambodscha, Kongo (beide 30), Rep. Kongo (29), Äquatorialguinea, Äthiopien, Burundi, Syrien (alle 24) |
Quelle: eigene Zusammenstellung auf Grundlage von: www.ElectoralIntegrityProject.com (Mai 2019)
Der Index zeigt in vielerlei Hinsicht zu erwartende Ergebnisse auf: Den etablierten Demokratien in Nord-, West- und Südeuropa beispielsweise wird durchweg eine sehr hohe oder hohe Integrität bescheinigt. Am besten schneiden dort die nordischen Staaten Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und Island ab, gefolgt von Deutschland und den Niederlanden. Vergleichsweise niedrig ist allerdings für westliche Demokratien die Punktebewertung von Griechenland, Großbritannien und Malta. Durchwachsener ist das Bild in den Staaten Mittel-und Osteuropas. Dort wird die Integrität der Wahlen nur in einigen Ländern als sehr hoch (Estland, Litauen, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Polen) oder als hoch (Kroatien) eingeschätzt, während die Wahlen in etlichen anderen Ländern nur ein „gemäßigt“ erhalten. Schlusslicht ist dort, wenig erstaunlich, Belarus. Unter den Staaten des Kaukasus und Zentralasiens fallen die Mongolei und mit Einschränkungen Kirgistan vergleichsweise positiv auf, während Usbekistan, Aserbaidschan, Turkmenistan und Tadschikistan besonders schlecht abschneiden. Im restlichen Asien und im Pazifikraum gehören Bangladesch, Malaysia, Papua-Neuguinea, Afghanistan, Vietnam und Kambodscha zu den Schlusslichtern, während Neuseeland, Südkorea, Taiwan und Australien eine sehr hohe Wahlintegrität bescheinigt wird. Im Nahen Osten stechen die Wahlen in Israel als der einzigen Demokratie in der Region positiv hervor, in Nordafrika jene in Tunesien, einem Land, dessen demokratische Entwicklung allerdings nicht abgeschlossen ist. Vielschichtig ist auch das Bild in Afrika südlich der Sahara, das von bemerkenswert demokratischen bis hin zu offen gefälschten Wahlen reicht: Dem Index zufolge weisen die Wahlen in Capo Verde und Benin im Untersuchungszeitraum (noch) eine sehr hohe Integrität auf und die Wahlen in Ghana, der Republik Südafrika, Lesotho und Namibia immerhin eine hohe. Hingegen schneiden Burundi, Äquatorialguinea und Äthiopien äußerst schlecht ab. In Amerika bekommen die Wahlen in Costa Rica und Uruguay sowie in Kanada sehr gute Bewertungen, ganz im Unterschied zu den Wahlen in Venezuela, Honduras, Nicaragua und Haiti. Die USA fallen im Vergleich zu anderen Demokratien ab.
Der Index gibt einen ersten, möglicherweise hilfreichen Überblick über Wahlen weltweit.37 Allerdings lässt die Transparenz der von Expertinnen und Experten zwar anhand objektiver Kriterien, aber dennoch subjektiv vorgenommenen Länderbewertungen zu wünschen übrig. Auch fördert der Index mitunter Bewertungen zutage, die kontraintuitiv sind, schon gar im interregionalen Vergleich. So ist beispielsweise schwer nachvollziehbar, dass die Wahlen im Sudan weit mehr Punkte erhalten als die sicherlich kritikwürdigen, aber doch kompetitiveren Wahlen in Honduras und Nicaragua. Ländervergleiche, zumal über verschiedene Weltregionen hinweg, sind bei solchen Indizes mit großer Vorsicht zu genießen, da die Bewertungen insbesondere vor dem Hintergrund des nationalen und allenfalls noch des regionalen Kontexts erfolgen, nicht aber auf Grundlage eines zumal interregionalen Vergleichs. Es wäre daher stets zu prüfen, welche Aspekte der Wahlen für eine bessere oder schlechtere Bewertung der Wahlen ausschlaggebend waren und wie sich etwaige Bewertungsvarianzen begründen lassen. Die aggregierten Länderdaten geben hierzu kaum Aufschluss. Zugleich können die kumulativen Ergebnisse die Unterschiede der Integrität von Wahlen in ein und demselben Land verwischen. Mitunter sind auch Wahlen, die zu abweichenden Bewertungen kommen, noch nicht erfasst: In der knapp 20-jährigen Vorzeigedemokratie Westafrikas, Benin, die für den Zeitraum zwischen 2012 und 2018 eine sehr hohe Bewertung erhielt, wurden bei den Parlamentswahlen im Mai 2019 nur zwei regierungsnahe Parteien zugelassen, fünf Oppositionsparteien(-bündnisse), darunter auch jene des ehemaligen Präsidenten Boni Yayi, wurde die Zulassung verwehrt. Die Wahlbeteiligung sank rapide auf rund 23 %, und es folgten schwere Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstrierenden.