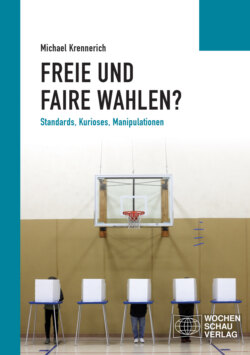Читать книгу Freie und faire Wahlen? - Michael Krennerich - Страница 11
Wahlbeobachtung – inzwischen weit verbreitet
ОглавлениеInternationale Wahlbeobachtung spielt eine potenziell wichtige Rolle für die Transparenz und Integrität des Wahlgangs. Durch Wahlbeobachtung lassen sich Wahlunregelmäßigkeiten und Wahlmanipulationen nicht nur aufdecken, sondern möglicherweise auch vermeiden. Angesichts der Präsenz von Wahlbeobachtungsteams nehmen die politischen Kontrahentinnen und Kontrahenten gegebenenfalls von (allzu offenem) Wahlbetrug Abstand. Zum anderen können unabhängige Wahlbeobachtungsmissionen auch bezeugen, wenn die Wahlen hinreichend frei und fair abliefen. Der Ausweis, dass die Wahlen internationalen Standards genügten, kann die Legitimität der Wahlen stärken, gerade dann, wenn diese infrage gestellt wird. Vor allem in solchen Gesellschaften, in denen – beispielsweise nach Bürgerkriegen oder im Rahmen von Demokratisierungsprozessen – großes Misstrauen zwischen den kandidierenden Personen und Parteien herrscht, kann Wahlbeobachtung zur Vertrauensbildung beitragen. Gleiches gilt für Länder, in denen eine ausgeprägte politische oder gesellschaftliche Polarisierung einen demokratischen Wahlprozess erschwert. Selbst in etablierten Demokratien können Empfehlungen von Wahlbeobachtungsteams wahlrechtliche oder wahlorganisatorische Reformen anstoßen.
Die Vereinten Nationen entsandten bereits zwischen 1956 und 1990 rund 30, meist kleine Wahlbeobachtungsmissionen in die sich damals entkolonialisierenden Staaten Afrikas und Asiens. Doch die von den Vereinten Nationen überwachten Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung im November 1989 in Namibia, auf die im März 1990 die Unabhängigkeit des Lands folgte, bildeten vom Umfang her eine Zäsur: Die dortige United Nations Transaction Assistance Group umfasste 8.000 Personen.38 Es folgten die bis dahin international am besten beobachteten Wahlen in einem souveränen Staat: die Wahlen 1990 in Nicaragua, aus denen das sandinistische Revolutionsregime (1979 – 1990) nach siegreichen Wahlen 1984 überraschend als Verlierer hervorging und die Regierungsmacht abgab. Die Wahlen waren Teil des zentralamerikanischen Friedensprozesses39 und wurden nicht nur von den Vereinten Nationen beobachtet, sondern auch von der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), die zwischen 1962 und 1990 an mehr als 20 kleineren Wahlbeobachtungsmissionen in der Region teilgenommen hatte, sowie von etlichen weiteren internationalen NGOs, wie etwa dem Carter Center. Während sich die Vereinten Nationen im Laufe der 1990er Jahre zusehends aus der Wahlbeobachtung zurückzogen, war bei den darauffolgenden Wahlen 1996 in Nicaragua die OAS, die Europäische Union sowie eine kaum überschaubare Anzahl an internationalen Wahlorganisationen, NGOs, Stiftungen, Parteien, Botschaften und Abgeordneten vor Ort. Sie trugen erheblich zur Integrität der Wahlen und zur neuerlichen Akzeptanz der Wahlniederlage durch die Sandinisten bei.
Im Zuge der Demokratisierungsprozesse auch in anderen Weltregionen entwickelten weitere Institutionen eine kontinuierliche, professionelle Wahlbeobachtung. Im OSZE-Raum mit seinen 57 Teilnahmestaaten ist hier vor allem das Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) der OSZE hervorzuheben. Es entsandte 1996 sein erstes Langzeitwahlbeobachtungsteam und hat bis Ende 2018 insgesamt 358 Beobachtungen von Wahlen und Referenden durchgeführt.40 Die EU wiederum schickte, beginnend mit einer Mission nach Russland im Jahr 1993, bis Ende 2019 insgesamt 197 Wahlbeobachtungsteams in sogenannte „Drittstaaten“.41
Mit dabei waren von Beginn an Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter aus Deutschland, da internationale Wahlbeobachtung schon früh als Instrument der Demokratisierungshilfe erachtet wurde.42 Deren Beteiligung wurde in den 1990er Jahren direkt über das Auswärtige Amt koordiniert, später übernahm das 2002 gegründete Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) die Rekrutierung und Ausbildung deutscher Wahlbeobachterinnen und -beobachter. Bis September 2019 vermittelte das ZIF insgesamt 4.242 Kurzzeit- und 534 Langzeitwahlbeobachterinnen und -beobachter an Wahlbeobachtungsmissionen von ODIHR und 366 bzw. 319 an jene der EU. Nicht einbezogen sind hierbei die direkt bei der OSZE oder der EU beschäftigten Personen. Darüber hinaus entsandten auch nicht staatliche Organisationen Wahlbeobachterinnen und -beobachter von Deutschland aus ins Ausland.
Entsandte Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter (ZiF)
| ODIHR | Jahr 2002 | Jahr 2003 | Jahr 2004 | Jahr 2005 | Jahr 2006 | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 | Jahr 2011 | Jahr 2012 | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 | Jahr 2017 | Jahr 2018 | Jahr 2019* |
| STOs | 141 | 269 | 441 | 252 | 189 | 217 | 191 | 168 | 272 | 138 | 195 | 239 | 234 | 213 | 323 | 187 | 276 | 297 |
| LTOs | 15 | 32 | 34 | 25 | 24 | 27 | 31 | 18 | 33 | 19 | 38 | 19 | 31 | 31 | 47 | 27 | 42 | 41 |
| EU | Jahr 2002 | Jahr 2003 | Jahr 2004 | Jahr 2005 | Jahr 2006 | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 | Jahr 2011 | Jahr 2012 | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 | Jahr 2017 | Jahr 2018 | Jahr 2019* |
| STOs | 6 | 25 | 47 | 39 | 50 | 24 | 18 | 18 | 28 | 21 | 6 | 22 | 6 | 9 | 6 | 13 | 16 | 12 |
| LTOs | 2 | 14 | 26 | 34 | 38 | 27 | 25 | 20 | 17 | 21 | 8 | 16 | 17 | 8 | 8 | 12 | 18 | 8 |
Quelle: ZIF, zusammengestellt von Dominika Eichstädt
* Stand: September 2019. STO: Short-term observers, LTO: Long-term observers.
Neben der internationalen Wahlbeobachtung wuchs zugleich die Bedeutung der Wahlbeobachtung durch nationale und lokale Organisationen innerhalb der jeweiligen Länder, gerade auch seitens der dortigen Zivilgesellschaft (domestic observers, citizens observers). Hinzu kommen in vielen Ländern „observers“, „agents“ oder „proxies“ der kandidierenden Personen und Parteien.
Als ein frühes Beispiel für eine umfassende und erfolgreiche nationale Wahlbeobachtung gelten die Präsidentschaftswahlen 1986 auf den Philippinen, die ein wichtiger Baustein der dortigen Demokratisierung waren. Sie wurden von rund 500.000 Freiwilligen beobachtet. Die National Citizens’ Movement for Free Elections (NAMFREL) hatte landesweit Bemühungen unternommen, um Wahlbetrug zu verhindern oder zu dokumentieren. NAMFREL diente als Inspiration für zahlreiche weitere nationale Wahlbeobachtungen in Asien. Zu nennen sind beispielsweise die 1991 gegründete Citizens’ Coalition for Clean and Fair Elections (CCCFE) in Südkorea oder in Bangladesch die Bangladesh Movement for Fair Elections (BMNA), die ebenfalls 1991 entstand, sowie später die Fair Election Monitoring Alliance (FEMA), die zu den Wahlen 1996 gegründet worden war. Auch in anderen asiatischen Staaten wie Thailand, Nepal oder Sri Lanka, in denen in der erste Hälfte der 1990er Jahre erstmals Mehrparteienwahlen stattfanden, bildeten sich, vorübergehend oder dauerhaft, kleinere oder größere Wahlbeobachtungsorganisationen und -netzwerke heraus.43
In anderen Weltregionen, allen voran in Lateinamerika, gewannen ab Ende der 1980er Jahre nationale Wahlbeobachtungen ebenfalls stark an Bedeutung. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie CIVITAS in Chile, Participación Ciudadana in der Dominikanischen Republik, Alianza Cívica in Mexiko, die Comisión Justicia y Paz in Panama oder Transparencia in Peru beobachteten die Wahlen in den sich (re-)demokratisierten Staaten der Region.44 Bei den bereits erwähnten Wahlen von 1996 in Nicaragua wurden die internationalen Wahlbeobachtungsmissionen durch etwa 5.000 nationale Wahlbeobachterinnen und -beobachter sowie ungefähr 30.000 bis 50.000 Vertreterinnen und Vertreter von Parteien ergänzt. In Europa gründeten im Dezember 2012 insgesamt 13 unabhängige zivilgesellschaftliche Wahlbeobachtungsorganisationen die European Platform for Democratic Elections (EPDE),45 die wiederum Mitglied des Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM) ist, in dem auch zahlreiche Organisationen und Netzwerke aus Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika mitwirken.46
Selbst wenn die Wahlgesetze (gerade von etablierten Demokratien) nicht immer Abschnitte zur Wahlbeobachtung enthalten, sind mittlerweile bei vielen Wahlen weltweit internationale wie nationale Beobachtungsteams akkreditiert und zugegen. Dadurch geraten auch Wahlautokratien unter Handlungsdruck. So ist nur vorderhand erstaunlich, dass autokratische Regierungen internationale Wahlbeobachtungsteams ins Land lassen. Behnke, Grotz und Hartmann erklären dies dadurch, dass eine Verweigerungshaltung – sofern diese möglich ist47 – leicht als Täuschungsabsicht wahrgenommen werden könnte.48 Tatsächlich nährt die Nichtzulassung oder Behinderung internationaler Wahlbeobachtung oft berechtigte Zweifel an dem politischen Willen der Regierung, demokratische Wahlen abzuhalten. Aus diesem Grund sind Autokraten dazu übergegangen, mittels einer selektiven Einladungspolitik – zusätzlich oder ausschließlich – Wahlbeobachtungsgruppen von befreundeten Regimen und angeblich unabhängigen Organisation einzuladen, die ein gefälliges Bild der Wahlen zeichnen. Bereits erwähnte Beispiele sind hier Aserbaidschan, Zimbabwe und Venezuela. Ohnehin können Autokraten, wie später noch gezeigt werden wird, den Ausgang der Wahlen bereits lange vor dem Wahltag beeinflussen (oder schlimmstenfalls sogar festlegen), sodass offener Wahlbetrug am Wahltag, also dem Höhepunkt der Kurzzeitwahlbeobachtung, nicht mehr unbedingt nötig ist.
Bei den russischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2018 beispielsweise war zwar eine große ODIHR-Wahlbeobachtungsmission zugegen. Doch blieb etlichen anderen „unerwünschten“ ausländischen Wahlbeobachtungsorganisationen eine Einreise verwehrt. Auch lud die Regierung eigens rund 300 Personen (darunter auch AfD-Politiker aus Deutschland) zur Wahlbeobachtung ein, die hauptsächlich dazu dienten, die „Legitimität“ der Wahlen zu bestätigen. Da der Regierung an einer hohen Wahlbeteiligung gelegen war, nutzte sie ferner regimeloyale nationale Wahlbeobachtungsgruppen, um die Bürgerinnen und Bürger zur Wahlteilnahme zu bewegen.49 Regimekritische nationale Wahlbeobachtungsteams wurden hingegen schikaniert. Zugleich setzte die Regierung darauf, dass der eigentliche Wahltag, auf den sich die Hauptaufmerksamkeit von Kurzzeitwahlbeobachtungen richtete, vergleichsweise ruhig und geordnet verlief, was internationale Wahlbeobachtungsteams – trotz mancher Unregelmäßigkeit – auch bestätigten. Allerdings machte ODIHR deutlich, dass im Vorfeld der Wahlen deren Freiheit und Fairness unzulässig beschnitten worden waren. Noch deutlicher war dies bisher in Belarus der Fall, wo ebenfalls internationale und (vorwiegend regimeloyale) nationale Wahlbeobachtungsteams die Wahlbeteiligung erhöhen und einen geordneten Wahlvorgang bezeugen sollten.
Dass Wahlautokratien inzwischen gezielt versuchen, über ihnen genehme Wahlbeobachtungen Legitimation für nur beschränkt kompetitive Wahlen zu gewinnen, lässt sich auch für andere Länder feststellen. In Kambodscha sollten beispielsweise fragwürdige internationale und nationale Wahlbeobachtungsgruppen den Umstand kompensieren, dass etliche anerkannte internationale Organisationen keine Wahlbeobachtungsteams zu den schon im Vorfeld erkennbar undemokratischen Parlamentswahlen 2018 entsandten.50 Auch bei den Präsidentschaftswahlen 2019 in Kasachstan und den Parlamentswahlen 2020 in Aserbaidschan wurde von ODIHR die politische Unabhängigkeit manch nationaler Wahlbeobachtungsgruppen infrage gestellt. Dies zeigt einmal mehr, dass die Verantwortlichen in Autokratien gelernt haben, auch Wahlen für ihre Zwecke zu nutzen. Gleichwohl bleiben internationale und nationale Wahlbeobachtungen, sofern sie seriös und unabhängig durchgeführt werden, wichtige Garanten für die Durchführung freier und fairer Wahlen, vor allem in jungen und entstehenden Demokratien. Auch zeitigen sie Auswirkungen auf den Wahlwettbewerb in Autokratien.51
34 Vgl. Nohlen 1978, 2014, Krennerich 1993, 1996a und 2000.
35 Vgl. den Code of Good Practice in Electoral Matters des Europarates (CDL-AD (2002) 023rev2-cor) sowie die Wahlmanuals von OSCE/ODIHR (2012), der Europäischen Union (European Union 2016), der Organisation Amerikanischer Staaten (OEA 2008) und der Afrikanischen Union (African Union 2013) – sowie die Handbücher etlicher nicht staatlicher Organisationen, die Wahlberatung und Wahlbeobachtung durchführen, wie das Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA), International IDEA (Institute for Democratic and Electoral Assistance), die International Foundation for Electoral Systems (IFES), das Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) des Interamerikanischen Instituts für Menschenrechte (IIDH) oder auch die International Human Rights Law Group, für die Larry Garber bereits 1984 Richtlinien für Wahlbeobachtung erstellt hat.
36 Norris/Grömping 2019.
37 Zur Diskussion des dem Index zugrunde liegenden Konzepts der Integrität der Wahlen siehe etwa: Garrido/Nohlen 2019.
38 Vgl. Borneo 2000. Siehe auch Harneit-Sievers 1990, Tötemeyer/Wehmhörner/Weiland 1996.
39 Vgl. Krennerich 1993.
40 Datengrundlage: ODIHR Annual Reports.
41 Entsprechende Daten finden sich auf der Website des European External Action Service der EU.
42 Vgl. etwa Mair 1994.
43 Vgl. National Democratic Institute 1996.
44 Vgl. Middlebrook 1998.
45 Vgl. https://www.epde.org.
46 Vgl. https://gndem.org.
47 Das Kopenhagener Dokument (1990) besagt, dass sich alle OSZE-Teilnahmestaaten untereinander eine standing invitation zur Wahlbeobachtung aussprechen. So gesehen bräuchte es gar keine ausdrückliche Einladung mehr. Im politischen Tagesgeschäft hat sich jedoch eingebürgert, dass eine solche Einladung erfolgt.
48 Behnke/Grotz/Hartmann 2017: 40.
49 Das russische Wahlgesetz erlaubt, dass Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, Medien sowie seit 2017 sogenannte Zivilkammern nationale Wahlbeobachterinnen und -beobachter benennen.
50 Siehe Morgenbesser 2019: 168 ff.
51 Vgl. etwa Roussias/Ruiz-Rufino 2018.