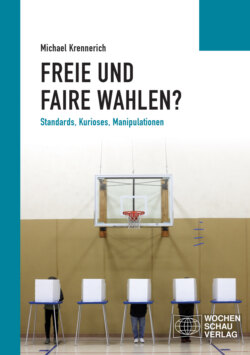Читать книгу Freie und faire Wahlen? - Michael Krennerich - Страница 14
4. DAS WAHLRECHT ALS BÜRGER- UND MENSCHENRECHT
ОглавлениеDas Wahlrecht stellt ein grundlegendes demokratisches Recht dar. Vom Bundesverfassungsgericht wurde es ehedem als das „vornehmste Recht“ der Bürgerinnen und Bürger im demokratischen Staat geadelt.61 Es ist nicht nur in den meisten nationalen Verfassungen, sondern auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948 und in zahlreichen internationalen Menschenrechtsabkommen fest verankert. In der AEMR ist es dem Wortlaut nach als ein Menschenrecht ausgewiesen, das jedem Menschen zusteht. Gleichwohl ist es mit einer wichtigen Konkretisierung hinsichtlich des räumlichen Anwendungsbereichs versehen: Jeder Mensch hat das Recht, in seinem Land zu wählen und gewählt zu werden.
„Jeder [Mensch] hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. […] Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck zu kommen.“ (Art. 21 AEMR).
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (kurz: UN-Zivilpakt) von 1966 (seit 1976 in Kraft) formuliert das Wahlrecht als einziges Menschenrecht bereits dem Wortlaut nach nur noch als Staatsbürgerrecht:
„Jeder Staatsbürger [sic] hat das Recht und die Möglichkeit, ohne Unterschied nach den in Artikel 2 genannten Merkmalen und ohne unangemessene Einschränkungen
1. an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen;
2. bei echten, wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen, bei denen die freie Äußerung des Wählerwillens gewährleistet ist, zu wählen und gewählt zu werden; […]“ (Art. 25 UN-Zivilpakt)
Auch weitere internationale Menschenrechtsabkommen beinhalten das Wahlrecht. Nachdem das UN-Übereinkommen über die politischen Rechte der Frau von 1953 das gleiche aktive wie passive Wahlrecht für Frauen vorgesehen hatte, wurde dies beispielsweise nochmals im UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung von Frauen aus dem Jahr 1979 (seit 1981 in Kraft) ausdrücklich garantiert. Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 (2008) wiederum verpflichtet die Vertragsstaaten, die gleichberechtigte und barrierefreie Nutzung des aktiven und passiven Wahlrechts für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Ebenso sehen die regionalen Menschenrechtsschutzsysteme in Europa, Amerika und Afrika das allgemeine aktive und passive Wahlrecht vor, freilich auch hier verstanden als gleiche Rechte, die jeder Mensch im eigenen Land ausübt. Indes gibt es auch eine Reihe unverbindlicher Empfehlungen, der ausländischen Wohnbevölkerung zumindest auf subnationaler Ebene das Wahlrecht einzuräumen.
Ungeachtet der völkerrechtlichen Vorgaben gewähren nicht alle Staaten ihren Staatsangehörigen das Wahlrecht, oder sie verwehren ihnen die Möglichkeit, dieses auszuüben. In manchen Staaten, etwa in Brunei, China, Katar, Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, sind gar keine allgemeinen und direkten Wahlen zum Parlament vorgesehen, in anderen Staaten wie etwa Eritrea oder Somalia, haben sie noch nicht (oder seit Langem nicht mehr) stattgefunden. Dort, wo sie stattfinden, ermöglichen Wahlen zudem nicht unbedingt die „freie Äußerung des Wählerwillens“ und entsprechen oft nicht den Standards, die inzwischen international an freie und faire Wahlen angelegt werden. Das gilt vor allem für Wahlen in Autokratien, in denen die Freiheit und Fairness der Wahlen bereits regimebedingt stärker beeinträchtigt sind als in liberalen Demokratien. Aber auch in jungen Demokratien kommt es immer wieder zu Unregelmäßigkeiten bei der Wahldurchführung und ist der übergeordnete politische Kontext dem demokratischen Bedeutungsgehalt der Wahlen nicht immer zuträglich. Selbst in etablierten Demokratien liegt mitunter einiges im Argen. Auch dort weisen das Wahlrecht und die Wahlpraxis gelegentlich Eigenarten auf, die überholt oder gar undemokratisch anmuten.
61 BVerfGE 1, 14 (33).