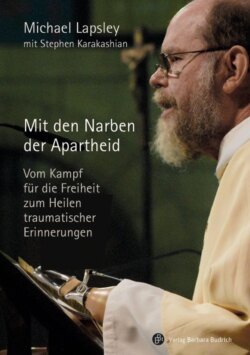Читать книгу Mit den Narben der Apartheid - Michael Lapsley - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[13]2
Genesung
Im Parirenyatwa-Krankenhaus hatten sich die Krankenschwestern mit viel Liebe und Zuwendung um mich gekümmert, und die Ärzte hatten mich zusammengeflickt. Mein Leben war nicht mehr in Gefahr, aber meine Wunden waren nach einem Monat immer noch schartig und unverheilt. Mir standen noch viele weitere Operationen bevor, die den Heilungsprozess erleichtern und meinen Körper auf die Prothesen vorbereiten sollten, die ich den Rest meines Lebens tragen würde. Ich entschloss mich, die Behandlung in Australien fortzusetzen. Meine Schwester Helen unterrichtete Gesundheitsökonomie an der Universität von New South Wales in Sydney und organisierte meine Aufnahme im Prince-of-Wales-Universitätsklinikum. Australien war die nächstliegende Lösung, weil ich dort meine Schwester und ihren Mann Clive sowie meine Glaubensbrüder aus der Zeit meines Theologiestudiums um mich haben würde. Es war ja absehbar, dass mir eine lange Genesungszeit bevorstand und ich neben einer ausgezeichneten medizinischen Betreuung auch die Unterstützung von Verwandten und Freunden brauchen würde. Bei der Fluggesellschaft war man ziemlich besorgt, dass ich als Passagier ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Das südafrikanische Regime hatte schließlich einen Briefbombenanschlag auf mich verübt und würde nun vielleicht versuchen, in der Luft das zu Ende zu bringen, was es auf dem Boden verpfuscht hatte. Trotzdem willigte die Fluggesellschaft schließlich ein, mich zu transportieren.
Da es keine Direktflüge gab, dauerte der Flug von Harare über Perth nach Sydney fast vierundzwanzig Stunden und wäre selbst unter normalen Umständen sehr anstrengend gewesen. Aufrecht in einem Flugzeugsitz zu reisen stand für mich ohnehin nicht zur Debatte. Ich sollte in einem tragbaren Bett liegen und von einem Mitglied meines Ordens und einer Krankenschwester begleitet werden. Die Krankenschwester auszusuchen war einfach: Ich entschied mich für diejenige, deren Spritzen am wenigsten wehtaten. In dem Monat seit dem Anschlag hatte ich mein Krankenzimmer kaum verlassen – außer wenn ich zu Operationen und Untersuchungen gerollt wurde. Ich wurde rundum versorgt. Was für ein gravierender Unterschied zu meinem aktiven und unabhängigen Leben zuvor! Schon als Schuljunge in Neuseeland hatte ich oft meinen eigenen Kopf gehabt und in meinem bescheidenen Rahmen versucht, Rassismus zu bekämpfen und für Gerechtigkeit einzutreten. Später als Erwachsener übernahm ich nicht das offizielle Gedankengut, sondern [14]handelte so, wie ich es für richtig hielt. Ich hatte mir einen gewissen Ruf erworben, Autorität und ihre Auswüchse in Frage zu stellen. Ich war kampferprobt, nicht nur durch Auseinandersetzungen mit der südafrikanischen Regierung, sondern auch mit Kirchenbeamten, die ich manchmal für engstirnig oder eigennützig, wenn nicht gar rassistisch hielt. Für mich war der Kampf um die Seele Südafrikas ein ethisches Problem, das die ganze Welt betraf. Obwohl ich nur eine bescheidene Rolle spielte, hatte ich bisweilen lange Flüge zurückgelegt, um den ANC gegenüber verschiedenen religiösen Organisationen zu vertreten. Flugzeuge waren also nichts Neues für mich. Jetzt befand ich mich aber zum ersten Mal seit dem Anschlag außerhalb des Krankenhauses und lag festgezurrt auf einer Trage, die auf eine hölzerne Transportpalette gestellt wurde. Und so lag ich da, bereit, wie das übrige Frachtgut in den Jumbo-Jet geladen zu werden. „Was für eine Welt kann es für mich geben? Werde ich jemals wieder ein sinnvolles Leben führen können?“, waren die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, während ich da auf der Rollbahn lag und in den Himmel schaute.
Der Flug war genauso schrecklich, wie ich es befürchtet hatte. Beruhigungsmittel linderten meine Beschwerden zwar etwas, aber richtige Ruhe fand ich kaum. Auf meinen früheren Reisen hatte ich oft davon geträumt, wie schön es wäre, auf den langen Strecken ein Bett im Flugzeug zu haben. Schwach und in Verbände eingewickelt auf einer Trage zu liegen, die mehr schlecht als recht auf sechs Sitzen festgezurrt war, gehörte nicht zu diesem Traum. Es war sehr unbequem, und für jede Kleinigkeit brauchte ich die Krankenschwester. Die letzten Wochen hatte ich so sehr um mein Leben gekämpft, und meine Freunde hatten mich mit Liebe und Zuspruch überhäuft. Jetzt aber, in dieser unwirklich anmutenden Situation, fühlte ich mich hilflos und verletzlich.
Als wir endlich in Sydney landeten, wartete ein Krankenwagen auf der Rollbahn, der mich planmäßig im Krankenhaus ablieferte. Obwohl ich auf einer Trage ankam und anstelle meiner Hände Verbände trug, wurden mir am Empfang Fragen über Fragen gestellt – ich nehme an, um festzustellen, ob mein Gehirn noch funktionierte. Psychologen nennen so etwas wohl psychologische Bestandsaufnahme. „Wie heißen Sie?“, wurde ich gefragt. In meinem Zustand konnte ich von Glück reden, dass ich mich noch daran erinnerte. „Welcher Tag ist heute?“ Da war ich mir wegen des Zeitunterschieds von neun Stunden, des Nachtflugs und der Zwischenlandung, die wir gemacht hatten, gar nicht so sicher. Die verantwortliche Person an der Aufnahme schien das Problem überhaupt nicht zu verstehen. Als sie mich dann noch fragten: „Wieso sind sie im Krankenhaus?“, dachte ich mir ‚Mein Gott, sieht man das denn nicht?‘
Es dauerte bis Mitternacht – dann hatte ich endlich ein Zimmer und lag im Bett. Die Krankenschwestern versuchten alles, um es mir bequem zu machen, aber nach einem Flug von über vierundzwanzig Stunden war ich nun [15]völlig erschöpft. Im Krankenhaus in Harare war ich meistens von Freunden umgeben gewesen, und Polizisten und Soldaten hatten meine Tür bewacht. An meinem ersten Abend hier im Krankenhaus in Sydney war ich ganz allein und völlig ohne Sicherheitspersonal. In meinem geschwächten Zustand war das alles zu viel für mich. Das bisschen Energie, das mir noch geblieben war, verließ mich, und ich war vollkommen erschöpft. Mich überkam das Gefühl, dass ich in dieser Nacht sterben könnte. Noch nicht einmal meiner Schwester habe ich erzählt, dass ich in meiner Verzweiflung die Krankenschwestern bat, einige australische Freunde von mir anzurufen und sie zu bitten, für mich zu beten. Leider konnten sie niemanden erreichen. Ich versuchte, die ganze Nacht wach zu bleiben, um nicht zu sterben, aber ich wusste, dass es vergeblich war. Nur seelische Kraft konnte mich jetzt noch am Leben erhalten. Es gab nichts anderes mehr. Als die Nacht das Krankenhaus umhüllte, lag ich in meinem Bett und wiederholte leise: „Ich kann nicht ohne Hilfe überleben. Ich kann nicht ohne Hilfe überleben.“ Es war ein Gebet.
Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass die Schwestern das Ausmaß meiner Verzweiflung erkannt und es später geschafft hatten, meine Freunde Helen und Jim Tregea in Wagga Wagga zu erreichen. Jim war der Pfarrer, bei dem ich viele Jahre zuvor als frisch geweihter Priester und Hilfsgeistlicher tätig gewesen war. Mit beiden verbindet mich eine lebenslange Freundschaft. Als sie mich kurze Zeit später besuchten, erzählten sie mir, dass sie nach dem Anruf aus dem Krankenhaus ein Abendmahl bei sich abgehalten und die ganze Nacht für mich gebetet hatten.
Am darauffolgenden Abend fühlte ich mich nach all den Anstrengungen immer noch zittrig. Plötzlich bemerkte ich eine schattenhafte Gestalt vor meinem Fenster. In meinem wehrlosen Zustand drehte ich völlig durch. Ich war mir sicher, dass meine Feinde mich endgültig eingeholt hatten. Der Schatten – so stellte sich heraus – war ein Fensterputzer, aber meine Angst war nicht unbegründet, denn mein Überleben war für das Regime, das mich umbringen wollte, gleichbedeutend mit einem Scheitern. Südafrikaner hatten kurz zuvor einen Bombenanschlag in Australien verübt, und ANC-Mitglieder waren in Frankreich und in Brüssel angegriffen worden. Bombenanschläge und Attentate gehörten leider zur Realität. Später schickte mir die australische Regierung einen Sicherheitsberater. Wenn ich mich in einen Schrank einsperren und die Tür abschließen würde, dann sei ich in völliger Sicherheit, gab er mir zu verstehen und ließ mich daraus meine eigenen Schlüsse ziehen. Mir war klar, dass das kein lebenswertes Leben sein würde. Ich musste vernünftig handeln, durfte mein Leben aber nicht von der Angst bestimmen lassen. Warum überleben, wenn ich nachher doch nur in ständiger Furcht vor einem Mordanschlag leben musste? Ab und zu gab es tatsächlich Drohungen. Drei Jahre später, 1993, drohte mir an demselben Abend als Chris Hani, ein sehr beliebter Anführer des bewaffneten Kampfes, ermordet wurde, ein anonymer Anrufer mit den Worten: „Wir kriegen dich!“. Das verfehlte zwar [16]nicht seine Wirkung, aber ich stand immer zu meiner Entscheidung, unbeirrt weiterzumachen.
Ungefähr zwei Wochen nach meiner Ankunft in Sydney diktierte ich einen Brief, den mein Freund George Makoko an Freunde und Unterstützer in der ganzen Welt schickte:
Liebe Freunde,
am Samstagabend, den 28. April, öffnete ich eine Briefbombe aus Südafrika. Sie sollte mich umbringen, aber ich bin am Leben! Mein Körper ist gezeichnet, aber ich lief ja noch nie Gefahr, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen.
Einerseits ist mein Geist so zerbrechlich wie der jedes anderen Menschen auch. Andererseits bin ich gestärkt und mehr denn je entschlossen, gemeinsam mit dem südafrikanischen Volk für ein neues und freies Südafrika zu kämpfen. Die Geburtswehen dieses Landes sind weiterhin sehr schmerzhaft und verlangen viele Opfer. Ich hoffe und bete, dass alles, was mir widerfahren ist, mich zu einem sensibleren und mitfühlenderen Menschen macht.
Es wird wohl lange dauern, bis mein Heilungsprozess abgeschlossen ist und ich wieder mit ganzer Kraft zum Kampf beitragen kann. Die Flut von Liebesbekundungen, Gebeten, Unterstützung und Verbundenheit von Menschen aus der ganzen Welt hat mich völlig überwältigt, zutiefst gerührt und gestärkt. „Danke“ zu sagen erscheint mir völlig unzureichend und banal in Anbetracht dessen, was Ihr mir alle gegeben habt. Eines Tages werde ich versuchen, die Geschichte dieses verhängnisvollen Abends, wie sie sich in meine Erinnerung eingebrannt hat, und die Geschichte einiger der vielen Menschen zu erzählen, denen ich mein Leben zu verdanken habe.
Viele von Euch wissen bestimmt, dass ich seit längerer Zeit Mitglied vieler Familien bin. Als erste ist da natürlich meine biologische Familie. Dann gibt es meine Ordensgemeinschaft, die Society of the Sacred Mission. Ferner gehöre ich seit einigen Jahren der großen Familie des African National Congress in Südafrika an, der den Befreiungskampf Südafrikas anführt. Sechseinhalb Jahre lang teilten darüber hinaus die Basotho ihr Leben mit mir. Seit 1983 sind Simbabwe und seine Menschen in so vieler Hinsicht mein Zuhause, dass ich hier nicht alle aufzählen kann. Menschen, die sich auf der ganzen Welt für ungezählte andere Ziele einsetzen, bereichern weiterhin mein Leben. In meiner eigenen Notlage haben sich all diese Familien vereint. Gemeinsam werden wir überleben und gewinnen.
Wie immer, weiterhin kampfbereit und mit viel Liebe
Michael Lapsley, SSM
Mein Schwager Clive wusste, dass ich süchtig nach Nachrichten bin, aber noch nicht lesen konnte. Er war sehr einfühlsam und nahm Auszüge aus großen Tageszeitungen für mich auf. Das half mir, die Zeit totzuschlagen. Insgesamt verbrachte ich sieben Monate in zwei Krankenhäusern in Australien [17]und musste eine ganze Reihe von Operationen über mich ergehen lassen. Man operierte mich, um meine Armstümpfe zu reinigen, sodass sie die Prothesen vertragen würden. Andere Operationen dienten dazu, meine Augenhöhle für das künstliche Auge vorzubereiten. Meine zwei Ohroperationen waren nicht ganz erfolgreich. Bis heute ist mein Hörvermögen eingeschränkt. Mir graute vor diesen Operationen, und ich hatte Angst. Opfer eines Briefbombenanschlags zu werden war eine Sache. Immer wieder in den Operationssaal gerollt zu werden, bedeutet eine ganz andere Art von Trauma. Man hat viel zu viel Zeit, sich auszumalen, was auf einen zukommt. Zum Glück waren die Australier Meister der Schmerztherapie. Bei unsachgemäßer Behandlung können amputierte Menschen unter Phantomschmerzen leiden, manchmal sogar für den Rest ihres Lebens. Dank der Kunstfertigkeit, mit der die Ärzte mir Schmerzmittel verabreichten und sie langsam wieder absetzten, als ich sie nicht mehr brauchte, habe ich nie Phantomschmerzen gespürt.
Eine Psychologin wurde geschickt, um mir zu helfen, meine Operationen zu bewältigen. Bei ihrer Ankunft stellte sich heraus, dass sie eine weiße Südafrikanerin war. Überraschenderweise litt sie unter unserem Treffen. Nach ihrem Empfinden hatte ihr Volk einen Bombenanschlag auf mich verübt. Ich übernahm also schließlich die Rolle des Priesters und Helfers, obwohl sie doch die Psychologin und ich der Patient war. „Hören Sie, ich habe kein Problem damit, dass Sie eine weiße Südafrikanerin sind. Einige meiner besten Freunde sind Weiße. Ich bin ja selbst weiß. Aber ich hätte ein Problem damit, wenn Sie persönlich für die Apartheid wären“, sagte ich zu ihr. Sie trug schwer an der kollektiven Schuld und Scham für das, was mir von denen angetan wurde, die sie als ihresgleichen ansah.
„Glauben Sie, dass Sie die südafrikanische Regierung verärgert haben?“, fragte mich der Krankenhausseelsorger, als er zu mir kam. Ich war so perplex, dass ich ausnahmsweise mal sprachlos war. „Das will ich schwer hoffen, verdammt noch mal!“, hätte ich antworten sollen. An einem anderen Tag sagte er: „Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen zur Apartheid.“ Diesmal war ich aber vorbereitet und erwiderte: „Ja. Die Weltgemeinschaft hält sie für ein Verbrechen gegen die Menschheit, die Christengemeinde für Ketzerei, und dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, die Apartheid unterstützen.“ Er kam nie wieder. Vier Monate verbrachte ich auf dieser Station. Wenn ich mich einmal daneben benahm, sagte mir die Krankenschwester mit einem Augenzwinkern: „Sie sind heute aber wirklich schwierig. Wenn Sie nicht aufpassen, rufen wir den Seelsorger.“ Sie drohte mir also mit der Höchststrafe!
Schließlich organisierte das Krankenhaus die Visite eines Psychiaters, Dr. Murray Wright. Er war freundlich und hilfsbereit. Wir verstanden uns auf Anhieb gut. Er kam vier Monate lang jede Woche. Es war unendlich hilfreich, mit einem Außenstehenden über alles reden zu können, was mich in dem Moment verrückt zu machen drohte: die Furcht vor dem Leben mit einer [18]Behinderung sowie die alltäglichen Dinge im Krankenhaus und die Beziehungen zu Familienmitgliedern. Mit Menschen, denen ich nahestand, hätte ich über all diese Dinge nicht geredet, aus Angst, sie zu verletzen oder zu beleidigen. Ich musste all dies aber in einem sicheren Umfeld loswerden. Dr. Wright hat mir sehr geholfen, und dafür bin ich dankbar. Als wir zusammen zu Mittag aßen, bevor ich das Krankenhaus verließ, erzählte er mir, dass er sich bei mir zum ersten Mal in seiner Karriere nach dem ersten Treffen mit einem Patienten keine Notizen gemacht hatte. „Ich hielt Sie für einen außerordentlich ausgeglichenen Menschen. Sie haben dieses Trauma großartig bewältigt“, erklärte er mir. Dann gab er zu, so viel Freude an unseren Gesprächen gehabt zu haben, dass er sie einige Wochen länger als nötig fortführte.
Da mein rechter Arm gebrochen war, erhielt ich zunächst die Prothese für meinen linken Arm, und so begann der schwierige Prozess der Anpassung an meine Behinderung. Ich musste mich an die Veränderung in meinem Aussehen und meiner Körperwahrnehmung gewöhnen. Dabei stellte ich fest, dass ich die Haltung der Menschen um mich herum unwillkürlich verinnerlicht hatte. Ich kann mich an einen Freund in Lesotho erinnern, der sich für eine junge Frau interessierte. Als er feststellte, dass sie behindert war, änderte sich seine Haltung schlagartig. „Natürlich konnte ich keine Beziehung mit ihr eingehen“, sagte er. Diese negativen Gefühle beschleichen uns alle, und ich bildete da keine Ausnahme. Der Prothetiker half mir, indem er ein Treffen mit einem jungen Mann arrangierte, der beide Hände bei einem Unfall verloren hatte und sein Leben dennoch zielstrebig weiterführte. Ich war dankbar, ein derart starkes Vorbild zu haben.
Kurz nachdem ich meine zweite Prothese erhalten hatte, besuchte mich meine Schwester Helen. Als ich in den Spiegel schaute, war ich entsetzt. „Mein Gott, so werde ich für den Rest meines Lebens aussehen“, dachte ich. In diesem Augenblick verhielt sich Helen wundervoll. Sie war auch der Meinung, dass die Prothesen hässlich waren. Wir saßen zusammen, weinten und tranken etwas Hochprozentiges. Das unausgesprochene Gefühl war etwa: „OK, so ist es nun mal. Tun wir nicht so, als sähe es gut aus.“ Ich werde immer noch jeden Tag unzählige Male daran erinnert, dass ich meine Hände nie wiederbekommen werde. Man trauert über den Verlust eines Körperglieds genauso wie über den eines geliebten Menschen, der ja auch Teil unseres Lebens ist. Er beeinflusst jeden Tag jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens. Das Gefühl ist nicht erdrückend oder übermächtig, aber es ist immer da.
Der Genesungsweg verläuft nicht geradlinig, man geht zwei Schritte vorwärts und einen zurück. Die erste Herausforderung besteht darin, die Behinderung als Realität zu akzeptieren. Die zweite ist funktional – man muss lernen, im Alltag zurechtzukommen. Ursprünglich wünschte ich mir unbedingt Prothesen, die wie Hände aussahen. Die bekam ich auch und habe sie immer noch. Aber sie sind einfach unpraktisch. Ich trug sie ein- oder [19]zweimal, aber letztendlich überwog der praktische Nutzen gegenüber der Ästhetik, und so entschied ich mich für die Haken, die ich jetzt benutze. Bischof John Osmers, mit dem ich befreundet bin, hat vor vielen Jahren in Lesotho einen Arm durch eine Paketbombe verloren. Mir wurde schnell klar, dass es ungleich viel schlimmer ist, beide Hände zu verlieren. John konnte nämlich fast alles mit seiner einen Hand erledigen. Er hatte, wie die meisten Menschen, die „nur“ eine Hand verloren haben, eine Prothese in der Schublade liegen, benutzte sie aber nie. Für mich war es sehr viel schwerer, weil ich die Prothesen für jeden Aspekt des täglichen Lebens brauche.
Bei der zweiten Herausforderung geht es also um die Bewältigung des täglichen Lebens. Die Physiotherapeuten begannen mit den grundlegenden Dingen wie Toilettenbenutzung, Duschen und Anziehen. Besonders bemerkenswert fand ich, mit wie viel Einfühlungsvermögen sie sich bemühten, die Therapie den Besonderheiten meiner Arbeit anzupassen und die Qualität meines täglichen Lebens zu verbessern. „Was müssen Sie als Priester machen? Was brauchen Sie dafür?“ fragten sie mich, da ich ja Priester bin. Ich erklärte, dass ich Gottesdienste abhalten und in der Lage sein muss, ein Auto zu fahren. Sie erkundigten sich auch, was mir im Leben Freude bereitet. Ich antwortete, dass ich gerne fotografiere. Ich folgte ihrer Aufforderung, den Fotoapparat mitzubringen. Sie statteten ihn mit einer Vorrichtung aus, sodass ich ihn halten konnte, was sonst völlig unmöglich gewesen wäre. Sie hätten in mir auch einfach nur einen Körper sehen, mir die technischen Funktionen meiner Prothesen beibringen und mich wegschicken können. Stattdessen bestätigten sie mich als vollwertigen Menschen, indem sie mich fragten, was zu meiner Lebensqualität beiträgt und meinem Leben einen Sinn gibt.
Die dritte und womöglich wichtigste Herausforderung findet auf der geistigen Ebene statt. Ich möchte nicht allzu dramatisch klingen, aber eine derartig schwere Verletzung wirkt verheerend. Niemand kann vorhersehen, wie man darauf reagieren wird. Bis dahin hatte ich mich in meinem Leben nicht unterkriegen lassen. Ich war zweifellos oft auf die Probe gestellt worden und hatte in kritischen Situationen eine gewisse Charakterstärke bewiesen. Dies hier jedoch war eine Herausforderung von ganz anderem Kaliber. Trotz meiner scheinbaren Robustheit hatte ich immer auch das Gefühl, empfindlich und verwundbar zu sein. Ich habe Schmerz nie mit Leichtigkeit ertragen. Nach dem Bombenanschlag hatte ich jedoch solche Schmerzen, dass es kaum vorstellbar ist, dass ein Mensch sie ertragen kann. Dadurch aber wurden in mir ungeahnte Kräfte freigesetzt. Doch nun stellte sich mir eine neue Aufgabe. Wie würde ich auf meine körperliche Einschränkung reagieren? Würde ich lernen, für den Rest meines Lebens Hilfe zu akzeptieren? Im Westen treiben wir den Wunsch nach Selbstständigkeit oft ins Absurde. Natürlich brauchen wir etwas Unabhängigkeit, wo immer das möglich ist. Mir ist jedoch klar geworden, dass nicht nur ich, sondern alle Menschen ein gesundes Maß an gegenseitiger Abhängigkeit akzeptieren lernen müssen. Die [20]Wochen vergingen, und meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Manchmal schafft man’s, manchmal nicht, aber man muss sich eingestehen, dass man seine Unabhängigkeit in einem Maß verloren hat, das man nie wieder ausgleichen kann, und dass man diesem Verlust immer nachtrauern wird. Es gibt unzählige Kleinigkeiten, die wir auf unsere eigene Art und Weise für uns selbst tun. Wenn Menschen uns helfen, tun sie dies auf ihre Art und nicht auf unsere. Das müssen wir akzeptieren, und das fällt uns manchmal recht schwer. Mein Leben würde von jetzt an völlig anders verlaufen, und ich musste mich fragen, was mir in diesem neuen Leben wichtig sein würde. Letztendlich ist dies eine spirituelle Frage, die einen neuen und tiefgründigeren Abschnitt meines Glaubensweges einleitete.
Als strenggläubiger Junge, der ganz in seinem Glauben aufging, stellte ich mir oft vor, wie gläubige Christen Stigmata entwickelten, also Wundmale von der Kreuzigung Jesu auf dem Körper eines Gläubigen. Im Laufe der Zeit wurde immer wieder von Stigmata berichtet, besonders von Mitgliedern geistlicher Orden, denen ich ja beitreten wollte. In meinem Fall handelte es sich um frühreife Vorstellungen eines stark religiös geprägten Jugendlichen. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass ich schließlich die erkennbaren traumatischen Zeichen einer Art von Kreuzigung trug. Selbst aus der Sicht eines gereiften Gläubigen war dies eine Möglichkeit, dem Geschehen Sinn zu verleihen.
Wie so oft in diesen Fällen spricht Gott durch Menschen. Während meiner Genesung erhielt ich viele Botschaften mit Gebeten, Liebesbekundungen und Unterstützung, und ich erinnere mich besonders an die Rolle, die Kinder bei meiner Genesung spielten. Die Wände meines Krankenzimmers waren bedeckt mit Bildern und Zeichnungen, die mir Kinder aus Australien und Kanada, auch meine liebe kleine Nichte Lizzie Bick, zugeschickt hatten. Die kanadischen Kinder hatte ich erst ein paar Wochen vor dem Bombenanschlag kennengelernt, als ich in ihrer Schule in North Bay sprach. Sie waren erschüttert über die Nachricht, weil sie mich kannten und sich mir persönlich verbunden fühlten. Die australischen Kinder hingegen kannten mich nicht, waren aber dennoch von meiner Geschichte ergriffen. Gläubige und nichtgläubige Menschen schickten mir Botschaften der Liebe und des Zuspruchs. Das war das Mittel, mit dem Gott mir ermöglichte, den Anschlag auf mich in Erlösung umzuwandeln, Leben aus dem Tod und Gutes aus Bösem erwachsen zu lassen. „Es war Gottes Wille“, sagen mitunter wohlmeinende Christen. Das weise ich energisch zurück! „Oh, Sie meinen also, dass Gott Briefbomben baut?“, antworte ich darauf. Wenn ich sage, dass mir aus dem Anschlag etwas Erlösendes erwachsen ist, so heißt das nicht, dass das Böse nicht böse bleibt.
Meine Verluste sind offensichtlich dauerhaft, aber ebenso dauerhaft ist der Gewinn für mich und für andere. Ich habe durch den Anschlag zwar viel verloren, aber ich habe immer noch viel und habe auch etwas hinzugewonnen. Mein Lebensweg hat mich unermesslich bereichert, sodass mein Leben nicht nur aus [21]Bedauern besteht. Natürlich denkt ein Teil von mir: „Wenn ich doch nur bemerkt hätte, dass es eine Bombe war, und sie nicht aufgemacht hätte.“ Aber Gott ermöglichte mir, dem Anschlag etwas Erlösendes abzugewinnen. Manche Menschen, denen Schreckliches widerfahren ist, haben wohl überlebt, bleiben aber Gefangene dieses Abschnitts ihrer Vergangenheit. Meiner Meinung nach muss man einen weiteren Schritt bewältigen, indem man vom passiven Objekt der Geschichte – jemand, dem etwas Furchtbares zugefügt wurde – wieder zum aktiven Subjekt der Geschichte wird. Dazu muss man wieder zu einer Person werden, die sich an der Gestaltung der Welt schöpferisch beteiligt. Ich erkannte, dass ich immer Opfer bleiben würde, wenn ich Hass, Bitterkeit und Rachedurst nachgeben würde. Die Unterdrücker hätten dann zwar nicht meinen Körper getötet, aber sicherlich meine Seele. Die Welle von Liebe und Unterstützung, die ich erfuhr, ermöglichte es mir, den Weg vom Opfer zum Überlebenden und schließlich zum Sieger zu gehen. Das ging nicht schnell und es war auch nicht einfach. Es war ein langer Weg, der auch heute noch nicht zu Ende ist. Zunächst ging es darum, gesund zu werden und zu meinem Leben zurückzufinden, um es dann so erfüllt und mit so viel Freude zu leben wie möglich. Das würde mein Sieg sein.
Oft äußern sich Menschen sehr wohlmeinend über mich und stellen mich manchmal auch als Vorbild hin. Manches ist angemessen, aber anderes, obwohl es gut gemeint ist, wirkt entmenschlichend. Ich wäre nicht derjenige, der ich jetzt bin, ohne die Unterstützung der vielen, vielen Menschen, die mich liebten und sich um mich sorgten. Es ist nicht nur mein, sondern auch ihr Sieg. Wir neigen dazu Menschen, die wir bewundern, auf ein Podest zu stellen. Aber ich bin keine Heiligenstatue. Fragt den Menschen, der mir im Alltag hilft, er wird sagen, dass an mir nichts Heiliges ist. Mit meinen vielen menschlichen Schwächen kann ich für andere eher ein Beispiel abgeben als eine Heiligenfigur, die alles ohne Schaden zu nehmen und ohne Widersprüche überstanden hat. Wenn ich durch die Straßen Südafrikas gehe, werden Menschen durch mein Aussehen mit der Wahrheit unseres Volkes und mit dem, was wir uns gegenseitig angetan haben, konfrontiert. Es stimmt also, ich bin ein Symbol des Triumphes über das Unheil, aber genauso bin ich als Mensch mit all meinen Unzulänglichkeiten ein Zeichen dafür, dass Barmherzigkeit und Güte stärker sind als das Böse, als Hass und Tod. In ihrer ganzen Menschlichkeit ist diese Erkenntnis allen Kindern Gottes gegeben, nicht nur ein paar Auserwählten. Ich habe gesiegt, aber die Spuren der Vergangenheit haben mich gezeichnet. So gesehen stellt meine Entwicklung vom Freiheitskämpfer zum Heiler, wie die vieler anderer, eine Parallele zur Entwicklung Südafrikas dar. Wir mussten kämpfen und haben schließlich das Ungeheuer Apartheid erschlagen. Dann jedoch begann der lange Weg der Selbstheilung und des Aufbaus einer neuen Nation, in der alle Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben in vollem Umfang zu leben. Das ist nur möglich, wenn man nicht in der Vergangenheit gefangen bleibt.
[22]