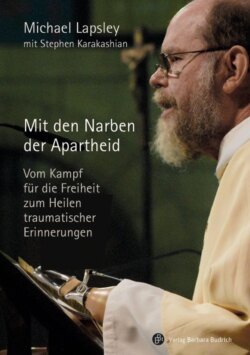Читать книгу Mit den Narben der Apartheid - Michael Lapsley - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[23]3
Behinderung – Versehrtheit als Realität
Es war eine Genugtuung, nach sieben Monaten das Krankenhaus in Australien zu verlassen. Ich hatte nicht nur einen Bombenanschlag überlebt und mehr Operationen überstanden als mir lieb war, sondern war auch wieder auf den Beinen und bereit, mein Leben erneut in die Hand zu nehmen. Meine Widerstandskraft überraschte viele Menschen, ich zweifelte jedoch nie. Es ging einfach darum, das medizinisch Notwendige zu tun. Obwohl meine unmittelbare Zukunft unsicher war, war ich fest davon überzeugt, dass ich eine Zukunft hatte; ich wusste nur noch nicht, wie sie sich gestalten würde. Einerseits war ich noch derselbe unabhängige und dynamische Mensch wie immer, andererseits war nun alles anders. Ohne Hände in der Welt zurechtzukommen bedeutete praktisch, noch einmal ganz von vorn anfangen zu müssen. Ich fühlte mich gleichzeitig verwundbar und zuversichtlich.
Die nächsten Wochen und Monate entpuppten sich als Intensivkurs zur Bewältigung des Lebens mit einer schweren Behinderung. Es war ein hartes Stück Arbeit. Im Krankenhaus hatte ich immer Unterstützung gehabt, aber nun musste ich die Hilfe, die ich brauchte, selbst organisieren. Es gab furchtbar frustrierende Momente, wenn ich allein war und selbst mit simplen Aufgaben, die ich einst ohne nachzudenken erledigen konnte, nicht fertig wurde. Die Physiotherapeuten hatten mich zwar akribisch mit der Anwendung meiner Prothesen vertraut gemacht, nichts kann uns jedoch auf die unzähligen alltäglichen Herausforderungen vorbereiten, für die wir unsere Hände brauchen und deren Bewältigung körperlich unversehrte Menschen für selbstverständlich halten. Als nächstes kam die soziale Anpassung. Behinderungen rufen in vielen von uns starke Gefühle hervor, wohl weil wir dadurch mit unserer eigenen Verwundbarkeit, Zerbrechlichkeit und auch Sterblichkeit konfrontiert werden. Diese Reaktionen können, auch wenn sie unabsichtlich sind, sehr verletzend sein, besonders für jemanden wie mich, der durch sein neues Aussehen noch verunsichert war. Ein Vorfall kurz nach meiner Rückkehr nach Südafrika prägte sich mir besonders tief ein. Ich bog in einem Büro, in dem ich arbeitete, um eine Ecke und stieß fast mit einer Frau zusammen, die gerade von der Toilette kam. Als sie mein Aussehen bemerkte, schaute sie mich tief erschrocken und entsetzt an. Ich erinnere mich lebhaft an den Stich, den ihr Entsetzen auslöste, und daran, wie ich innerlich zusammenzuckte. Bei einer anderen Gelegenheit kaufte ich mit einem Freund in einem Supermarkt in Kapstadt ein. Das Einkaufen strengte mich an, und so [24]beschloss ich, draußen auf ihn zu warten. Vor dem Supermarkt setzte ich mich auf eine Bank. Ich war erstaunt, als kurz darauf eine Frau auf mich zuging und ein Geldstück aus der Tasche holte. Sie streckte es mir entgegen, weil sie mich für einen Bettler hielt. Natürlich hatte ich keine Hände, um das Geldstück entgegenzunehmen, sodass sie erst etwas herumfummelte, dann die Münze wieder einsteckte und verschwand. Solche Vorfälle hinterlassen tiefe Spuren in der Seele eines Menschen. Manchmal bringen sie uns aber auch zum Lachen. Menschen, die weitaus größere Behinderungen haben als ich, zum Beispiel spastische Lähmungen, rufen noch stärkere Gefühle hervor. Ihre Körper können sich auf unvorhersehbare Weise verdrehen, oder sie haben Schwierigkeiten beim Sprechen. In ihrem Inneren verbirgt sich jedoch ein Mensch, der den Schmerz der Abstoßung zutiefst empfindet und sich danach sehnt, dass die anderen mehr in ihm sehen als nur eine Behinderung.
Plötzlich gehörte ich einer Minderheit an, der ich eigentlich nicht hatte beitreten wollen, und entwickelte alsbald ein Gefühl der Verbundenheit mit meinesgleichen. Ich wurde dadurch auch feinfühliger anderen Minderheiten gegenüber, die ebenfalls diskriminiert wurden. Meine Behinderung war nicht zu übersehen. Wenn man mich jemandem vorstellte, konnte ich keine Hand schütteln. Stattdessen bot ich meinen Arm an oder umarmte die Person sanft, aber auch das lenkte die Aufmerksamkeit auf meine Behinderung. Seltsam fand ich es, wenn Menschen darauf bestanden, meinen Metallhaken zu schütteln. Als körperlich unversehrter Mensch hatte ich es verstanden, wie die meisten anderen wohl auch, unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden. Diese Möglichkeit gab es jetzt nicht mehr. Mit der Anonymität war es nunmehr vorbei. Sobald ich einen Raum betrat, starrten manche Menschen auf die Haken an meinen Armen, während andere sich in geradezu absurder Weise bemühten wegzuschauen. Wiederum andere versuchten ihr Unbehagen zu überwinden, indem sie zu mir eilten und mir unerbetene und unnötige Hilfe anboten. Oft denke ich an ein Prinzip meiner Ordensgemeinschaft: „Bürde anderen keine Hilfeleistungen auf, die deiner eigenen Vorstellungswelt entspringen.“
Ich begann, meine eigenen vorgefassten Meinungen über behinderte Menschen unter die Lupe zu nehmen. War ich ihrem Schmerz gegenüber blind gewesen? Hatte ich sie verdinglicht? Als ich tiefer grub, merkte ich beschämt, dass sich meine mangelnde Sensibilität schon in meiner eigenen Familie ausgewirkt hatte. Meine Beziehung zu meinem älteren Bruder Peter war schon immer etwas problematisch gewesen. Er stotterte, während ich als Jugendlicher meine frühreife Religiosität im Brustton der Überzeugung zum Ausdruck brachte. Ich war ausgesprochen wortgewandt, und so fiel es mir in Wortgefechten sehr viel leichter zu punkten als Peter, der damit Schwierigkeiten hatte. Ich sehe jetzt ein, dass ich seine Schwäche auf unfaire Weise ausnutzte, was sicherlich zu unserer distanzierten Beziehung beigetragen hat. Selbstverständlich können Behinderte den Spieß auch umdrehen, indem sie [25]ihre Behinderung gezielt benutzen, um besondere Gefälligkeiten zu erwirken. Nach einem langen, anstrengenden Tag ist es nur allzu einfach, einen Freund zu fragen: „Könntest du dies für mich tun?“, auch wenn ich „dies“ mit etwas mehr Mühe auch selbst erledigen könnte. Außerdem gibt es Tätigkeiten, die mich eine größere Anstrengung kosten würden und die ich grundsätzlich nicht selbst verrichte, wie den Geschirrspüler einräumen, beim Kochen helfen und mein Gepäck tragen. In diesen Momenten denke ich dann: „Naja, eine Behinderung muss ja auch Vorteile haben.“ Schuldgefühle können auch als Waffe benutzt werden, um Menschen zu bestrafen, die auf unsere Ansprüche nicht eingehen. Genauso kann uns die Bewunderung anderer Menschen zu Kopf steigen – verführerisch und zugleich spirituell riskant. Diese gefährlichen Tücken, die Behinderungen mit sich bringen, verleiten uns dazu, in der Opferrolle zu verharren, und können die Beziehungen zu Familie und Freunden zerstören.
Wenn ich gefragt werde, wie meine Hände funktionieren, antworte ich normalerweise, dass sie von Glauben und Hoffnung geführt werden. Mechanisch gesehen sind sie aber mit meinen Schultern verbunden. Wenn ich meine Schulter auf eine bestimmte Weise bewege, öffnen sich die Haken, wenn ich die Schulter anders bewege, öffnen sie sich nicht. Sie sind also fein eingestellte Instrumente, auch wenn sie nicht danach aussehen. Ich kann sogar tippen und Auto fahren. Was ich machen oder nicht machen kann, ist oft nicht vorhersehbar. Es ist für mich zum Beispiel einfacher, Auto zu fahren, meinen Laptop oder mein Handy zu benutzen, als meinen obersten Hemdknopf aufzumachen. Kurz nach meiner Rückkehr nach Südafrika lud mich Erzbischof Tutu zum Abendessen ein. Ich lernte damals noch den Umgang mit meinen Prothesen. Wenn ich zum Beispiel mit dem rechten Haken eine Tasse hielt und gleichzeitig versuchte, mit dem linken etwas anderes zu tun, konnte es durchaus geschehen, dass die Tasse zu Boden fiel. Als Tutu mir dann Kaffee eingoss, rutschte die Tasse prompt weg, und der Kaffee ergoss sich über den Erzbischof. Er fragte mich, ob ich nach Hause wollte, aber ich erwiderte, dass mir eine zweite Tasse Kaffee lieber wäre.
Jede Behinderung hat ihre Besonderheiten. Dies kann man bei Einrichtungen für Behinderte am besten beobachten. Vor einigen Jahren nahm ich an einer Tagung in einem neuen Konferenzzentrum in Johannesburg teil. Die Gastgeber schienen außergewöhnlich erfreut über mein Erscheinen. Ich konnte ihre Begeisterung nicht begreifen, bis sich herausstellte, dass das neue Gebäude mit einer behindertengerechten Suite ausgestattet war. Mit großem Trara führten sie mich dorthin. Ich schaute mich darin um und fand die Suite ziemlich gewöhnlich – ein Bett, ein Stuhl, ein Schrank, also nichts, was man mit einer Behinderung in Verbindung bringen würde. Dann zeigten sie mir das Bad – das einzig Außergewöhnliche war eine Handdusche! Die Designer hatten offensichtlich nicht an mich gedacht. Meine Gastgeber waren bestürzt, als ich sie bat, mir ein anderes Zimmer zu besorgen.
[26]In den USA ist es für mich besonders schwierig, da dort – im Unterschied zu vielen anderen Ländern – die Türen keine Klinken sondern Türknäufe haben und ich es nicht schaffe, diese Knäufe zu drehen. Bei meiner ersten USA-Reise nach dem Attentat konnte ich mein Hotelzimmer weder betreten noch verlassen, ohne den Sicherheitsdienst zu rufen. Daraufhin beschloss ich, nicht mehr ohne persönlichen Assistenten zu reisen.
Vor nicht allzu langer Zeit fuhr ich zu einer Tagung in einem teuer ausgestatteten Bürogebäude im Zentrum von Manhattan in New York City. Wieder wurde mir voller Stolz eine behindertengerechte Toilette gezeigt. Leider hatte auch deren Tür einen runden Knauf. In diesem Fall aber wurde die Tür gleich am darauffolgenden Tag mit einer Art Hebel ausgestattet, den ich betätigen konnte. In Restaurants muss ich oft mit der Bedienung verhandeln, damit ich meinen Tee in einem großen schlanken Glas serviert bekomme, das ich dann auch festhalten kann. Unbegreiflicherweise befürchten die Angestellten trotz meiner gegenteiligen Erfahrung immer wieder, dass das Glas durch den heißen Tee brechen könnte. Ich kann ihnen noch so geduldig erklären, dass das nicht der Fall sein wird, sie beharren dennoch darauf. Gebrochen ist es noch nie.
Zwar hatte mich meine monatelange Genesung die Grundlagen des Lebens mit einer Behinderung gelehrt, doch als ich eine lange Vortragsreise unternahm, kam ich mir vor wie auf einer Weiterbildung. Plötzlich war ich im Ausland gefragter als je zuvor. Mein Schicksal hatte sich herumgesprochen, und viele wollten mir ihren Zuspruch persönlich übermitteln. Auch ich wollte unbedingt allen Menschen danken, die mich bei meiner Genesung begleitet hatten. Endlos über diesen Anschlag zu reden war jedoch anstrengend. Nicht, dass ich das Trauma erneut durchlebt hätte – vielmehr wurde es einfach langweilig. Ich wiederholte die Geschichte immer wieder und dachte innerlich: „Jetzt geht es schon wieder los.“
Politisch war der ANC seit kurzem zugelassen, und es fanden offizielle Verhandlungen zwischen der weißen Regierung und der Freiheitsbewegung statt. Das Land erlebte aber auch eine Welle der Gewalt, als die weiße Regierung die Bevölkerung gegen rivalisierende politische und ethnische Gruppierungen aufzuwiegeln suchte und sie auch gegeneinander aufhetzte. Darüber hinaus verschärfte sie ihre eigene brutale Repression. Das Apartheidregime hatte es geschafft, das gesamte südliche Afrika zu destabilisieren, und ging nunmehr daran, innerhalb von Südafrika dasselbe zu tun. Angesichts der bevorstehenden Wahlen wollte die Regierung die demokratischen Kräfte dazu bringen, sich gegenseitig zu bekämpfen, anstatt die Bevölkerung für die Wahlen zu mobilisieren. Bisweilen wurde vermutet, dass die Regierung in ihrer Naivität glaubte, die Freiheitskämpfer ausmanövrieren und sich an den Kern der politischen Macht klammern zu können. Niemand wusste, wie es ausgehen würde. Würde es zu einem Blutbad kommen? War ein friedlicher Regierungswechsel möglich?
[27]Freunde im Ausland waren gespannt, die Geschichte aus meiner Sicht zu hören, sodass ich schon 18 Monate nach dem Attentat eine doch sehr anstrengende Tour durch Norwegen, Schweden, England, die Vereinigten Staaten und Kanada antrat. Das war wohl etwas voreilig von mir, denn diese Reisen waren immer strapaziös, und ich war ja immer noch nicht ganz bei Kräften und hatte außerdem keine Erfahrung damit, wie man Reisen mit einer Behinderung wie meiner bewältigt. Wenn ich zum Beispiel mit dem Zug anreiste, musste mich jemand am Bahnsteig abholen, da ich ja das Gepäck nicht tragen konnte. Toiletten waren manchmal problematisch. Um ehrlich zu sein, konnte ich selbst nicht immer voraussehen, welche Hilfe ich benötigen würde, und meine Gastgeber waren dazu ebenfalls kaum oder gar nicht in der Lage. So improvisierten wir eben. Ich musste sie oft beschwichtigen, und wenn ich etwas kurz angebunden war, wirkten sie manchmal frustriert. Dann wurden auch endlose Empfänge abgehalten. Manchmal gab es keine Gläser, die ich halten konnte, und natürlich konnte ich mit Appetithäppchen nicht umgehen. Wenn ich mit engen Freunden zusammen bin, bitte ich sie, mir das Essen direkt in den Mund zu schieben, aber bei Fremden war mir da manchmal etwas unbehaglich zumute. All das war neu für mich und bisweilen stressig. Ich kehrte etwas geläutert nach Hause zurück und hatte nun eine realistischere Vorstellung von dem, was solche Reisen mit sich bringen.
Kurz nachdem ich aus dem Krankenhaus in Australien entlassen wurde, kehrte ich nach Simbabwe zurück. Überall schienen die Menschen mich zu erkennen, und sie freuten sich offenkundig darüber, mich wieder auf den Beinen zu sehen. Eines Tages zum Beispiel ging ich mit einem Freund im Park spazieren, als ein Polizist auf uns zutrat und sagte: „Erinnern Sie sich an mich? Ich war einer Ihrer Leibwächter, als Sie im Krankenhaus lagen. Wie fühlen Sie sich jetzt?“ Praktisch jeden Tag erlebte ich solche Momente mit Freunden und auch völlig fremden Menschen. Dies gab mir wirklich das Gefühl, in Simbabwe dazuzugehören und nicht nur ein Verbannter zu sein, der darauf wartete, nach Südafrika zurückzukehren. Kurz nach meiner Ankunft erfuhr ich zu meiner Verblüffung, dass mir in Neuseeland ein Verdienstorden, die Queen’s Service Medal verliehen werden sollte, in Anerkennung meiner Bemühungen um die Befreiung Südafrikas. Wie ich bei der Verleihungszeremonie sagte, wird diese Ehre normalerweise Wirtschaftsführern und pensionierten hohen Armeeoffizieren zuteil, aber bestimmt nicht Priestern, die sich einer nationalen Freiheitsbewegung anschließen und die moralische Zulässigkeit des bewaffneten Kampfs verteidigen! Meine Worte riefen hier und da ein Lächeln hervor, doch niemand protestierte.
Ich begriff aber auch schnell, dass eine Behinderung für viele Menschen etwas völlig Fremdes ist. Zum Beispiel traf ich hin und wieder einige meiner früheren Kampfgefährten. Als ich mich ihnen gegenüber selbst als behindert bezeichnete, fühlten sie sich sichtlich unwohl. „Du bist doch gar nicht behindert!“ sagten sie. Was sollte der Unsinn? Tatsächlich brachten sie damit zum [28]Ausdruck, dass meine Behinderung nicht in ihre Vorstellungswelt passte. Für sie war ich ein im Kampf verwundeter Soldat, und das war’s. Dieses Konzept konnten sie verstehen, ob es meiner Realität entsprach oder nicht. Dass ich nie eine Waffe benutzt hatte, war unwichtig.
Ich fühlte mich bereit, meine Arbeit wieder aufzunehmen, und beschloss, den Bischof aufzusuchen, der mich in der Diözese von Bulawayo als Pfarrer angestellt hatte. Der Anschlag auf mich war zwei Tage vor meinem Amtsantritt verübt worden, sodass ich meine Aufgaben dort nie wahrgenommen hatte. Dieser Bischof war ein lieber Mensch, er hatte mich auch im Krankenhaus besucht und für meine Genesung gebetet. Sieben Monate später stand ich nun vor seiner Tür. Ich erklärte ihm, dass es mir jetzt wieder gut ginge, und dankte ihm für seine Gebete. Dann fragte ich ihn nach der Aufnahme meiner Tätigkeit. Er wurde ganz verlegen, und ich fragte mich, ob er als Bischof vielleicht nicht daran gewöhnt war, dass Gott seine Gebete erhörte. „Aber Sie sind doch behindert. Was können Sie denn tun?“ sagte er schließlich. „Nun, Herr Bischof, ich kann vieles tun, ich kann sogar Auto fahren“, erwiderte ich. Ich sah das Entsetzen in seinen Augen. Vielleicht befürchtete er, mir im Auto zu begegnen. „Wissen Sie, Herr Bischof, ich denke, ich kann ohne Hände ein besserer Priester sein, als ich es mit zwei Händen jemals war“, fügte ich noch hinzu, aber es hatte keinen Zweck. Dieser Bischof war kein schlechter Mensch, er empfand mich jedoch als Belastung. Erzbischof Desmond Tutu hingegen gab mir eine Arbeit in der Diözese von Kapstadt. „Wissen Sie, ich habe einen Priester, der taub ist, und einen anderen, der blind ist. Jetzt habe ich einen ohne Hände. Na los! Worauf warten Sie?“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Ein Bischof sah mich also als Belastung, der andere als Bereicherung.
Es öffneten sich auch andere Türen für mich. Als ich noch in Australien im Krankenhaus lag, bekam ich einen Anruf von Horst Kleinschmidt, einem südafrikanischen Freund, der in London im Exil lebte. Er leitete den International Defense and Aid Fund, eine Organisation, die politischen Gefangenen in Südafrika juristische Unterstützung anbot. Durch seine Arbeit war er immer auf dem neusten Stand der Entwicklungen in Südafrika und wusste, dass das Apartheidregime womöglich seinem Ende entgegen ging. Horst war kurz zuvor zum ersten Mal seit langem nach Südafrika gereist und hatte dort erfahren, dass sich eine Gruppe von Psychotherapeuten mit der Frage befasste, wie man von der Apartheid geschädigten Menschen künftig emotionale und psychologische Unterstützung bieten konnte. Es wurden bereits Pläne geschmiedet, um in Cowley House, einer Einrichtung der anglikanischen Kirche in Kapstadt, ein Zentrum für traumatisierte Gewalt- und Folteropfer aufzubauen. Horst rief mich im Krankenhaus an und meinte, ich sei wie geschaffen für die Arbeit dort. Das Wunderbare an den Reaktionen von Horst und Erzbischof Tutu war, dass sie meinen Schicksalsschlag nicht als Handicap, sondern als Auslöser für die Entwicklung neuer Fähigkeiten betrachteten.
[29]Während der Arbeit an diesem Buch las ich die bemerkenswerte Darstellung einer Behinderung von John Howard Griffin, einem Musiker, Autor und Mystiker, der sich später im sozialen Bereich engagierte und dann durch sein Buch „Black Like Me“ berühmt wurde. Seine Geschichte erweckte in mir einen äußerst persönlichen Aspekt meines Heilungsweges wieder, über den zu reden mir schwerfällt, und bewirkte, dass ich noch einmal über meine eigene Erfahrung nachdachte. In seinem Buch „Scattered Shadows“ beschreibt Griffin, wie er über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg völlig erblindete und zehn Jahre später gänzlich unerwartet sein Sehvermögen wiederfand. Obwohl unsere Lebenswege sich in vielem unterscheiden, spiegelt das Buch im Wechselspiel zwischen unseren Unterschieden und Gemeinsamkeiten jedoch auch meine Entwicklung wider. Als Jugendliche verließen wir beide unser Zuhause und begaben uns in fremden Ländern auf eine Sinnsuche. Für Griffin als Amerikaner bedeutete das zunächst, Antworten in der Musik und einer klassischen französischen Bildung zu suchen, während ich mich der Theologie und dem Priestertum zuwandte. Als junger Mann zog er in den Krieg und erlitt dort eine Verwundung, durch die er erblindete. Später wurde er Pazifist, während ich, zumindest vorübergehend, in die entgegengesetzte Richtung strebte. Unsere Gemeinsamkeit lag in unserem Engagement, Gottes Willen erkennen zu wollen. Seine Geschichte ist die Geschichte eines tiefen Glaubens, aber – und da unterscheiden wir uns – er musste starke Zweifel überwinden, bevor er sich schließlich dem römisch-katholischen Glauben anschloss.
Ich war sehr ergriffen von Griffins emotionalem und spirituellem Ringen mit seiner Behinderung, von seiner außerordentlichen Selbstwahrnehmungsfähigkeit und der kompromisslosen Klarheit, mit der er seine manchmal widersprüchlichen Gefühle darzustellen wusste. In seinen Memoiren lässt er zuweilen andere für sich sprechen. Als er noch ein wenig sehen konnte, besuchte er Tours, wo er einen blinden, heruntergekommenen Straßenhändler traf. Für beide war es eine sehr eindrucksvolle Begegnung: Griffin hatte noch nie zuvor mit jemandem darüber gesprochen, was es heißt, blind zu sein, und der Straßenhändler war nie zuvor wegen seiner Blindheit geschätzt worden. Die Schilderung der schmerzhaften Einsamkeit eines Lebens mit einer Behinderung, wie sie der Straßenhändler beschrieb, wühlte mich im Innersten auf:
Ich lebe seit fast fünfzig Jahren in diesem Viertel. Keiner weiß, wie ich heiße … ich habe keinen Namen, nur eine Behinderung … ich bin der Blinde … Als ich jung war wie du, sehnte ich mich so sehr nach Zuneigung, dass ich es sogar bei Prostituierten versucht habe. Weißt du warum? Es ging eigentlich nicht um Sex, sondern darum, berührt zu werden … Einen Orgasmus kann man kaufen, aber nicht jene liebevollen Berührungen, die ihm Bedeutung geben. Man kauft nur eine elendere Erbärmlichkeit … ich hasste sie deswegen.
[30]
Die persönliche, innere Dimension meiner eigenen Heilung war im Grunde ein spiritueller Weg, auf dem ich Trost in der Weisheit meiner Glaubenstradition fand. Einmal hatte ich eine Ikone der orthodoxen Kirche gesehen, auf der Jesus mit zwei ungleich langen Beinen dargestellt war. Die vorherrschende westliche Ikonografie zeigt Jesus immer mit einem makellosen weißen männlichen Körper – einem Körper, den so niemand besitzt, außer vielleicht in Hollywood. Doch da war er, mit einem gravierenden Mangel, so wie ich. Wahrscheinlich ging das Bild auf Jesajas Gleichnis vom leidenden Knecht zurück:
Siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Gleichwie sich viele an dir ärgern werden, weil seine Gestalt hässlicher ist denn anderer Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder, also wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn welchen nichts davon verkündigt ist, die werden’s mit Lust sehen; und die nichts davon gehört haben, die werden’s merken.
Der leidende Knecht nimmt natürlich den jüdischen Messias vorweg, hässlich, verunglimpft und verschmäht – eine Passage von Jesaja, die durch Händels glorreiches Altsolo „He was despised“ im zweiten Teil seines „Messias“ berühmt wurde:
[31]Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet.
Während ich über diese Bibelpassagen nachdachte und ihre heilsame Wirkung verspürte, begriff ich, dass Behinderung eigentlich die Norm des menschlichen Befindens darstellt. Unvollkommenheit, Unvollständigkeit, Versehrtheit – sie alle sind universelle menschliche Erfahrungen. Menschen mit schlimmen körperlichen Behinderungen spiegeln die Wirklichkeit der gesamten Menschheit wider. Einige Jahre später, bei meiner Arbeit mit dem Institute for Healing of Memories, schafften die sichtbaren Zeichen meines Leidens ein Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen, die ihre eigenen sichtbaren oder unsichtbaren Wunden mit sich trugen. Mit der Zeit überbrückte diese Verbundenheit Kulturen, Religionen und räumliche Entfernung. Schmerz ist tatsächlich ein Weg zur Transzendenz.
Der heilige Laurentius war ein christlicher Märtyrer im zweiten Jahrhundert, dem von römischen Verfolgern befohlen wurde, den Reichtum der Kirche als Tribut abzugeben. Natürlich erwarteten sie Gold und Silber. Stattdessen brachte Laurentius ihnen Alte, Kranke, Blinde und Menschen, die nicht gehen konnten. „Seht her“, sagte er, „sie sind der Reichtum der Kirche.“ Ich verstand, dass behinderte Menschen wie wir der Reichtum der Menschheit sind. Wir sind ein Ausdruck dafür, dass Zerbrechlichkeit, Krankheit und Versehrtheit zwangsläufig zum menschlichen Leben gehören. Durch unser Hilfebedürfnis verkörpern wir die Abhängigkeit der Menschen voneinander. Wir erwecken die Gabe des Mitgefühls in unseren Mitmenschen und erinnern sie daran, dass wir einander brauchen und niemals alleine ganz Mensch sein können. „Ich bin, weil du bist“, lautet ein Sprichwort in vielen afrikanischen Sprachen. Anders ausgedrückt, ein Mensch wird erst durch andere Menschen ein Mensch. In Südafrika sprechen wir von „Ubuntu“, der Großmut auf dem gemeinsamen Weg zur Ganzheit. Wenn behinderte Menschen wie ich einen Platz an der Sonne verlangen, bitten wir unsere Mitmenschen nicht nur darum, nett zu uns zu sein. Unsere Botschaft lautet vielmehr: „Ohne uns könnt ihr keine echte Gemeinschaft erlangen.“ Wir wollen kein Mitleid, sondern Gerechtigkeit. „Schließt uns nicht nur in eure Gemeinschaft mit ein, lasst uns vielmehr gemeinsam eine schaffen“, sagen wir. Das ist eine völlig andere Auffassung.
Manchmal frage ich mich, warum ich den Anschlag überlebte, während ich so viele meiner Freunde zu Grabe getragen und ihnen Lebewohl gesagt habe. Ich glaube, dass die Spuren des Anschlags Zeugnis ablegen von den Grausamkeiten, zu denen wir Menschen fähig sind, und diejenigen als Lügner entlarven, die diesen Horror leugnen oder kleinreden. Wichtiger aber noch ist meines Erachtens, dass Menschen, die sichtbar unter Krieg und Folter gelitten haben, liebevolle Reaktionen in anderen Menschen hervorrufen, was wiederum ein Zeichen dafür ist, dass Gerechtigkeit, Frieden, Güte, Mitgefühl [32]und Hingebung stärker sind als Hass, Gottlosigkeit und Tod. Das ist die Botschaft der Erlösung.
Am 27. April 1991 wurde in der anglikanischen Kirche in Harare ein Dankgottesdienst abgehalten, um den ersten Jahrestag meiner Rettung zu feiern. In meiner Ansprache erklärte ich der Kirchengemeinde, dass ich nur dank ihrer Unterstützung und der Hilfe Gleichgesinnter in aller Welt den Sieg davontragen konnte, und ich schloss mit den Worten:
„Diejenigen, die mir die Briefbombe schickten, sind eher Opfer als ich. Der Anschlag hat nicht nur meinen Glauben und mein Mitgefühl vertieft, sondern auch dazu geführt, dass ich meine Ganzheit verstanden und mich noch stärker für Gerechtigkeit und Freiheit in Südafrika und in der ganzen Region eingesetzt habe … Deswegen sage ich Euch jetzt, herzlichen Glückwunsch! Wir haben gewonnen! Der Sieg ist unser! Makorokoto!“