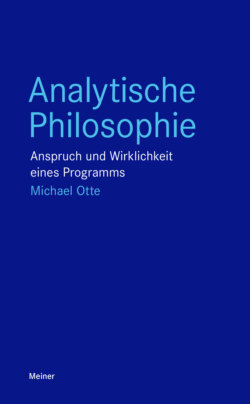Читать книгу Analytische Philosophie - Michael Otte - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.6
ОглавлениеDer Unterschied zwischen Logik einerseits und Mathematik andererseits zeigt sich, wie gesagt, exemplarisch in der Differenz von Sprache und Algebra. Die Mathematik zeigt etwas, und die Logik versucht es zu begründen. Beides ist nicht genau dasselbe, weil vieles, was sich zeigen lässt, u. U. gerade mal keine Begründung findet oder keine Bedeutung und damit keinen weiteren Grund zu haben scheint. Die (konstruktive) Tätigkeit ist eine gegenüber der logischen Analyse und sprachlichen Mitteilung relativ unabhängige Quelle von Entwicklung und Erkenntnis, und zwar eben so, wie die Interpretation einer Darstellung etwas anderes ist als ihre allererste Hervorbringung.
Kant hat eigentlich dasselbe ausgedrückt, indem er sagt, mathematische Urteile seien apodiktisch und intuitiv gewiss. In den Prolegomena zu einer jeden zukünftigen Metaphysik schreibt er: »Wir finden aber, dass alle mathematische Erkenntnis dieses Eigentümliche habe, dass sie ihren Begriff vorher in der Anschauung […] darstellen müsse, ohne welches Mittel sie nicht einen einzigen Schritt tun kann; daher ihre Urteile jederzeit intuitiv sind, anstatt dass sie, wie die Philosophie sich mit diskursiven Urteilen aus bloßen Begriffen begnügen« muss (I. Kant, a. a. O., Paragraph 7).
Nun wird Kants Bezug zur Intuition und zum Gebrauch von Diagrammen in Kreisen der analytischen Philosophie vielfach kritisiert und oft einfach abgekanzelt. So schreibt etwa Friedman: »Kant’s conception of mathematical proof is of course anathema to us. Special figures, however produces are not essential constituents of proofs, but at best aids (and very possibly misleading ones) to the intuitive comprehension of proofs. […] The proof itself is a purely formal or conceptual object, ideally a string of expressions in a given formal language« (M. Friedman, Kant and the Exact Sciences, Harvard University Press 1992, p. 58).
Da Kant vor allem epistemologische Interessen hatte und zeigen wollte, wie es der Mathematik gelingt, Entwicklung der Erkenntnis und ihre Begründung durch Beweise zu verbinden – d. h. wie es sein konnte, dass die Mathematik wesentlich synthetisches und doch apodiktisch gewisses Wissen sein konnte –, scheint der Bezug zur Intuition andererseits vollkommen angemessen. In der Intuition erscheint gewissermaßen das Wesen oder der Grund (die Begründung) einer Sache als Sache oder Form, d. h. als Gegenstand der Anschauung und des Raums. Intuition und Raum sind Kant vor allem Mittel und nicht Grundlagen der Erkenntnis. Und diese Mittel sind deshalb unverzichtbar, weil eben die Mathematik keine Wissenschaft aus Begriffen ist (vgl. das Kant-Zitat in Kapitel I.2.) und ein mathematischer Beweis stets indexikalischer Hinweise auf Begriffsgegenstände bedarf. Beispiel: »Gerade A ist parallel zur Geraden B; oder Winkel a ist gleich dem Winkel b; oder das Dreieck X ist kongruent zum Dreieck Y«, usw.
Auch Hintikka hat auf diesen Aspekt hingewiesen: »Kant’s characterization of mathematics as based on the use of constructions has to be taken to mean merely that, in mathematics, one is all the time introducing particular representatives of general concepts and carrying out arguments in terms of such particular representatives, arguments which cannot be carried out by the sole means of general concepts« (J. Hintikka, »Kant on the Mathematical Method«, in: C. Posy (ed.), Kant’s Philosophy of Mathematics, Dordrecht 1992, p. 24).
Ein Beispiel Kants – dasselbe, das auch Friedmann in dem Zitat kommentiert – mag uns das näherbringen. Wir wollen sehen und damit einsehen, dass die Winkelsumme im (euklidischen) Dreieck zwei rechte Winkel beträgt.
Kant beschreibt in der Kritik der reinen Vernunft den Unterschied zwischen der Vorgehensweise des Philosophen bzw. Logikers auf der einen Seite und des Mathematikers auf der anderen: »Man gebe einem Philosophen den Begriff eines Triangels, und lasse ihn nach seiner Art ausfindig machen, wie sich wohl die Summe seiner Winkel zum rechten verhalten möge. Er hat nun nichts als den Begriff von einer Figur, die in drei geraden Linien eingeschlossen ist, und an ihr den Begriff von ebenso viel Winkeln. Nun mag er diesem Begriffe nachdenken, solange er will, er wird nichts Neues herausbringen. Er kann den Begriff der geraden Linie, oder eines Winkels, oder der Zahl drei zergliedern und deutlich machen, aber nicht auf andere Eigenschaften kommen, die in diesen Begriffen gar nicht liegen.
Allein der Geometer nehme diese Frage vor. Er fängt sofort davon an, einen Triangel zu konstruieren. Weil er weiß, dass zwei rechte Winkel zusammen gerade so viel austragen, als alle berührenden Winkel, die aus einem Punkte auf einer geraden Linie gezogen werden können, zusammen, so verlängert er eine Seite seines Triangels, und bekommt zwei berührende Winkel, die zweien rechten zusammen gleich sind. Nun teilt er den äußeren von diesen Winkeln, indem er eine Linie mit der gegenüberstehenden Seite des Triangels parallel zieht, und sieht, dass hier ein äußerer berührender Winkel entspringe, der einem inneren gleich ist, usw. Er gelangt auf solche Weise durch eine Kette von Schlüssen, immer von der Anschauung geleitet, zur völlig einleuchtenden und zugleich allgemeinen Auflösung der Frage« (KdrV B 743).
Kants Beweis stellt eigentlich ein Gedankenexperiment dar und ist kein eigentlich formal-mathematischer Beweis im heutigen Sinne. Ein Gedankenexperiment bleibt nicht in den Rahmen einer formalen Sprache und Theorie eingeschlossen und erscheint somit als ein Instrument einer genuinen Erkenntniserweiterung. Allerdings kann die Argumentation aus diesem Grunde ihre Voraussetzungen nicht vollständig enthüllen, eben weil sie explorativ angelegt ist. Kant wollte das ja, auch weil er die Mathematik, im Gegensatz zur Logik, als eine gegenständliche Wissenschaft betrachtete und die mathematischen Gegenstände bzw. ihre Konstruktion in einer »reinen Anschauung« verankert sah. Aber so etwas bringt eben Schwierigkeiten mit sich, wenn man das Wesen der Mathematik in Theorien verkörpert sieht und Theorien als Systeme von Sätzen versteht.
Beispielsweise scheint das folgende Gedankenexperiment vollkommen äquivalent zu Kants Argumentationsweise: Nehmen wir an, wir gehen die Peripherie eines Dreiecks ab. Um wie viel Grad haben wir uns dabei gedreht? Einfache Antwort: 360 Grad, denn unsere Ausgangsrichtung stimmt mit dem Ende überein.
Diese Antwort, obwohl anschaulich so einleuchtend wie nur vorstellbar, beruht jedoch auf der Annahme, dass es auf dasselbe hinausläuft, sich einerseits auf der Stelle um einen Vollwinkel von 360 Grad zu drehen oder andererseits eben das zu tun, indem man eine geschlossene Linie abläuft, wie den Rand eines Dreiecks. Das eine beruht allerdings auf lokalen Eigenschaften des Raums, das andere nicht, jedenfalls dann nicht, wenn das Dreieck als beliebig und somit als beliebig groß angenommen werden darf!
Unsere Konklusion ist für beliebige Dreiecke jedoch nur dann wahr, wenn der Raum eine euklidische Struktur besitzt, denn nur in der euklidischen Ebene gibt es formgleiche Dreiecke beliebiger Ausdehnung. Auch Kants Beweis gilt nur unter dieser Bedingung. Anders gesagt, Kants Beweis beruht eigentlich auf der Bedingung, dass es sich um einen euklidischen Raum handelt. So etwas kann man aber nicht sehen oder in der Anschauung darstellen, weil es sich eben um eine globale Eigenschaft des Raums handelt. Unsere anschauliche Erfahrung erfasst nur lokale Bedingungen; alles Weitere müssen wir begrifflich erschließen. Die eigentliche Schwierigkeit besteht aber darin, überhaupt erst zu erkennen, ob globale Eigenschaften involviert sind.
Nun ist für Kant der Raum eben kein Gegenstand, sondern ein Erkenntnismittel. Kant schreibt: »Der Raum […] wird als die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen, und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen, und ist eine Vorstellung a priori, die notwendigerweise äußeren Erscheinungen zum Grunde liegt. Auf diese Notwendigkeit a priori gründet sich die apodiktische Gewißheit aller geometrischen Grundsätze, und die Möglichkeit ihrer Konstruktionen a priori. […] Was von der Erfahrung entlehnt ist, hat auch nur komparative Allgemeinheit, nämlich durch Induktion. Man würde also nur sagen können, so viel zur Zeit noch bemerkt worden, ist kein Raum gefunden worden, der mehr als drei Abmessungen hätte. […] Der Raum ist nichts anderes, als nur die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, d. i. die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist. Weil nun die Rezeptivität des Subjekts, von Gegenständen affiziert zu werden, notwendigerweise vor allen Anschauungen dieser Objekte vorhergeht, so läßt sich verstehen, wie die Form aller Erscheinungen vor allen wirklichen Wahrnehmungen, mithin a priori im Gemüte gegeben sein könne, und wie sie als eine reine Anschauung, in der alle Gegenstände bestimmt werden müssen, Prinzipien der Verhältnisse derselben vor aller Erfahrung enthalten könne. Wir können demnach nur aus dem Standpunkte eines Menschen, vom Raum, von ausgedehnten Wesen usw. reden. Gehen wir von der subjektiven Bedingung ab, unter welcher wir allein äußere Anschauung bekommen können, so wie wir nämlich von den Gegenständen affiziert werden mögen, so bedeutet die Vorstellung vom Raume gar nichts« (KdrV B 38 ff.).
Da dies hier angesprochene Subjekt eine kultur-historische und keine psychologische Größe oder Gegebenheit ist, kann es also sein, dass der Raum, auf dem die reine Anschauung beruht, auch historisch variabel ist. Aus heutiger mathematischer Sicht würde man dementsprechend Kants Argumentation vielleicht folgendermaßen zu ergänzen haben: Wir sehen aufgrund des von Kant beschriebenen Diagramms, dass wenn das Parallelenaxiom der euklidischen Geometrie statthat, dass dann das von Kant beschriebene Diagramm den Beweis erbringt. Unser Ergebnis würde also lauten: Unter Voraussetzung des Parallelenaxioms folgt, dass die Winkelsumme in jedem Dreieck zwei rechten Winkeln gleich ist. Hat dies nun zur Konsequenz, dass wir die Mathematik als eine bloße formale Sprache verstehen müssen? Nicht unbedingt!
Es ist die Gegenständlichkeit der Mathematik wesentlich für die Dynamik der Erkenntnis, und das war Kant wichtig. Der Beweis vollzieht sich entsprechend Kants Vorstellungen »durch die Anschauung des Objekts« und nicht durch die Analyse des gegebenen Begriffs des Objekts. Dies ist ein Ausdruck der epistemologischen Haltung des »klassischen Zeitalters« (Foucault), welches zugleich eine »hohe Zeit der Ideen« genannt worden ist (I. Hacking, Why does Language matter to Philosophy?, Cambridge 1975). Hacking hat Schwierigkeiten mit den Termini Wissen und Theorie (p. 160). Beide entwickeln sich zusammen, meint er, denn Theorien sind der analytischen Philosophie zufolge Systeme von Sätzen und Wissen ist nichts anderes als das, was in sprachlichen Sätzen mitgeteilt werden kann. Vorher regierten Ideen oder Begriffe, die ikonische Bilder der Dinge waren oder, wie Foucault sagt, die mit den Dingen durch die Bande der Ähnlichkeit verbunden schienen.
Vor dem 19. Jahrhundert waren Beweise wesentlich Gedankenexperimente. Wir haben das anhand von Kants Beispielen in der Kritik der reinen Vernunft diskutiert. Kant war kein Platoniker, wie Leibniz oder Galileo, und er wollte das Problem der Ideen durch sein Konzept der »reinen Anschauung« lösen, er sah jedoch die Nähe zum Platonismus. Er schreibt: »Die Mathematik gibt uns ein glänzendes Beispiel, wie weit wir es unabhängig von der Erfahrung in der Erkenntnis a priori bringen können. Nun beschäftigt sie sich zwar mit Gegenständen und Erkenntnissen, bloß so weit als sich solche in der Anschauung darstellen lassen. Aber dieser Umstand wird leicht übersehen, weil gedachte Anschauung selbst a priori gegeben werden kann, mithin von einem bloßen reinen Begriff kaum unterschieden wird. Durch einen solchen Beweis von der Macht der Vernunft aufgemuntert, sieht der Trieb zur Erweiterung keine Grenzen. Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, dass es ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde. Ebenso verließ Plato die Sinnenwelt, weil sie dem Verstande so vielfältige Hindernisse legt, und wagte sich jenseits derselben auf den Flügeln der Ideen, in den leeren Raum des reinen Verstandes. Er bemerkte nicht, dass er durch seine Bemühungen keinen Weg gewönne, denn er hatte keinen Widerhalt, gleichsam zur Unterlage, worauf er sich steifen, und woran er seine Kräfte anwenden konnte, um den Verstand von der Stelle zu bringen« (KdrV B 9).
Worin besteht dann nun eine nicht-platonische und auch nicht auf Sprache beruhende Vorstellung mathematischer Ideen? Wenn der Mathematiker den Begriff des »allgemeinen Dreiecks« benutzt, um einen Satz über Dreiecke zu beweisen, wie Kant das hier beispielhaft illustriert, dann soll dieser Satz nicht notwendig von einer wohlbestimmten Menge von existenten und genau bestimmten Dreiecken handeln, einer Menge, deren Elementen je eine Eigenschaft zugedacht wird, sondern ein solcher Satz meint, dass wenn ein Dreieck vorliegt, es auch die besagte Eigenschaft besitzt. So hat Kant die Sache gesehen und so versteht man sie auch heute in der axiomatischen Mathematik. Weil ein allgemeines geometrisches Dreieck in vielerlei Hinsicht unbestimmt ist, kann ich mir den Begriff des allgemeinen Dreiecks nicht extensional, als wohlbestimmte Menge einzelner individueller Objekte denken. Ein allgemeines Dreieck ist gewissermaßen von der Art einer Idee, eines Zeichens oder eines objektiven Gesetzes, welches es erlaubt, eine unbestimmte und endlose Varietät von Dreiecken sich vorzustellen (Peirce, Collected Papers 8.208), die dann erst im Verlauf des Beweises in je spezifischer Weise näher bestimmt werden.
Die Variable »allgemeines Dreieck« tritt hier jedoch als freie oder allgemeine Gegenstandsvariable und nicht als Leerstelle oder Einsetzungsvariable in Erscheinung, wie dies für formale Sprachen üblich ist. Ähnlich bemerkt Quine, in »Ein Apfel ist eine Frucht« sei es unangebracht, die Variable als Leerstelle, also im Einsetzungsinne zu verstehen, denn »es ist unnatürlich, wenn nicht absurd, sich Namen oder singuläre Beschreibungen für alle Äpfel […] vorzustellen« (W. V. O. Quine, Die Wurzeln der Referenz, Frankfurt 1979, S. 141). Wir sagen ja auch nicht anstatt »Ein Apfel ist eine Frucht« »Jeder Apfel ist eine Frucht«. Formaler ausgedrückt könnte man stattdessen sagen: »Wenn X ein Apfel ist, dann ist X eine Frucht«. Diese Ausdrucksweise gleicht der Präsentation der Axiome, die eine Theorie organisieren. Beispielsweise hat Hilbert selbst darauf hingewiesen, dass die freien Variablen, die in axiomatischen Aussagen auftreten, von dieser Art von Allgemeinheit sind (vgl. Kapitel VI.13).
»Apfel« oder »Mensch«, oder »Kraft« und »Energie«, sind ebensolche freien Variablen oder »idealen Gegenstände«, wie die mathematischen Gegenstände »Zahl« oder »Funktion« oder »Dreieck« usf., d. h. es begegnet uns hier erneut die Analogie von Mathematik und Naturwissenschaft.
Für Kant ist der Raum allerdings weder Begriff (wie bei Aristoteles) noch Gegenstand (wie bei Cantor), sondern Teil des Erkenntnissubjekts. Der Raum ist gewissermaßen Teil der »Objektivität des Subjektiven«, wie man sagen könnte.
In diesem Zusammenhang sind Ausführungen von F. A. Lange in den bereits erwähnten »Logischen Studien« bemerkenswert. Zunächst sieht er mit Kant eine Parallelität, was den Status des Raums und der mathematischen Wahrheiten angeht. Kant postuliert hier bekanntlich die Vorstellung einer »reinen Anschauung«. Lange stimmt Kant zu in der Behauptung, dass die Vorstellung des Raumes »nicht aus den Verhältnissen der äußeren Erscheinung durch Erfahrung erborgt sein« kann. Lange fragt aber nun nicht nur, wie Kant, nach der Grundlage der mathematischen Urteile in der reinen Anschauung, sondern fragt insbesondere, wie dieselben zustande kommen, und er meint, dass der entsprechende Vorgang »demjenigen der Induktion sehr nahe verwandt ist« (a. a. O., S. 130). »Kant überhebt sich dieser Erklärung […] und macht die Erkenntnistheorie zu einer rein metaphysischen Wissenschaft, welche ihre Lehren aus lauter Postulaten deduziert« (S. 131).
Es ist nun diese genetische Herangehensweise, die Lange letztlich dazu bringt, Kants strikte Unterscheidung der analytischen und synthetischen Wahrheiten zu relativieren. Lange fragt nämlich weiter: »Was ist nun diese reine Anschauung. Streng genommen ist sie gar keine Anschauung, sondern nur die im Gemüt bereits liegende Form aller Anschauung. Diese Form kann nicht selbst wieder angeschaut werden, weil dazu Empfindungsmaterial nötig wäre, wenn man nicht ein besonderes übersinnliches Anschauungsvermögen annehmen will. Kant ist dieser Ansicht und will das Unvereinbare vereinen« (S. 132).
In genetischer Hinsicht erscheint Kants starre Hierarchisierung der Bedingungen und des Bedingten tatsächlich nicht vertretbar, sondern man muss genetisch betrachtet eine zirkuläre Verbindung von Bedingungen und Bedingtem der Erkenntnis annehmen. Lange folgert dementsprechend, dass Kants Trennung von Begriff und Anschauung nicht standhält. »In der Tat ist der Begriff der Anschauung immanent. […] Anschauungen ohne Begriff kann es nicht geben, da jede Anschauung sich dadurch von einer bloßen Empfindungsgruppe unterscheidet, dass sie die Anschauung von etwas ist« (S. 134). Und daraus ergibt sich wiederum, dass auch Kants strikte Unterscheidung von Logik und Mathematik sowie die der analytischen und synthetischen Wahrheiten generell der Grundlage entbehrt (S. 9).