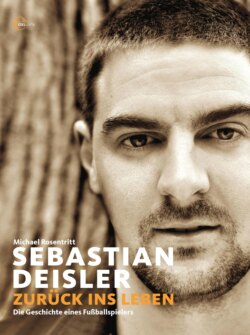Читать книгу Sebastian Deisler - Michael Rosentritt - Страница 4
KINDHEIT – DIE ENTDECKUNG DES TALENTS
ОглавлениеDieser September ist schön. Besonders in der Mitte der Tage. Der Himmel ist noch viele Stunden blau, aber die Blätter an den Bäumen beginnen sich zu wellen. Stille liegt über dem kleinen See an diesem Freitag, dem Vierzehnten. Wir wollen uns in einem Café im Berliner Tiergarten treffen. Die Luft ist klar und mild, man könnte gut draußen sitzen. Dann klingelt das Handy. »Hallo, hier ist der Sebastian. Ich kann dich sehen. Wollen wir uns nicht drinnen setzen?« Ich bin gespannt.
Er sitzt wohl schon seit ein paar Minuten im Wintergarten des Lokals. Zur Begrüßung steht er auf, bleibt dabei aber hinter dem Tisch. Freundlich wirkt er und vertraut, vielleicht ein wenig bemüht. Egal. Wir umarmen einander mit einem leichten Schulterklopfen. Ohne zu zögern. Wie selbstverständlich. Und das nach so langer Zeit. So kommt es mir jedenfalls vor. In der schnelllebigen Fußballwelt, in der ich mich als Journalist seit zwei Jahrzehnten bewege, ist Deisler ein Ehemaliger, ein Fußballer vergangener Zeiten. Ich habe seine Geschichte, seine Karriere verfolgt, von Anfang bis Ende. Es waren nicht einmal zehn Jahre. Sie war so kurz, verlief so rasant, dass ich deren furiosen Beginn immer noch deutlich vor Augen habe. Und natürlich ihr bitteres Ende, Deislers Ausstieg. Ganz wahrhaben wollte ich es lange nicht. Und es geht wohl vielen ähnlich, vermutlich auch ihm, Deisler selbst, so, wie er vor mir sitzt. Eigentlich noch ein ganz junger Mann von 27 Jahren, der schwer gelitten hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist – im Abseits. »Wie geht es dir?«, frage ich. Er sagt, es gehe ihm gut. Zu einer weiteren Nachfrage komme ich nicht. »Weißt du«, sagt er schnell, »ich habe auch schon richtig alt ausgesehen, ganz alt.« Dann winkt er mit seinen Händen in Schulterhöhe ab, einmal, zweimal. Er stützt sich auf die Lehnen, sieht mich an, lächelt zaghaft und zieht seine Brauen hoch. Dann pustet er kräftig aus. Seine Hände stützt er seitlich auf die Oberschenkel, und vieles an ihm wirkt, als wollte er sich entschuldigen und Erklärungen liefern oder umgekehrt. Er wirkt beladen, verhärmt, verbittert.
Sebastian Deisler redet leise. Er sagt ein paar nervöse und hilflose Sätze und erzählt plötzlich, wie er sich auf seiner letzten Pressekonferenz im Januar 2007 sah, als er seinen Ausstieg aus dem Profifußball bekannt gegeben hat. Dabei schlägt er seine Hände über dem Kopf zusammen, spannt den Brustkorb und sagt: »Ich war leer, ich war müde, ich war nicht mehr da.« Lange her, denke ich. Sein letzter großer öffentlicher Auftritt, die Pressekonferenz seines Ausstiegs, liegt jetzt fast auf den Tag genau acht Monate zurück. Jene Pressekonferenz, die Uli Hoeneß, der Manager des FC Bayern, mit Worten begann, die den deutschen Fußball in seinem Innersten trafen: »Es ist kein angenehmer Anlass, weswegen wir Sie hierher gebeten haben. Ich mache es kurz, Sebastian Deisler beendet seine Fußballkarriere.« Danach winkte Deisler noch einmal in die Kameras und verließ den FC Bayern München. Er verschwand aus dem Fußball, aus der Öffentlichkeit und für sich selbst wohl aus einem halbwegs geregelten Leben. Seit diesem Tag hat er mit so gut wie niemandem aus der Fußballwelt ein Wort gewechselt. Damals, nach der Pressekonferenz, ist er nicht einmal mehr in die Kabine zu seinen Mitspielern gegangen, dazu habe ihm die Kraft gefehlt, wie er jetzt sagt: »Ich konnte nicht mehr zurück in diesen Kreis, war so weit weg von der Mannschaft. Ich konnte damals auch ein paar Gesichter nicht mehr sehen. Irgendwann werde ich noch mal hingehen und mich richtig verabschieden.«
Seitdem ist es ruhig geworden um Sebastian Deisler. Er habe ein Leben wie unter Wasser gelebt, unter Brackwasser. Langsam, trüb, treibend. Er war untergetaucht in sich und sein Leiden. Auch wir beide, die wir uns viele Jahre schon kennen und den Kontakt nie haben abreißen lassen, sahen uns lange nicht. Ein paar SMS, nichts Konkretes, nichts Tiefes. Niemand aus dem Reich des Fußballs hat ihn zu Gesicht bekommen, geschweige denn mit ihm gesprochen. Vor einem halben Jahr, im April 2007, hörte ich Uli Hoeneß in einem Radiointerview sagen: »Sebastian ist uns entglitten.« Anderntags füllte die Nachricht sämtliche Zeitungen.
Wir bestellen zwei Cappuccino und eine Flasche Mineralwasser. Er fragt, ob wir uns eine Pizza teilen wollen? Die seien hier besonders groß, das wisse er aus eigener Erfahrung. Berlin hat er in all den Jahren nie ganz verlassen, obwohl er viereinhalb Jahre bei den Bayern spielte. Als er damals, 2002, nach München ging, habe er sich parallel eine Wohnung in Charlottenburg angemietet. Hier habe er bald darauf seine Lebensgefährtin gefunden, eine Brasilianerin, die zuvor jahrelang in Berlin lebte. Mit ihr hat er einen gemeinsamen Sohn. Und hier in Berlin lebten seine Freunde. Eine Handvoll seien es, er habe sie kennengelernt als es ihm am dreckigsten ging, im Frühjahr 2002. Auch deswegen lebe er jetzt wieder in Berlin, einer Stadt, die ihn mit Schimpf und Schande und Pfiffen verabschiedet habe. Irgendwann im Sommer 2007, es müsse Juni gewesen sein, sei er kurz bei Uli Hoeneß gewesen. Er habe ihm gesagt, dass er nicht mehr zum Verein zurückkehren werde. Jetzt ist Sebastian Deisler aufgetaucht, unmittelbar vor mir, mitten in Berlin. Plötzlich, in diesem Moment, ist alles so nah. Alles in ihm ist aufgewühlt. Er schwitzt, hält seinen Kopf gesenkt und rührt gedankenverloren in seinem Cappuccino. Wir schweigen eine Weile.
Vor meinem inneren Auge fliegt seine Karriere im Zeitraffer vorbei. Sein Weg von ganz unten bis ganz nach oben und wieder zurück. Es ist der Weg eines Himmelsstürmers, dessen Tun schon nach wenigen gezeigten Ansätzen von der Öffentlichkeit mit hysterischen Attributen überladen wurde, der sich – oben angekommen – kurz und zaghaft gegen die Mechanismen der Medien gewehrt hat, sich dann verweigerte, an Körper und Geist verschliss und innerlich langsam erlosch. Sein Niedergang, gegen den sich der Fußballer in ihm stemmte, führte ihn in schwere Depressionen, bis der Mensch in ihm, nie so richtig geheilt, endgültig kündigte. Jetzt sagt er: »Ich bin so weit gelaufen, wie mich meine Beine getragen haben, und ich bin einen weiten Weg gegangen, einen sehr weiten. Mehr ging nicht.«
Sebastian Deisler macht keinen guten Eindruck, so viel ist klar nach einer Viertelstunde im September 2007. Ich sehe, wie sehr er mit sich ringt, sich zwingt, Haltung zu bewahren, wie er sich möglichst nichts anmerken lassen will. Dann sagt er, die Schwere von damals hole ihn wieder ein. Aber es ist wohl eher so, dass sie ihn noch nicht wieder verlassen hat. »Hast du Zeit?«, fragt er. »Gut.« Drei Sunden später gehen wir auseinander. Die Sonne ist verschwunden und mit ihr ein Bündel von Mensch. Ich hätte noch so viele Fragen.
Das Leben von Sebastian Deisler beginnt in der Weiler Straße 22 im südbadischen Städtchen Lörrach, genauer gesagt im ehemaligen Vorort Stetten, der heute eingemeindet ist. Die Weiler Straße ist ein schmuckloser Ableger der breiten Landstraße, die 13 Kilometer südwärts Basel erreicht. Hier, im Dreiländereck, am südwestlichsten Zipfel Deutschlands und an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz, wurde Sebastian Deisler am 5. Januar 1980 geboren. Er kommt als zweites Kind von Kilian Deisler, damals 30 Jahre alt, und Gabriele, 27, zur Welt. Schwester Stefanie ist zwei Jahre und zwei Monate alt. Der exakte Zeitpunkt der Geburt ist 19.08 Uhr, wie die Mutter in seinem ersten Fotoalbum festhält. Sebastian Toni Deisler ist 52 Zentimeter groß und wiegt beinahe 3800 Gramm. An Ostern 1980 wird er in Sankt Friedolin in Lörrach getauft.
Lörrach liegt am Rande des südlichen Schwarzwalds, etwa 45.000 Menschen leben hier – gediegen sagen diejenigen, die geblieben oder im Alter zurückgekommen sind. Wie man will, zum Flughafen nach Basel ist es ein Katzensprung, und auch Mulhouse liegt näher als Freiburg. Selbst Mailand ist schneller zu erreichen als München, und der Weg zum Mittelmeer ist nur halb so lang wie der zur deutschen Nordseeküste. Das Klima ist milder als in der restlichen Republik. Überhaupt umgibt sich Lörrach gern mit einem mediterranen Charme. Den Bahnhofsvorplatz säumen zwei Palmen in großen Kübeln, es gibt weit hässlichere Bahnhofsvorplätze. Welchen Weg man von hier aus auch ansteuert, jeder landet früher oder später auf dem Marktplatz mit seinen hübsch getünchten Fassaden und kleinen Gassen, die sternförmig vom Platz ausgehen. Alles in dieser in einer Senke gelegenen fächerartigen Stadt wirkt sauber und aufgeräumt, ein bisschen kleinbürgerlich, beinahe steril. Zu den Kleinigkeiten, die einem Touristen ins Auge springen, zählen die Plastiknachbildungen von Rabenvögeln überall auf den Balkonbrüstungen. Sie dienen der Abschreckung von Tauben, die hier niemand haben mag. Später wird Sebastian Deisler ein wenig schmunzeln über die ersten Eindrücke, die ich von seiner Heimat bekommen habe. In seinem Innersten ist er zutiefst heimatverbunden. Hier ist er zur Schule gegangen und hat die ersten Freundschaften geschlossen. An diesem Ort hat er auch mit dem Fußball begonnen, seiner größten Leidenschaft. Er liebe die Gemütlichkeit der Gegend, die Gastlichkeit ihrer Menschen. Ich werde noch einige Male nach Lörrach fahren, nach Spuren suchen, seine Eltern kennenlernen und alte Bekannte von ihm treffen.
In der Weiler Straße verlebt Sebastian Deisler seine Kindheit. In einem schlichten Viertel mit dreigeschossigen Wohnhäusern und reichlich Industrie und Gewerbe ringsum wächst ein Junge heran, der später einmal die deutsche Fußballwelt aus den Angeln heben soll. Es ist eine bescheidene Gegend, dafür überschaubar, vielleicht etwas eng, aber heil im Vergleich zu denjenigen Orten, an die Deisler im Laufe seiner Fußballerkarriere noch kommen wird. In Stetten stehen Teppichstangen und Wäschespinnen vor den Häusern, und auch sonst scheint vieles in guter Ordnung. Vater Kilian, gelernter Elektriker, arbeitet als Kunststoffschlosser in einer Firma, auf deren Chef er jedoch nicht sonderlich gut zu sprechen ist. Mutter Gabriele ist Hausfrau und die gute, überaus fürsorgliche Seele der Familie. Sie führen »ein normales, ein schönes Leben«. Das erzählt Deisler mit 27, als er schon nicht mehr Profi ist, nicht mehr den deutschen Fußball retten muss und um ein schönes, normales Leben ringt.
Hier, am Rande der Republik, liegt der Ausgangspunkt einer der außergewöhnlichsten Karrieren im deutschen Fußball. Es ist der Werdegang eines Fußballspielers von seltener Begabung und Begeisterung für diesen Sport. Es ist die Karriere eines angehenden Fußballprofis, der mit 15 sein Zuhause verlässt, mit 17 als größtes Talent seit Franz Beckenbauer gepriesen wird, mit 18 in der Bundesliga spielt, mit 21 die Spielmacherrolle in der deutschen Nationalelf übernimmt und dessen Jawort dem FC Bayern 20 Millionen D-Mark wert ist. Es ist die Karriere eines jungen Fußballers, der elf Tage nach seinem 27. Geburtstag völlig entnervt und entkräftet aussteigt aus dem Fußballgeschäft und abrupt von der Bildfläche verschwindet.
Als Sebastian zwei Jahre alt ist, bekommt er seinen ersten Ball geschenkt. »Der Junge ist dem Ball nachgelaufen, als er noch kaum richtig stehen konnte«, hat seine Mutter einmal erzählt. Viel mehr wird von ihr in der Öffentlichkeit in all den bewegenden Jahren nicht zu hören sein. Mit fünf geht ihr Sohn das erste Mal zum richtigen Fußball, zum FV Turmringen, wo der Vater die E-Jugend trainiert. Dumm nur, dass der Knabe für diesen Jahrgang noch viel zu jung ist. Eine tiefere Spielklasse, die F-Jugend oder gar die Bambini, werden in Deutschland erst später eingeführt. Und so startet Sebastian Deislers Karriere in der Warteschleife. Zwei Jahre lang darf er nur trainieren. Er tut es fast jeden Tag. In seinem ersten richtigen Fußballspiel schickt ihn sein Vater für die letzten fünf Minuten aufs Feld. Beim nächsten Mal sind es acht Minuten und bald zehn. Für den Burschen sind es reine Glücksmomente. Wie sein erstes Tor, das er mit sechs Jahren gegen Wittlingen schießt. Zu Hause und in der Schule schildert er es ausführlich – das wird er nie vergessen.
Mit acht Jahren wechselt Sebastian Deisler zum TuS Stetten. Aber weil ihm das immer noch nicht reicht, spielt »der Baschdi«, wie er gerufen wird, weiter auf dem Hof schräg hinter dem Wohnhaus. Und das jeden Tag gleich nach der Schule. Üblicherweise taugen solche Höfe nur bedingt fürs Fußballspielen. Auf einer Seite befinden sich Garagentore, die anderen sind gesäumt von Häuserwänden mit Fensterscheiben, die gern einmal zu Bruch gehen. Nicht selten landet der Ball auf einem Balkon und wird vom leicht genervten Anwohner einkassiert. Wenn es allzu wild wird, zersticht der die Bälle gar. Heute tragen die alten Garagentore ein Schild: »Fußball spielen verboten«.
Die Enge und die ständige Befürchtung, eventuell wieder ein neues Spielgerät auftreiben zu müssen, prägen Konzentration und Geschick der Kinder. Später erzählt Deisler, ihm habe das sehr geholfen. Der Knabe wird besser und besser und ist der ganze Stolz seines Vaters.
Sebastians Großeltern leben nicht weit entfernt. Er mag seine Großeltern. Die Eltern seiner Mutter besucht er besonders gern, denn die können dem Burschen etwas von der großen Fußballwelt erzählen. Opa Karl Heberle spielte in den 50er-Jahren in Straßburg in der französischen Liga. Was für eine Karriere, denkt sich der Kleine, und staunt.
Vater Kilian Deisler nimmt sich viel Zeit für seinen Sohn. Er zeigt ihm die Natur, die es sozusagen im Überfluss gibt. Lörrach ist umgeben von Wäldern, Bergen, Wiesen und Tälern. Vater und Sohn gehen oft wandern. Sein erster Ausflug führte Sebastian auf den Tüllinger Berg, wohin er noch sehr oft kommen wird. Der Junge mag Steine, besonders Kristalle haben es ihm angetan. Gemeinsam mit dem Vater erforscht er Höhlen, und irgendwann bastelt ihm der Vater aus Plexiglas eine große Vitrine, in die er seine Fundstücke legen kann. An Weihnachten und zum Geburtstag bekommt er besondere Stücke geschenkt. Sein erstes Fahrrad erhält er zu seinem siebten Geburtstag, kein nagelneues, aber das spielt keine Rolle. Im Hause Deisler wird das Geld beisammengehalten, damit die Familie zweimal im Jahr in den Urlaub fahren kann. Vorzugsweise nach Südtirol und Spanien, an die Costa Brava. Ansonsten leben die Deislers beschaulich. Ihren Kindern vermitteln sie Werte wie Höflichkeit, Anstand und Freiheit.
Sebastian Deisler kann ein guter Schüler sein, Mathematik gefällt ihm sehr. Doch viel lieber ist er draußen, an der frischen Luft. Der Ball begleitet ihn ständig, entweder unterm Arm oder im Rucksack – selbst wenn sie Wandern gehen und auf Berge kraxeln. Könnte ja sein, dass sich ein Plätzchen zum Kicken bietet. Sebastian ist ein drahtiger Kerl, seine Haare sind mittlerweile Semmelblond. Er trägt eine Kette mit einem kleinen Holzkreuz vor der Brust. Die hat ihm sein Vater gemacht, und er mag sie. Die Kette gibt ihm Kraft und ist etwas, was andere nicht haben. Sebastian ist ein begeisterter Sportler, ein Bewegungstalent. Ob beim Minigolf oder im Handball, der kleine Deisler zählt stets zu den Besten. Das Fahrrad gehört für ihn zum Fußball dazu. Während seine Mitspieler sich an bestimmten Orten treffen, um mit den Autos einiger Väter zum Auswärtsspiel zu gelangen, schnappen sich Vater und Sohn Deisler die Fahrräder. Auch wenn der Spielort mehrere Kilometer entfernt ist oder es gerade regnet. Die Stammstrecke des Gespanns ist 20 Kilometer lang, mittendrin liegt ein traditioneller Rastplatz im Wald. Dort bekommt der Junge eine Lila Pause aus der Lörracher Schokoladenfabrik oder Pommes mit Rahmsoße, was gelegentlich dazu führt, dass die Deislers leicht verspätet am Fußballplatz eintreffen. Doch darum schert sich niemand. Dem Jungen gefällt’s, mit dem Fahrrad zum Spiel zu fahren. »Damit die Muskeln schön warm werden«, erklärt ihm der Vater. Er findet nämlich, dass »der Basti vor den Spielen wie ein Rennpferd in der Box ist – viel zu nervös«, wie er damals jedem erzählt, der sich nach dem ungewöhnlichen Vorprogramm erkundigt.
Beinahe eine Beziehung wie aus dem Bilderbuch entwickelt sich da zwischen Vater und Sohn. Je besser der Bub wird, desto engagierter ist der Vater. Diesem ist längst aufgefallen, dass sein Junge sehr viel fähiger ist als die anderen Kinder, selbst wenn die ein, zwei Jahre älter sind. Größer sind sie ohnehin.
Vier Tage sind seit dem ersten Treffen vergangen. Diesmal hat er ein anderes Café in der Stadt vorgeschlagen. Er kommt auf einem silbernen Mofaroller, verstaut den Helm im Sitzfach und lächelt von Weitem. Sein Händedruck ist hart. Drinnen suchen wir uns ein Plätzchen, etwas abseits, wie er vorschlägt. Der Kellner tritt an den Tisch und strahlt ihn einigermaßen erregt an. Noch bevor wir etwas bestellen, fragt Sebastian: »Es kommt viel hoch. Wollen wir zu mir gehen?«
Draußen erklärt er mir den Weg zu seiner Wohnung. Sie liegt etwa zwei Kilometer von hier entfernt. Luftlinie. Er fährt vorneweg, und ich kann beobachten, wie er immer einmal wieder in seinen linken Rückspiegel schaut. Ich folge ihm, vorbei an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und am Bahnhof Zoo, dann noch ein kurzes Stück. Berlin ist hier groß und schick und ein bisschen mondän. Parkplätze sind teuer und Mangelware. Als ich die Eingangstür des Hauses samt seinem direkt davor geparkten Roller erreiche, brummt bereits der Summer. Schräg über der Haustür hängt eine kleine, kugelige Kameralinse. »Es ist nämlich so«, sagt er, während ich mir die Schuhe in der Diele ausziehe, »neulich standen drei Fotografen vor der Haustür. Den einen kannte ich von früher.« Und? »Ich will das nicht mehr.« Noch im langen Flur erzählt er, dass er vom öffentlichen Interesse, vom Trubel um seine Person erst einmal Abstand gebraucht und die Ruhe genossen habe. Daran wolle er auch nichts mehr ändern. »Ich möchte endlich ein normales Leben führen, das ich bestimme.«
Wir gehen in ein weites Zimmer, und er bietet mir einen Platz an einem großen hellen Holztisch an. Mir gegenüber nimmt er Platz und fragt, wie viel Zeit ich habe. Ich habe Zeit. »Gut, sehr gut«, sagt er und quält sich zu einem Lächeln: »Ich würde mit dir gern ein Buch über mich und meine Geschichte schreiben. Lange habe ich geschwiegen, und es ist leider ein falsches Bild von mir entstanden. Ich möchte die Wahrheit erzählen! Auch über mich!« Eine Weile schweigt er, dann sagt er: »Meine Karriere war eine einzige Flucht. Ich habe so ziemlich alles, was der Fußball hergibt, ausgemessen. Ich war da, wo nur wenige waren – ganz oben und ganz unten. Oft habe ich nicht gewusst, wie es weitergeht. Es war ein Brei. Als es am schlimmsten war, bin ich rausgegangen, bin einfach stehen geblieben. Heute komme ich mir vor wie ein Wrack – ausgelaugt und verkannt. Ich habe mir das alles sehr zu Herzen genommen. Hast du Lust?« Dann springt er auf, geht in die halboffene Küche und kocht still Kaffee.
Sebastian Deisler habe ich kennengelernt, als er von Mönchengladbach nach Berlin wechselte. Das ist jetzt, im September 2007, acht Jahre her. Seit seinem Start als Profifußballer bei Hertha BSC hatten wir uns einige Male unterhalten, meist allein und weit ab von den anderen Journalisten nach den Trainingseinheiten. Und wir sprachen nach Bundesligaspielen miteinander – dann allerdings nicht mehr allein. Sämtliche Reporter bedrängten ihn. Im Januar 2000 haben wir uns im Trainingslager seines Vereins einmal abends im Mannschaftshotel zusammengesetzt und sind ein wenig ins Plaudern gekommen. Er hat mir Privates erzählt, nichts Geheimnisvolles, aber Dinge, die nichts mit Fußball zu tun hatten. Vertrauen? Schwierig. Der Korridor, in dem Profifußballer und Journalisten sich zeitgleich bewegen, ist sehr beweglich und verändert sich ständig. Er weitet und verengt sich. Für beide Seiten ist es nicht immer leicht, die richtige Distanz zu finden, und erst recht nicht, sie zu wahren. Es hängen viele Klischees in der Luft, die mal dicker und mal dünner wird. Wie es eben so ist auf dem Boulevard: gut gespielt, lieb geschrieben; schlecht gespielt, böse geschrieben. Und wir? Vertrauen?
Als Sebastian Deisler nach Berlin wechselte, war sein Image schon vor ihm da. Damals galt er als Jahrhunderttalent. Zwei Dutzend Vereine aus ganz Europa rissen sich um ihn. Als er das erste Mal für Hertha im Olympiastadion auflief, tobte die Masse. Sie wirkte, als sei ihr der Messias erschienen. Und im Hintergrund werkelte ein großes Sportartikelunternehmen bereits an einer gigantischen Werbekampagne. Wie so viele Menschen habe damals auch ich Sebastian Deisler als einen fröhlichen, warmherzigen und unverdorbenen jungen Mann erlebt, dem so wunderbare Sachen auf dem Fußballfeld einfielen, den zusehends aber das ganze Drumherum bedrückte. Der Boulevard sah in ihm den »Basti Fantasti« und stellte ihn in eine Reihe mit David Beckham, den angehenden Weltstar aus England.
Der Beckham von der Spree wollte er nie werden. Für diese Rolle war er viel zu jung, in seiner Persönlichkeit zu unreif und vor allem zu wenig extrovertiert. In diesen ersten Wochen und Monaten drehte sein Umfeld durch, Deisler rang um Normalität und suchte nach Halt. Sein Elternhaus war damit überfordert, während der Verein das gierige Interesse der Öffentlichkeit an einem der ihren genoss. Verständnis für sein gefühltes Unbehagen hatten die wenigsten. Deisler wurde misstrauischer und verschloss sich zusehends. In dieser Zeit habe ich Zugang zu ihm behalten und vielleicht auch sein Vertrauen gewonnen. Wir sind kritisch bei- und zueinander geblieben, darum haben wir uns bemüht. Auch später, als er nach München weitergezogen war, haben wir einen gewissen Kontakt gepflegt, nicht innig oder sonderlich privat, wohl aber geprägt von Respekt und Wärme und immer ohne Öffentlichkeit. Mir hat er ein paar seiner wenigen Interviews gegeben, und ich habe damals ein Gespräch zwischen ihm und Günter Netzer initiiert. Später, schon in München, rief er mich an, als er an Depression erkrankt und stationär in einer Klinik behandelt wurde. Ja, wahrscheinlich hegen wir eine Art Grundvertrauen zueinander. Jetzt also dieses Buch.
Das Leben des sieben-, acht-, neunjährigen Sebastian Deisler besteht bald nur noch aus Fußball. Um sich etwas dazuzuverdienen, trägt er Zeitungen aus. Hinter dem Haus wird gekickt, bis es dunkel ist und niemand mehr etwas sehen kann. Anschließend geht es im Hausflur weiter. Und wenn gar nichts mehr hilft, eben im Korridor der Wohnung, worunter Lampen und Telefon leiden. Doch sein Vater übt Nachsicht und lässt ihn gewähren. In dieser seiner Welt ist Sebastian glücklich. Der Vater sieht vor allem das Talent, das in seinem Sohn steckt, und er selbst spürt dieses Talent auch, allmählich, frei von Hintergedanken. Er ist kindlich begeistert von diesem Spiel, bei dem er in kurzen Hosen über den Rasen rennen kann. Fußball bedeutet ihm Genuss, Freiheit. Ihn berauscht »dieses wunderbare Geräusch, wenn der Ball an die Latte klatscht«, wie er es später einmal, zu Beginn seiner Profikarriere, erzählen wird. In den ersten, in den biegsamen und lastlosen Jahren seiner Laufbahn rennt und dribbelt er und schießt Tore und rennt wieder aufs Neue los, dem Ball hinterher. Denn er will ihn immer haben und bekommt ihn meist auch, weil er damit einiges anzustellen weiß. Oft überlassen sie ihm den Ball freiwillig, nicht selten knöpft er ihn den Mitspielern einfach ab. Auch die anderen merken bald, dass Sebastian mehr drauf hat als sie, deutlich mehr sogar, was nicht alle so toll gefunden hätten, wie er berichtet. Das Verhältnis zu seinen Freunden im Hof, zu Sascha, Jochen, Bülent und Alessandro, bleibt davon nicht unbeschadet. Die Idylle bekommt erste Risse.
Der Vater, zu dem der Junge ein enges, sehr emotionales Verhältnis hat, bastelt bereits an der Karriere seines Sprösslings. Das Talent des Jungen schenkt ihm Abwechslung. Später wird aus der Abwechslung Inhalt und Halt und Kompensation für sein eigenes Leben werden. 1989, im Jahr der deutschen Wiedervereinigung, erleidet Kilian Deisler in der Firma einen Herzinfarkt. Sein Sohn ist mit der E-Jugend des TuS Stetten gerade Hallenmeister von Lörrach geworden. Der Vater übersteht den Herzinfarkt glimpflich, kann aber nicht mehr arbeiten und wird Frührentner. Im Alter von 39 Jahren. Sebastian ist damals neun.
Zehnjährig hockt Sebastian mit seiner ganzen Familie vor dem heimischen Fernseher und verfolgt die Fußballweltmeisterschaft in Italien. Bei jedem Tor der deutschen Nationalmannschaft schwenkt Sebastian seine kleine Deutschlandfahne, die Südbadener sind ein patriotisches Völkchen – als ich während der Fußballeuropameisterschaft 2008, die in der benachbarten Schweiz ausgetragen wird, im Spielort Basel keine Übernachtung finde und kurzerhand über die Grenze nach Lörrach ausweiche, ist nahezu jedes Fenster mit einer Deutschlandfahne beflaggt.
Bei der WM 1990 tut es Sebastian vor allem Lothar Matthäus an. Als die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister wird, rennt Sebastian mit einigen Freunden herunter auf die Straße und jubelt und tanzt und feiert. Er hat nicht den Hauch einer Ahnung davon, dass er, der Junge aus Lörrach, keine zehn Jahre später, nichts Geringeres zu erledigen hat, als den deutschen Fußball zu retten, dass er zur Projektionsfläche all jener werden wird, die von einem neuen deutschen Topfußballer, einem neuen Lothar Matthäus, träumen.
Bald nach dem Sommer wechselt Sebastian zum FV Lörrach, dem prominentesten Klub der Stadt. Ottmar Hitzfeld kickte einst hier, ebenfalls ein Lörracher, genauer gesagt ein Stettener wie die Deislers. Hitzfeld kennt die Familie recht gut, Vater Deisler und er waren Messdiener und spielten gemeinsam in der katholischen Jugend. Sebastians neue Mitspieler beim FV Lörrach im Grüttpark-Stadion, einer eher sterilen Sportanlage, heißen Manni, Marc oder Luigi, allesamt noch halbe Portionen mit dünnen Beinen, wenn auch nicht so dünnen wie diejenigen Deislers. Das rot-schwarz gestreifte Trikot hängt schlabberig an seinen Schultern herab. Gespielt wird gegen Wittlingen, Huttingen oder Haltingen, und in seiner ersten Saison schießt Sebastian fast einhundert Tore. »Der Junge hat hinten den Ball geholt und vorn das Tor gemacht und alles, was dazwischen war, auch.« Dies erzählt Trainer Klaus Rau jenen Reportern, die sich ein paar Jahre später auf Spurensuche nach dem überragenden Talent des deutschen Fußballs machen. Mit elf Jahren ist Deisler ein schmales Bürschchen von zartem Äußeren und mit leuchtenden Augen, und wenn sich beim Lachen sein Mund öffnet, sieht man seine kleine Zahnlücke zwischen den beiden, etwas zu groß geratenen Schneidezähnen. Er sieht irgendwie listig und lustig aus.
Nach der schlimmen Erkrankung und Frühverrentung Kilian Deislers wird die Vater-Sohn-Beziehung noch inniger. Von nun an konzentriert sich der Ehrgeiz des Vaters vollends auf die Entwicklung seines Jungen. Keine zehn Jahre später, als es im deutschen Fußball gewaltig rumpelt und der blonde Junge aus Südbaden für das deutsche Fußballvolk der einzige Hoffnungsschimmer ist, wird Vater Kilian sagen: »Mein Pech war Sebastians Glück« (Die Welt). Der Beglückwünschte selbst sagt im Herbst 2007: »Diese Zeit damals war nicht ganz einfach für meinen Vater – und später auch nicht für mich.«
Sebastian ist längst kein Kind mehr, das einfach nur so Fußball spielt. Dafür ist er zu gut. Überall wo Sebastian auf dem Spielfeld erscheint, ist er der Auffälligste. Doch noch immer denkt Sebastian, irgendwo müsse es doch einen geben, der besser sei als er. Im näheren Umkreis lässt sich ein solcher jedoch nicht auftreiben. Der Radius, in dem sich der heranwachsende Fußballspieler bewegt, weitet sich. Erst zehn, dann 30, bald 50 Kilometer. Selbst bei Turnieren an weit entfernten Orten ist beim besten Willen niemand zu finden, der talentierter ist als Sebastian Deisler: »Das ging immer so weiter. Ich dachte, Mensch, in diesem großen Land gibt es bestimmt viele, die besser sind als ich. Aber den gab es damals wohl nicht. Ich war immer schneller, freier, kreativer und schoss mehr Tore.« 215 sind es in einer D-Jugend-Saison. So etwas spricht sich herum.
Es ist immer noch September. Nichts in seiner Wohnung erinnert an die Vergangenheit, an den Fußballprofi Sebastian Deisler. Nirgends hängt ein Trikot an der Wand, weder von seinem ersten Bundesligaspiel als Mönchengladbacher Profi noch von seinem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Keine Medaillen, keine Pokale, keine Fotos. Nicht einmal Fußballschuhe entdecke ich im offenen Schuhregal im Flur. Einen Ball scheint er auch nicht mehr zu besitzen. So sehen nicht alle Wohnungen von Fußballprofis aus. »Damit habe ich abgeschlossen. Der Fußball, der mir fehlt, ist ein anderer als der, den ich verlassen habe«, sagt er und schiebt dabei Krümel mit seiner Handkante auf dem Tisch zusammen. Das auszusprechen fällt ihm schwer. Er faltet seine Hände, schiebt die Unterlippe vor, sodass sie sich leicht krümmt. Dann sagt er: »Ich habe mir viele Gedanken gemacht und bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich so, wie alles gelaufen ist, nicht geschaffen war für dieses Geschäft.« Ein schwerer Satz, und von solchen hat er so unendlich viele.
Obwohl reichlich Sonne in seine Wohnung scheint, brennen vier, fünf Lampen. Er steht auf und öffnet einige Fenster. Er wirkt, als hinge eine dicke schwarze Wolke schwer über ihm, die er wegschieben oder zumindest aufreißen wollte. »Wir lassen uns Zeit, ja?« Dann setzt er sich.
Ich frage ihn, was mit seiner Familie sei. Mit dieser Frage scheint er gerechnet zu haben. Er steht wieder auf und geht ruhelos auf und ab. Diese Frage scheint ihn zu bedrohen: »Das ist es ja, mir geht es wirklich nicht gut. Mir ist so ziemlich alles weggebrochen, was im Leben wichtig ist: Gesundheit, Beruf und dann die Familie. Es hat eben alles nicht mehr gestimmt. Seit dem Frühjahr leben wir getrennt. Ich habe damals in München, in den letzten Wochen und Monaten meiner Karriere, die Schwere mit nach Hause genommen. Sie hat uns erdrückt. Raphael, mein Sohn, und seine Mutter Eunice sollten nicht mein Leiden mitleiden. Sie leben jetzt in München. Dort haben sie ein Haus. Es geht ihnen gut.« Er sagt das schnell, gerade so, als schäme er sich dafür, dass er nach dem Fußball auch sie, seine eigene kleine Familie, verlassen hat. Seine Stimme klingt dünn, und dann sagt er: »Wenn ich sie nicht gehabt hätte, hätte ich die letzten Jahre im Fußball nicht durchgestanden.« Die letzten Jahre? So sehr viele waren es doch gar nicht, entgegne ich. Sebastian, der inzwischen wieder Platz genommen hat, legt seinen Kopf zur Seite und presst seine Lippen aufeinander. Seine Nasenflügel weiten sich. Ihm kommen Tränen, wenn auch wenige, irgendwie kraftlose. »Ich habe mich trocken geweint. Ist schon okay, schon okay«, sagt er, als spräche er zu sich selbst. Wie oft muss er das in den vergangenen Monaten durchgemacht haben? Nach ein paar Minuten beginnt er, etwas von den ersten Tagen nach seinem Ausstieg im Januar 2007 zu erzählen. Weil sich keine Besserung in seinem Gefühlsleben einstellen wollte, habe er erst einmal München verlassen und sei ans Ende der Welt gereist. Zunächst nach Asien, dann in den hohen Norden. Ohne Familie. Ein befreundetes Paar aus Berlin habe ihn zum Teil begleitet. Wie lange er weg war, könne er nicht mehr so genau sagen. Es müssten einige Wochen gewesen sein, in denen er nur verdrängt habe, »brutal verdrängt«, wie er jetzt sagt. »Ich habe in Thailand in den Sonnenuntergang geguckt und nichts gefühlt.« Er erhebt sich, geht in die Küche und kocht Kaffee. Als er damit fast fertig ist, fällt ihm auf, dass er nicht allein ist. »Möchtest du auch einen?«
Das Reden über seine Vergangenheit strengt ihn an. Er ist ungeübt darin, denn Zeit seiner Karriere hat er sich eigentlich nie jemandem mitgeteilt. Dabei gab es kaum eine Person, die so gefragt war, die so sehr im Fokus stand, wie er. Von keinem anderen Spieler wollten die Journalisten so gern mehr erfahren, dabei wollte doch keiner so wenig von sich preisgeben wie er. Deisler fand überall statt, im Fernsehen, in den Zeitungen, im World Wide Web und in den Köpfen und Herzen von Millionen Menschen. Doch er war wie ein Phantom. Anfangs hatte er auf Fragen noch leise und schüchtern geantwortet. Immer wieder hatte er gesagt, dass er stets nur um des Spielens willen spielen wolle, nicht um ein Star, gar ein Medienstar, eine öffentliche Figur zu werden. Als er sah, wie wenig Berücksichtigung, wie wenig Widerhall seine Worte fanden, versiegte auch dieses Rinnsal von persönlichen Äußerungen. Später konnte ihn niemand mehr deuten und wohl auch nicht mehr mit ihm umgehen. Das ist ein Teil seines Problems gewesen. Erst jetzt, Jahre später und Monate, nachdem er seinen Beruf und damit die öffentliche Bühne verlassen hat, beginnt er sich mitzuteilen. Zaghaft, ungeordnet, emotional, gekränkt. Und auch die Gegenwart, der Alltag im September 2007, scheint ihn anzustrengen. Er dämmert und torkelt und quält sich durch die Tage, die ihm ohne Anfang und Ende vorkommen. Er treibt durch die Zeit. Ohne Verpflichtungen, ohne Termine, einfach nur bei sich wolle er sein, unbeobachtet bei dem Versuch, sich wieder zu erspüren und wiederzubekommen. Doch das gelingt ihm so wenig, weil er seinen neuen Alltag nicht weniger qualvoll empfindet als denjenigen am Ende seines Fußballprofidaseins, dem er zu entkommen hoffte. Mit so etwas wie selbst gestalteter Gegenwart weiß er noch nichts anzufangen. Als Fußballer ist ihm eine solche eigentlich nie gewährt worden. Denn mochte er auf dem Rasen noch so gut gewesen sein, die Träume und Hoffnungen der Öffentlichkeit waren immer noch einen Tick größer. In den Wünschen und Sehnsüchten vieler Menschen gab es da einen immer noch besseren Deisler als den der Realität. »Ich weiß schon, dass ich eine öffentliche Person bin. Ich wünsche mir aber, dass man mir Zeit lässt, in diese Rolle hineinzuwachsen«, war einer seiner wenigen Aussagen damals. Im Nachhinein scheint es, als sei Deisler immerzu getrieben und geschoben worden. Und dann kamen die Verletzungen, die ihn stets zurückwarfen und nach denen er sich immer wieder mühevoll herankämpfen musste. Was war daran Gegenwart? Und auch heute, als Privatperson, als jemand, der sämtliche Verbindungen zum Fußball gekappt, als einer, der sich der Öffentlichkeit vollständig entzogen hat, bekommt er seine Gegenwart nicht zu packen. Es hat den Anschein, als lebe er in einer Art Zwischenzeit, eine, die er erst noch zu durchschreiten hat, um überhaupt irgendwo anzukommen.
Im September 2007 hört Sebastian Deisler sich an wie ein Suchender. Er wirkt verirrt und einsam und ist es wohl auch – in seiner Geschichte und mit sich. Viel Kraft und Lebensmut scheinen ihm nicht geblieben zu sein. Dabei bräuchte er jede Menge davon, um mit seiner Einsamkeit und seinem Scheitern klarzukommen.
Bei ihm zu Hause ist es still. Dumpf dröhnt der Straßenverkehr die Häuserfront herauf. Er wohnt jetzt inmitten der wuseligsten Stadt Deutschlands. Hier, in einem Mehrparteienhaus in Charlottenburg, lebt und hockt der einstige Retter des deutschen Fußballs und ist damit beschäftigt, sich selbst zu retten. »Ich habe keine andere Lösung mehr für mich gesehen, als auszusteigen. Ich möchte so gern zu mir zurückfinden.«
Mit zwölf Jahren wird Sebastian Deisler vom großen Fußball entdeckt. Anfänglich schlägt er den normalen, den Stück für Stück nach oben führenden Weg über die Bezirksauswahl Oberrhein ein, dann aber biegt er ab auf die Überholspur. Er wird in die südbadische Auswahl berufen. Bis hierhin hat er sich nie sonderlich für die Post interessiert. Aber als die ersten Lehrgänge der Auswahl anstehen, rennt er jeden Tag zum Briefkasten. Wann kommt er endlich, dieser eine Brief mit dem Absender: »Deutscher Fußball-Bund«? In seinen Erinnerungen ist es ein großer Tag: »Das Schönste aber war, als ich in der Schule fragen musste, ob ich freikriegen könne, weil mich, nun ja, der DFB eingeladen hat.«
Klaus Niemuth trainiert die Auswahl Südbadens und erkennt das Ausnahmetalent sofort. »Basti wollte immer den Ball haben, obwohl er der Kleinste auf dem Platz war«, berichtet er später. Als er zu einem Turnier nach Freiburg fährt, sind Sebastians Fußballschuhe nicht mehr zu gebrauchen. Sein Vater, der ihn wie immer begleitet, geht auf den Trödelmarkt und kauft dem Jungen ein gebrauchtes Paar, für zwei Mark fünfzig. Sebastian strahlt, denn es sind seine ersten eigenen. Bislang hat er immer Patricks Fußballschuhe von nebenan aufgetragen. Patrick ist zwei Jahre älter und spielt beim FV Turmringen. Die Väter der beiden kennen sich.
In der Zwischenzeit ergeben sich Dinge in der Familie Deisler, wie sie in vielen Familien passieren. Die Ehe gerät in Schieflage und wird bald in den Seilen hängen. Die Eltern verständigen sich auf eine Art Status quo: Sie wollen zusammenbleiben, solange die Kinder noch im Haus sind. An denen geht das Ganze aber nicht spurlos vorbei. Als Sebastian 13 ist, liegt er oft voller Kummer in seinem Bett. Später, als er das Elternhaus verlassen hat und in der aufgedrehten Welt des Profifußballs nach Halt sucht, spürt er mit aller Wucht, dass er den Zusammenbruch der Ehe seiner Eltern nie richtig hat verkraften können. Aber es sind nicht die einzigen Probleme, die sich für den Halbwüchsigen auftun, auch im Hof hinterm Haus geht es nicht mehr unbeschwert zu. Wenn Sebastian sein Können aufblitzen lässt, spielen Neid und Missgunst der anderen mit. Seine Kumpels versuchen, ihn auf anderen Gebieten zu treffen; sie machen sich lustig über ihn, der noch immer keine Haare hat, dort, wo sie bei den anderen längst zu sprießen beginnen. Pubertierende können mitunter sehr gehässig sein. Und überhaupt, während die anderen bereits ihre ersten Mofas fahren, ist im Hause Deisler kein Geld dafür da. Sebastian fühlt sich ausgestoßen. Irgendwann mag er nicht mehr herunter in den Hof gehen und schämt und grämt sich. Er versteht die Welt nicht mehr. Plötzlich soll nicht mehr zählen, was man kann, sondern nur noch, was man hat, wer raucht und wer cool ist – pubertäres Imponiergehabe eben. Als solches kann Sebastian Deisler es zu dem Zeitpunkt nicht einordnen. Das Schlimmste für ihn aber ist, dass seine Kumpel nicht mehr mit ihm reden. Kindereien eigentlich, doch für ihn nimmt die ganze Angelegenheit böse Ausmaße an. Er beginnt sich als Außenseiter zu fühlen. In seiner Kindheit liegen viele Schmerzen begraben. Und obwohl er immer versucht hat, sie zu verdrängen: Freundschaften, so unbekümmert wie in seiner Kindheit, wird er viele Jahre nicht mehr schließen.
Damals ist Sebastian fast fünfzehn und nur 1,58 Meter groß. Er teilt sich, so gut es eben geht, seinen Eltern mit, denn sie sehen, wie bedrückt er ist, dass es ihn wurmt, aber ihnen fehlen die Handhabe und vor allem Lösungen. »Meine Eltern konnten mir da nicht helfen, sie hatten genug Probleme mit sich selbst«, erzählt Deisler heute. »Zu Hause war kein Ort mehr, an dem ich mich zurückziehen konnte, an dem ich Geborgenheit fand.« Für den jungen Deisler eine schmerzhafte Erkenntnis, eine, die er über viele Jahre beiseite schiebt, die er Zeit seines rasanten Aufstiegs, den er noch nehmen wird, zu leugnen versucht. »Die Entwicklung in meinem Elternhaus und das Verhalten meiner damaligen Freunde mir gegenüber hat mich tief getroffen und bitter enttäuscht. Diese Auseinandersetzung habe ich immer gefühlt, auch während ich spielte. Das moderte jahrelang in mir.«
Gut acht Jahre später, als Deisler eine schwere Depression erleidet und sich unter professioneller Anleitung öffnet, kann dieses Außenseitergefühl als eine persönliche Eigenart erkannt werden. Es handelt sich dabei nicht um eine Persönlichkeitsstörung, sondern um eine Persönlichkeitsakzentuierung. Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben Phasen der Verletz- bzw. Verwundbarkeit, sogenannte vulnerable Phasen, insbesondere in der Pubertät. Als seine damaligen Freunde ihm gegenüber ein für ihn nicht mehr tolerierbares Maß überschritten hatten, prägte sich bei Sebastian eine gewisse Empfindlichkeit aus. Nicht selten führt eine solche Akzentuierung zu einer Trübung des Urteilsvermögens und zu Missdeutungen der Umwelt und der Mitmenschen, im Extremfall zu paranoiden Erscheinungen. So jedenfalls die Lehrmeinung der Experten.
Das alles weiß der Halbwüchsige nicht. Instinktiv beschließt er, sich auf sein Talent, auf seine Gabe zu konzentrieren. Als er die ersten Male für die südbadische Auswahl spielt und Erfolg hat, glaubt er einen Ausweg, einen Weg für sich und sein weiteres Leben gefunden zu haben. Das Gefühl, es vielleicht einmal zum Profi bringen zu können, verleiht ihm die Hoffnung, nicht zuletzt auch »dem Schlamassel der Heimat«, wie er es später bezeichnen wird, entfliehen zu können. Er setzt alles auf die Karte Fußball. Der Vater lässt ihn gewähren. In seinen Augen ist Sebastian fußballerisch ein Selbstläufer. Vater Kilian steht draußen am Spielfeldrand und muss gar nichts machen. Der Bengel sprüht nur so vor Spieltrieb. »Später dann, als ich Profi war, wollte ich meinem Vater etwas von meiner Anerkennung abschenken«, erzählt Deisler während eines langen Spaziergangs durch den Berliner Tiergarten im Herbst 2007.
Mit der südbadischen Auswahl reist Sebastian Deisler im Frühjahr 1995 zum Länderpokal nach Duisburg. So weit weg von zu Hause war er mit dem Fußball noch nie. Er fragt seinen Vater, ob er dafür ein Paar neue Fußballschuhe bekommen könne. Für 99 Mark wird ein Paar gekauft – das letzte, für das Geld bezahlt werden muss. Diese Sorge ist er mit dem Moment los, als dem damaligen Mönchengladbacher Jugend-Cheftrainer Norbert Meier sein Talent ins Auge sticht: »Sebastian ist ein absoluter Ausnahmespieler, weil er ständig Lust am Fußballspielen versprüht. Für ihn ist das immer nur Spaß.« Meier, ehemaliger deutscher Nationalspieler, spricht Vater Kilian noch am selben Tag an.
»Mir ist der Sebastian eigentlich schon ein Jahr früher aufgefallen«, erzählt mir Meier im Frühjahr 2009 am Rande eines Länderspiels zwischen Deutschland und Norwegen in Düsseldorf. Meier ist mittlerweile Trainer von Fortuna Düsseldorf, hat aber in all den Jahren die Karriere Deislers aufmerksam verfolgt. »Nach jenem Turnier bin ich mit dem Auto nach Lörrach zur Familie Deisler gefahren. Vater, Mutter, Schwester und Sebastian – alle saßen am Tisch. Wir haben uns eine ganze Weile sehr angeregt unterhalten. Eine wirklich nette Familie.« Natürlich weiß auch Meier, dass die Rivalen Freiburg und Karlsruhe an dem Talent dran sind, und beide Klubs besitzen den Vorteil, dass sie nicht ganz so weit weg sind. Meier hat ein Trikot von Borussia Mönchengladbach und herzliche Grüße des damaligen Managers Rolf Rüssmann mit im Gepäck. Schließlich unterbreitet er der Familie Deisler ein verlockendes Angebot: sofortige Aufnahme von Sebastian im Nachwuchsinternat des Fußballbundesligisten.
Für Klaus Niemuth, den Auswahltrainer Südbadens, steht das Urteil fest: »Der Basti ist nicht mehr aufzuhalten.« Zu einer echten Diskussion kommt es im Hause Deisler nicht. Die Mutter ist zwar nicht so begeistert, dass ihr Sohn schon jetzt das Haus verlässt und ins Internat nach Mönchengladbach geht – er sei noch zu jung und unerfahren. Außerdem möge er doch bitteschön erst noch die zehnte Klasse beenden. Durchsetzen aber kann sie sich nicht, denn der Vater rät seinem Sohn zu. Und auch Sebastian sieht für sich keinen Sinn mehr, in seiner Heimat zu bleiben: »Ich bin es dann mit aller Kraft angegangen. Ich wollte Fußballprofi werden.«
Im Sommer 1995 packt Sebastian seine Sachen, und sein Vater fährt ihn nach Mönchengladbach. Dort bezieht er das vereinseigene Nachwuchsinternat, den sogenannten Fohlenstall. Sonderlich viel weiß er nicht über die Borussia. Der Klub spielt in der Bundesliga, ist gerade Pokalsieger geworden und besitzt als mehrmaliger Deutscher Meister eine gewaltige Tradition. Das war es auch schon. Vom großen Fußball hat er bis hierhin nicht viel mitbekommen, jedenfalls nicht aus nächster Nähe. Mit einer Ausnahme: Als die Familie einmal in der Fränkischen Schweiz Urlaub macht, geht sein Vater mit ihm ins Frankenstadion zum Bundesligaspiel des 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund. Hier endet das erste Fotoalbum des Sebastian Deisler. Und mit ihm seine Kindheit.
Auf dem Tisch stehen Saft, Wasser und zwei dampfende Cappuccino. Und auch Sebastian dampft, er sei heute Morgen joggen gewesen, im Tiergarten, und habe eben noch geduscht. Wir nehmen wie selbstverständlich am Tisch unsere Plätze ein. Er sagt, dass er sich bis heute noch kein Fußballspiel angesehen habe, weder live im Stadion noch im Fernsehen. Neulich habe er überhaupt erst wieder Sport im Fernsehen geschaut: Leichtathletik-WM in Osaka, das Finale über 100 Meter, »der Frauen«, wie er sagt. Es war eine Aufzeichnung. Und Fußball? »Ich kann das nicht«, flüstert er und schiebt leise ein »noch nicht« hinterher. Er möchte ja schon, aber er müsse dafür bereit sein, möchte selbst entscheiden, wann und wo und was. Dabei guckt er herüber zu seinem Fernseher. Das ist nicht irgendein Fernseher. Er ist flach und groß, vor allem breit, vielleicht das einzig übrig gebliebene Relikt aus seiner Fußballprofizeit. »Stimmt«, sagt er und muss feixen. Wenn der Fernseher aus ist, sieht er kalt aus und passt so gar nicht in die Atmosphäre des Raumes. Irgendetwas Felsiges, beinahe Bedrohliches hat er an sich. Wenn er eingeschaltet ist, schwindet dieser Eindruck. Aber man müsse weit weg sitzen, um nicht erschlagen zu werden von den Bildern. Platz ist da, alles ist hell, die Pflanzen gedeihen zwischen den wenigen Möbeln aus warmem Holz. Die Stücke haben weiche Linien und sind großzügig verteilt. Wenn das mit dem Fußball nicht geklappt hätte, wäre er wohl Tischler geworden, hatte er einmal erzählt, als er noch Nationalspieler war. Und jetzt?
Auf dem Esstisch liegt ein Zettel. Er hat sich Notizen gemacht, ungeordnet wie mir scheint. Auf der Couchlehne liegen aufgeklappte Bücher mit ihren Rücken nach oben. Die Titel pendeln zwischen Anatomie und Anamnese, zwischen Psychologie und Naturheilkunde. Sucht er Ablenkung oder Antworten? »Beides«, sagt er und meint damit wohl einen neuen Sinn in seinem Leben und endlich so etwas wie Halt.