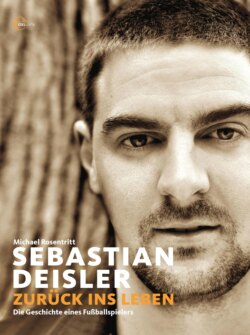Читать книгу Sebastian Deisler - Michael Rosentritt - Страница 8
DAS TOR DER ERLÖSUNG
ОглавлениеDer 6. März 1999 ist ein Tag, der sich in Deislers Leben und Erinnerung eingebrannt hat. Dieser Tag verändert sein Leben auf einen Schlag. Seine Mannschaft ist seit Herbst Tabellenletzter, zwischenzeitlich betrug der Abstand zu einem Nichtabstiegsplatz acht Punkte. Und jetzt kommt der TSV 1860 München. Michael Klinkert gelingt kurz vor der Halbzeitpause das 1:0 für die Gladbacher, die ein ausverkauftes Haus im Rücken haben. In der 75. Spielminute rettet Zejlko Sopic in der eigenen Hälfte den Ball mit einer Grätsche vor dem Seitenaus. Noch im Rutschen spielt er den Ball auf Deisler. Es ist ein schöner Frühlingstag und genau eine Minute nach 17 Uhr, so werden es hinterher die Zeitungen in diesem Land festhalten. Um 17.01 Uhr also fällt der Ball Sebastian Deisler vor die Füße. Diesen Ball wird er in jener 75. Spielminute über die nächsten 60 Meter nicht mehr hergeben. Deisler schwebt mit Dynamik und Leichtigkeit über das Feld, an mehreren Münchner Profis vorbei und schießt am Ende dieses atemraubenden Solos den Ball aus vollem Lauf mit links in die sich weit beulenden Maschen des Tornetzes. Es steht 2:0. In der Süddeutschen Zeitung ist zu lesen: »Der Ball schlug an derselben Stelle ein wie Netzers 2:1 im Pokalfinale gegen Köln 1973.« Und tatsächlich, die Zuschauer am Bökelberg fühlen, wie sie zu Zeugen eines ganz besonderen Moments werden. »Nie mehr Zweite Liga«, brüllt der Stadionchor. Unter den Fans der Borussia macht sich die Überzeugung breit, mit einem wie dem 19-jährigen Deisler dem Abstieg tatsächlich entkommen zu können. Für sie ist dieses Tor ein wahres Erweckungserlebnis. Es könnte der Anfang sein von etwas Großem, auf das man in Gladbach seit zwanzig Jahren wartet. Noch ahnt niemand, dass dieses Tor einmal sinnbildlich für Deislers Karriere stehen wird. Mit nur einem Dreh, einer genialen Aktion, kann dieser Spieler so viele Hoffnungen wecken – diese Hoffnungen werden seine Karriere begleiten bis in ihr Aus.
An diesem Nachmittag, kurz nach dem Tor, herrscht eine selten erlebte Atmosphäre im Stadion. Deisler jubelt, er dreht eine halbe Stadionrunde, seine Augen sind weit aufgerissen. Hinterher gibt er sich bei den Reportern bescheiden: »Das war mit links, da treff ich normal nie.« Das ist natürlich gelogen, steht aber für sein Wesen und die Unbekümmertheit in diesen Monaten. Für den Teenager ist es sein erstes Bundesligator. Für Deutschland ist es mehr, für Deutschland ist es eine Art Erlösung.
Bei einem Spaziergang erzähle ich ihm von Bayerns neuem Supertalent Toni Kroos. Der ist fast auf den Tag genau zehn Jahre jünger als Deisler, hat die deutsche U-17-Auswahl bei der Weltmeisterschaft in Südkorea zu Platz drei geführt und ist zum Spieler des Turniers gewählt worden. Kroos ist Bayerns neues Kronjuwel. Gerade eben hat dieses neue Megatalent im Europapokal in Belgrad das Spiel bei Roter Stern gedreht. Nach seiner Einwechslung bereitete er ein Tor vor, erzielte eins selbst und machte so in den letzten vier Spielminuten aus einem 1:2 ein 3:2. Während die Münchner Boulevardblätter das ganz »Kroos-artig« fanden, maßregelte Manager Uli Hoeneß die Journalisten. »Wir müssen aufpassen, dass der Junge nicht so hochgejubelt wird.« Noch am Abend in Belgrad, als Kroos zum Matchwinner avancierte, hatte Hoeneß mit hochrotem Kopf jeden Fragesteller abgebügelt. Wer habe zwei der drei Bayern-Tore geschossen?, hatte Hoeneß rhetorisch gefragt und selbst geantwortet. »Klose, nicht wahr? Wer war also der Matchwinner?« In den Tagen danach entflammt in den deutschen Medien eine große Diskussion. Die Sport Bild etwa schreibt: »Vorsicht! Bitte nicht loben«, denn Kroos solle kein zweiter Deisler werden. Als andere Blätter diesen Jüngling schon mit Franz Beckenbauer vergleichen, schreitet Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ein und fordert die Journalisten über das Stadionmagazin des FC Bayern auf, diese Vergleiche zu unterlassen. Als eine der ersten Maßnahmen erteilt Hoeneß seinem Talent ein striktes Interviewverbot.
Deisler hat bis hierhin kein Wort gesprochen. Dann sagt er: »Den ruhigen Weg gehen können, das hätte ich mir damals auch gewünscht.« Aber da sei niemand gewesen, der die Bürde von ihm genommen hätte, der ihm den Rücken gestärkt, geschweige denn, sich vor ihn gestellt hätte. Und die Last sei riesig gewesen, eine Last, die er nicht habe teilen können, weil kein anderer in Sicht gewesen sei. »Was erzähle ich, das ist vorbei«, sagt er, stellt den Kragen seiner Jacke hoch und presst seine Lippen aufeinander. Nach einer Weile fährt er fort: »Es ist wohl so, dass mit diesem Tor gegen die Löwen alles begann. In Mönchengladbach gab es immer donnerstags eine Pressekonferenz. In der Woche nach dem 1860-Spiel musste ich da gemeinsam mit unserem Trainer Rainer Bonhof hin. Der Pressesprecher hatte mich am Tag vorher informiert. Es gibt da so viele Anfragen, hat er gesagt, da ist es besser, wenn du bei der Pressekonferenz ein bisschen was erzählst. Ich hab gedacht: Wie? Moment mal, Pressekonferenz? Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Was soll ich denn da sagen? Nee, nee, nee, ich will nicht. Da hat der Pressesprecher mir erklärt: Du brauchst im Grunde gar nichts zu sagen. Alles, was du sagst, ist okay.« Wir gehen eine Weile stumm nebeneinander her. Dann sagt Deisler: »Sie fingen an, mir etwas überzustülpen, von dem ich erst nicht genau wusste, was. Später, als ich nach Berlin kam und es wahrscheinlich schon zu spät war, merkte ich, was es war – eine neue, eine andere Identität. Plötzlich hatte ich ein Medienstar zu sein, dessen Privatleben in die Öffentlichkeit gezogen wird, der zu funktionieren hat. Das wollte und konnte ich aber nie erfüllen. Ich war mal ein glücklicher Junge, ein echter Strahlemann. Ich habe nie gedacht, dass ich etwas Besonderes bin, nur weil ich ganz gut Fußball spielen konnte. Warum lässt man die Jungs nicht einfach spielen und so sein, wie sie sind?«
Er geht ein kleines Stück voraus, und plötzlich mimt er den Jubel seines ersten Tores nach. Er rennt kurz an, zwei, drei Schritte, springt, reißt wie für die Kameras seine Augen auf, landet, geht leicht in die Knie und ballt schräg vor seinem leicht nach vorn gekrümmten Körper die Fäuste.
Dieses Tor fällt mitten hinein in die allgemeine Trostlosigkeit, in der sich der deutsche Fußball seit Monaten befindet. Genau genommen steckt der Fußball des dreifachen Welt- und Europameisters seit Jahren schon in einer tiefen Depression. Unter Bundestrainer Berti Vogts war die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA im Viertelfinale an Bulgarien gescheitert. Anschließend erklärten einige Weltmeister von 1990 wie Andreas Brehme und Rudi Völler ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Und auch die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich endete für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes denkbar indiskutabel. Die deutsche Elf scheiterte erneut im Viertelfinale, diesmal an Kroatien. Nach dem Debakel von Lyon beendeten Spieler wie Jürgen Klinsmann, Andreas Köpke oder Jürgen Kohler ihre Auswahlkarrieren. Und gerade eben, im Frühjahr 1999, hat auch Andreas Möller sein letztes Spiel für Deutschland bestritten.
In der allgemein gefühlten Erniedrigung und in Ermangelung neuer Hoffnungsträger drängen die Boulevardmedien den Bundestrainer zur Reaktivierung Stefan Effenbergs. Vogts, der Effenberg beim WM-Turnier 1994 wegen einer obszönen Geste gegen die eigenen Fans noch aussortiert hatte, gibt der Forderung nach. Nach einer sich anschließenden, völlig missratenen Länderspielreise nach Malta wirft der Bundestrainer – von der Bild-Zeitung auf der Titelseite zur Signatur eines abgedruckten Kündigungsschreibens aufgefordert – entnervt das Handtuch. Vogts war nie ein Mann des Springer-Konzerns. Schon als Spieler, zwar Weltmeister 1974, aber doch nur rechter Verteidiger, haftete ihm das Image des Wadenbeißers an. Und auch als Trainer hatte er für den Geschmack des Boulevards zu wenig Glamouröses an sich und obendrein eine eigene Meinung. Aus Vogts’ Mund selbst stammt die wohl treffendste Beschreibung dessen, wie ihn die breite Öffentlichkeit sah: »Selbst wenn ich übers Wasser laufen könnte, würden die Leute sagen: Seht, schwimmen kann er auch nicht.«
Wie heruntergekommen das Image des deutschen Fußballs ist, beweist auch die Absagenflut geeigneter Kandidaten für den vielleicht zweitwichtigsten Job im Land nach dem des Bundeskanzlers. Otto Rehhagel und Ottmar Hitzfeld verweisen auf bestehende Anstellungsverhältnisse bei ihren Klubs, Jupp Heynckes, dessen Engagement bei Real Madrid zu Ende gegangen ist, will sich lieber seiner erkrankten Frau widmen. So fällt im September 1998 die Wahl des DFB auf Erich Ribbeck als Teamchef. Der 61-Jährige hat sich längst aus dem Fußballbetrieb auf die Ferieninsel Teneriffa zurückgezogen. Nach seiner Ernennung zum Teamchef bezeichnet sich der joviale Wuppertaler lakonisch als siebte Wahl. Während sich der damals einflussreiche Sportchef des Leverkusener Bayer-Konzerns, Jürgen von Einem, noch diplomatisch auszudrücken versucht (»Wenn man dazu etwas Positives sagen will, so ist dem DFB eine Überraschung gelungen.«), spricht Werner Lorant, Trainer von 1860 München, aus, was Millionen Deutsche denken: »Ribbeck ist so weit weg vom Fußball wie die Erde vom Mond.«
Auf der deutschen Erde aber gibt es ja jetzt diesen jungen Mönchengladbacher, ein Geschenk des Himmels, wie es heißt, schließlich hat er ein Tor geschossen, wie es in seiner Entstehung und Vollendung seit Günter Netzers legendärem Pokalfinalsiegtor nach Selbsteinwechslung nicht mehr gefallen ist. Was in den nächsten Tagen abläuft, ist in dieser Form zuvor noch nicht da gewesen. Nicht bei Franz Beckenbauer, Paul Breitner oder Gerd Müller, den Weltmeistern von 1974. Auch bei Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Rudi Völler nicht, den Weltmeistern von 1990. (Und heute, nach Deisler, weiß man, dass es so auch nicht mehr werden wird, weder bei Miroslav Klose, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger noch bei Michael Ballack. Diese großen Spieler kreuzten nie allein auf.) Es sollen noch Zeiten kommen, da kommt ein Michael Ballack erst ins Spiel der Nationalmannschaft, wenn Deisler ausgewechselt wird. Ballack ist zwar schon seit 1997 Profi und vier Jahre älter, stabiler und robuster, aber den großen Wurf traut man dem Sachsen nicht zu.
Mehrere Jahre findet sich an der Seite Deislers niemand, der auch nur ansatzweise einen Teil der Erwartungen einer gedemütigten Fußballnation mittragen könnte. Es gibt einfach kein zweites taugliches und tragfähiges Talent im deutschen Fußball. Aber erst im Frühjahr 2001, als die Lobpreisungen auf Deisler und die damit einhergehende Last der Zuneigung einen für den jungen Mann unverdaulichen Dreh bekommen haben, gesteht der DFB den nationalen Notstand ein und legt ein millionenschweres Nachwuchskonzept auf. Die Deislers müssen früher erkannt werden, heißt es in den Hochglanzbroschüren und auf den CD-Roms. Die Sichtung solle nicht erst in der C-Jugend, sondern müsse schon bei den Elf- und Zwölfjährigen beginnen. 400 Leistungszentren sollen entsehen, weshalb der DFB seine Aufwendungen von jährlich zwei auf dann 14 Millionen zu erhöhen bereit ist. Bis dahin aber wird der Jungstar Sebastian Deisler der ganze und einzige Stolz des DFB bleiben. Bis es also soweit ist, dass das millionenschwere Konzept anläuft, versteckt der weltgrößte Sportverband seine unterentwickelte Jugendarbeit hinter den Hymnen auf Deisler.
Und die Hymnen klingen schön und laut im Frühjahr 1999. Immerhin gibt es da jene Spielszene, in die sich so viel Hoffnung hineindeuten lässt. Immer und immer wieder wird diese Aktion gegen 1860 München im Fernsehen gezeigt. Der Sololauf, der dynamische und umwerfende Zug zum Tor, der brillante Abschluss. Von links nach rechts, von vorn nach hinten und in Zeitlupe. Und mit jedem Mal, mit jeder Wiederholung, wird Deisler größer, heldenhafter.
Das ist zwangsläufig so, zumal das Fernsehen seit Aufkommen der Privat- und Bezahlsender das Bild der meisten Menschen von Fußball immer stärker in ganz bestimmter Weise prägt. Oft sind ein Dutzend Kameras pro Spiel im Einsatz. So kommt es zu einer enormen Verdichtung der bildlichen Darbietungen. Einen vorläufigen Höhepunkt erfährt diese Entwicklung bei der Europameisterschaft 2008, bei der unter anderem eine Super-Super-Zeitlupe zum Einsatz kommt. Die entsprechende Ultra-High-Speed-Kamera überträgt 1500 Bilder in der Sekunde. (Zum Vergleich: Eine herkömmliche Kamera liefert lediglich 75 Bilder pro Sekunde.) Jede Pore in Michael Ballacks Gesicht ist zu sehen, als er im Vorrundenspiel gegen Österreich zum entscheidenden Freistoß anläuft. Der Einsatz hochmoderner Technik gepaart mit geschickter Bildregie führt zu einer Verschiebung der Wahrnehmung, die mit der eigentlichen Qualität des Spiels nichts mehr zu tun hat. Das Bild der Zuschauer vom Fußball wird eins mit dem Fernsehbild, das immer mehr ein inszeniertes ist, denn im Prozess der Medialisierung des Fußballs ist der sportliche Wert des Ereignisses nur noch ein Teilaspekt. Einzelne, tatsächlich gelungene Szenen werden endlos wiederholt und dem Zuschauer aufgedrängt, sodass es schlicht zur Überhöhung des Spiels und einzelner Spieler kommt. Diejenigen, die den Fußball in der Leistungsspitze ausüben, werden zu Stars, zu Helden, denn Fußball ist als garantierter Quotenbringer für die Medien der wichtigste Rohstoff. Mit schöner Regelmäßigkeit wird der medial inszenierte Fußball als Unterhaltungsangebot von einem Millionenpublikum nachgefragt. Täglich.
Und so feiern die Medien 1999 die Geburtsstunde eines »Jahrhunderttalents«. Die Rede ist von einer Erscheinung auf dem Fußballplatz, die »irgendwann in einem Atemzug mit Fritz Walter, Uwe Seeler und Franz Beckenbauer genannt werden wird«, wie es der frühere Gladbacher Trainer Friedel Rausch sagt: »Man sollte vorsichtig sein mit dem Begriff, aber Deisler ist eines.« Das Tor ist nicht nur Deislers Durchbruch, sondern – wie sich alsbald zeigen wird – ein Dammbruch der Volksseele. Der 19-Jährige wird fortan behandelt werden als das Heilsversprechen des deutschen Fußballs. Und darunter leidet er mehr als unter jeder weiteren Knieverletzung.
Tatsächlich ist sein außergewöhnliches Talent erahnbar, für Fachleute unübersehbar. Aber schon das eine Tor, die Andeutung dieser Begabung, führt in diesen ersten Tagen und Wochen zu einem beispiellosen Hype. Interviewanfragen trudeln zuhauf ins Haus. Anfänglich genießt Deisler die Wertschätzungen der Medien und die Zuneigung der deutschen Fußballfans – weil er nicht ahnen kann, welche Ausmaße sie noch annehmen werden. Deisler gibt gern Auskunft, ohne wirklich viel zu sagen. »Ich mache mein Spiel und versuche, den Erwartungen gerecht zu werden«, ist so ein Satz (Rheinische Post). Instinktiv spürt er, dass etwas aus dem Ruder zu laufen droht. Bald, insbesondere in Berlin, bekommt er zu spüren, dass es bei der Zuneigung nicht um ihn selbst geht, sondern um die Volksseele; eigentlich wird es nie um ihn gehen, nicht um den Menschen Sebastian Deisler, der aufgrund zahlreicher Muskelfaserrisse und Knieoperationen zahlreiche schmerzhafte Auszeiten erlebt (und immer wieder bangt, ob er überhaupt weiter Fußball spielen kann), sondern immer nur darum, dass da wieder ein Fußballer ist, ein neuer Beckenbauer, ein »Basti Fantasti«, der das heruntergekommene Ansehen einer Fußballnation aufpolieren kann. Und diese Zuneigung wird drei Jahre lang, seine ganze Berliner Zeit, anhalten, bis andere Spieler bei der Weltmeisterschaft 2002 in Asien zum Vorschein kommen. Zu diesem Zeitpunkt aber haben die hysterische Zuneigung und Zudringlichkeit der Öffentlichkeit sowie die Imperative einer sich überschlagenden Medienlandschaft das Innere des jungen Mannes bereits nachhaltig deformiert. Erst Jahre nach dem Ende seiner Karriere erkennt Sebastian Deisler, dass hierin ein Teil seines Scheiterns begründet liegt. Es gehört zur besonderen Tragik seiner Geschichte, dass dieser Teil bereits am Beginn seiner Profikarriere liegt.
Im Frühjahr 1999 muss Sebastian Deisler, der eigentlich noch in der U-18-Mannschaft spielen könnte, schweren Herzens auf die U-20-Weltmeisterschaft in Nigeria verzichten. Sein Verein braucht ihn im Abstiegskampf. Er kann sich mit dieser Entscheidung überhaupt nicht anfreunden, aber jetzt ist er Profi. Plötzlich hat Deisler nichts Geringeres zu vollbringen, als die Borussia, einen der traditionsreichsten Vereine überhaupt, vor dem Abstieg zu bewahren. Da ist er gerade einmal 19 Jahre alt. Ansonsten aber ist die Welt in Ordnung, sieht man davon ab, dass seine Bemühungen, von Gladbach aus den Zwist seiner Eltern austarieren zu wollen, fehlschlägt. Dabei wünscht er sich so sehr, dass seine Eltern wieder zueinander finden. Natürlich denkt er dabei auch an sich, sehnt er sich doch nach einem Korrektiv, nach einer Familie, einem sozialen Netz, das ihm Halt bietet in all dem Trubel, der jetzt um ihn veranstaltet wird. Das alles wird sich für ihn nicht erfüllen, im Gegenteil, denn die Mutter verlässt schließlich die Wohnung, die Deisler seinen Eltern geschenkt hatte. Der Vater wiederum verkraftet den Aufstieg seines Sohnes noch weniger als sein Sprössling selbst. Sebastian beginnt nun auch noch, die Sorgen und Probleme der Eltern zu schultern. Dabei hätte er wohl eher von ihnen Hilfe, Halt und Unterstützung gebraucht, um dem Rummel etwas entgegensetzen zu können. »Manchmal kann einem das alles schon Angst machen«, teilt Deisler im Sommer 1999 der Welt am Sonntag mit. Er erzählt, dass er im vergangenen Sommer noch überlegt habe, ob »ich überhaupt den Sprung von der Jugend zu den Amateuren schaffe«. Eigentlich sollte Deisler in Mönchengladbach noch mindestens ein Jahr im Amateurteam Spielpraxis sammeln. Auf das offizielle Mannschaftsposter der Profis durfte er im Sommer 1998 nur, weil man dem Jungen zeigen wollte, dass er dazu gehört.
Den Abstieg der Mönchengladbacher verhindern kann Deisler nicht. Genauso wenig wie Robert Enke, Michael Frontzeck, Patrik Andersson, Peter Wynhoff, Toni Polster oder Marcel Witeczek. Nach 34 Jahren verlässt die Borussia erstmals die Bundesliga. Deislers Berater Norbert Pflippen drängt zu einem Wechsel. Wechsel sind gut, denn sie bedeuten neue Verträge, und neue Verträge bringen Geld, viel Geld. Nicht nur für den Spieler. Auch in dieser Hinsicht bietet der junge Deisler inzwischen ein enormes Potenzial. Im Frühjahr 1999 ist er einer der gefragtesten deutschen Jungprofis, europaweit. Für Pflippen steht ein Abschied vom Bökelberg längst fest. »In der Zweiten Liga lasse ich mir den Jungen nicht kaputttreten«, posaunt Pflippen bereits im März 1999 (Stuttgarter Zeitung). Ein Großteil der Bundesligaelite, darunter der FC Bayern, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, wird vorstellig. Selbst Vereine von internationalem Renommee wie der FC Barcelona, Real Madrid und der AC Mailand buhlen um die Dienste Sebastian Deislers. Insgesamt liegen Pflippen 26 (!) Angebote vor, davon mindestens 15 ernsthafte und hoch dotierte. Der Züricher Sport schreibt im Mai von einer »Hysterie um ein Jahrhunderttalent«. Mittlerweile ist auch der Teamchef der deutschen Nationalmannschaft aufmerksam geworden. »Deisler ist ein Juwel. Er setzt spielerische Akzente und geht über die Schmerzgrenze hinaus. Solche Spieler brauchen wir. Sein Debüt im A-Kader ist nicht mehr fern«, sagt Erich Ribbeck der Süddeutschen Zeitung.
Zuvor aber wird der Vereinswechsel über die Bühne gebracht, einer, der nicht ohne Folgen bleibt. Herthas Manager Dieter Hoeneß, der Bruder von Uli Hoeneß, bietet alles auf, was er hat, und wohl auch etwas mehr – von einer sehr großen Summe als Überredungshilfe an Pflippen ist später die Rede. Dieter Hoeneß sieht seinen Verein im Aufschwung, die Champions League ist in Reichweite, nun soll zudem personell groß in die Tasten gegriffen werden. Der Klub aus der deutschen Hauptstadt will endlich auch fußballerisch in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und wer böte sich dafür besser an als Deisler, der für die Zukunft des deutschen Fußballs steht? In der Szene ist bekannt, dass Borussia Dortmund gut im Rennen um das Jawort Deislers liegt. Der Champions-League-Sieger von 1997 lockt Deisler mit der Trikotnummer 10, die im Fußball eine Art Ritterschlag bedeutet und die in Dortmund Andreas Möller jahrelang getragen hatte. Und natürlich sind da auch die Bayern, die meistens kriegen, wen sie wollen, schließlich hat Ottmar Hitzfeld, der Trainer des »FC Ruhmreich«, auch schon auf dem Sofa bei Kilian Deisler gesessen. Obendrein liegt Jupp Heynckes Bayern-Manager Uli Hoeneß in den Ohren: Der Deisler sei in zwei Jahren 20 Millionen wert. Aber vermutlich, so Pflippens Einschätzung, würde sein Mandant in München nicht gleich spielen können.
v. l.: Die Gladbacher Patrik Andersson,
Michael Frontzeck und Sebastian Deisler
stehen vor einem Freistoß um den Ball
© imago / Uwe Kraft
Sebastian als Regisseur
© imago / Uwe Kraft
Als Pflippen mit Deisler nach Berlin reist, um Herthas Angebot genauer zu prüfen, ist Dieter Hoeneß ordentlich vorbereitet. Er hat sich umgehört in Deislers Vergangenheit, weiß – wenn auch nur vage – um das zaudernde, bisweilen sensible Befinden des Jungstars. Hoeneß holt die beiden vom Flughafen ab und unternimmt erst einmal eine ausgedehnte Stadtrundfahrt. Aber er zeigt dem umworbenen Jungen vom badischen Land nicht die neue Mitte der Metropole, sondern kutschiert ihn vier Stunden lang durch den Wald. »Nur durchs Grüne«, wie Pflippen später der Berliner Zeitung erzählt. »Da habe ich nachher zum Hoeneß gesagt: Also, nicht dass der jetzt Förster werden will.«
Der Ausflug verfehlt seine Wirkung nicht. Noch am selben Tag setzt sich Deisler mit Herthas Trainer Jürgen Röber zusammen. Röbers Stärke ist, dass er keine große Distanz aufkommen lässt, er wirkt kumpelhaft und dabei authentisch – beide finden schnell einen Draht zueinander. Auf dem Rückflug macht Pflippen sich so seine Gedanken. Die Stadt könne seinem Mandanten gefallen, und irgendwie passt es ja: »Berlin wächst, die Stadt ist noch lange nicht da, wo sie hin soll. Wie der Basti.« Über das »hin soll« in seinem Denken stolpert er nicht.
Sebastian entscheidet sich schließlich für den Wechsel nach Berlin, wo er sich insgeheim auch ein wenig die Anonymität in der Großstadt erhofft. Am 10. Mai 1999 verkündet der Hauptstadtklub Deislers Verpflichtung. Der neue Dreijahresvertrag, den er unterschreibt, macht ihn zum Einkommensmillionär, aber das ist nicht ausschlaggebend, woanders hätte er locker das Doppelte kriegen können. Deisler ist von der Richtigkeit seines Schrittes auf dem von Pflippen vorgesehenen Weg überzeugt. Da er in Gladbach noch einen Vertrag bis 2001 besitzt, wird eine Ablösesumme fällig, die bei rund vier Millionen Mark liegt. Es ist die höchste Summe in der Geschichte der Bundesliga, die bis dato für einen 19-Jährigen bezahlt worden ist.
In jenen Septembertagen des Jahres 2007 treffe ich einen Sebastian Deisler, der mit seiner Vergangenheit nicht im Reinen ist und mit seiner Gegenwart noch nicht viel anzufangen weiß. Von seiner Zukunft einmal ganz zu schweigen. Vor allem die Gegenwart, der ganz normale Tag, der Alltag, macht ihm zu schaffen. Er bekomme keine Ruhe rein, sei voller Bitterkeit und Wehmut. Immer wieder hadert er mit sich: Ach, hätte es nicht anders kommen können? Manches Mal wirkt er, als zwinge ihn die Vergangenheit, die mit dem Ausstieg eigentlich abgeschlossen sein sollte, noch heute in die Knie, als erdrücke ihn die Last vergangener Tage noch immer. Das selbstbestimmbare Jetzt … er kann es nicht gestalten. Er habe gehofft, dass er mit dem Ausstieg sein altes, sein gutes altes Leben, sein gutes altes Ich zurückbekommen würde. Aber was war das gute alte Leben? Wo war der Bruch in seiner Entwicklung? Seit er 15 war, war es das Leben eines Heranwachsenden. Die Jahre des Erwachsenwerdens, des Ausreifens seiner Persönlichkeit waren gesäumt von ungewöhnlichen Begleitumständen. Für einen Außenstehenden wie mich zwingt sich der Eindruck auf, dass er sich in einer Art übergeordnetem emotionalen Dilemma befindet: Er wirkt, als habe er sich noch nicht entschieden, ob er froh darüber sein soll, den Ausstieg gefunden zu haben, oder traurig.
Sebastian lebt streng zurückgezogen. Am öffentlichen Leben nimmt er so gut wie nicht teil. Morgens geht er, wenn er sich halbwegs fühlt, zum Bäcker um die Ecke und holt sich einen Kaffee. Wenn ihn der Hunger treibt, ruft er den Lieferservice, zwischendurch erledigt er ein paar Besorgungen. Das war’s aber auch schon. Sebastian Deisler macht einen unglücklichen Eindruck. Er meidet Kontakte zu anderen Menschen, hat Angst vor Gesellschaft. Seine als Profi erlebte Wirklichkeit kommt erschwerend hinzu. Soziale Kontakte empfindet er als Bedrängnis – so etwas nennt man wohl Sozialphobie. Ihm falle es schwer zu unterscheiden, was für ihn vertretbar sei und was zu viel. Im Zweifelsfall ist schon das wenigste zu viel. Ab und an trifft er einen seiner Freunde, bevor er sich wieder für Wochen entzieht, sogar Monate. Deislers Zustand ist nicht besonders gut in diesem Herbst. Er steht in ärztlichem Kontakt und kommt gerade so über die Runden, scheint mir. Vielleicht reden wir ein bisschen, schlage ich vor. Sebastian nickt, und wir fahren zu seiner Wohnung.
»Ich brauche noch Zeit«, sagt er. Zeit ist ein zentrales Wort in seinem jetzigen Leben. »Was bedeutet es, Zeit zu brauchen, und was, Zeit zu haben?«, murmelt er. Der Fußball habe ihm eine finanzielle Unabhängigkeit verschafft, die es ihm ermöglichte, mit 27 den Job zu schmeißen, ohne eine Alternative zu haben. Die Beine könne er hochlegen, aber das mache in seinem Alter weniger Spaß, als mancher sich so denke. Wie sich doch die Zeiten verändert hätten, und wie sie ihn erst verändert hätten, sinniert er. Als er noch Profi war, glaubte er keine einzige freie private Minute zu besitzen. »Heute hat mancher Tag 30 Stunden – bis zum Nachmittag! Und dann?« Er finde seit Wochen, seit Monaten keine Antworten. Ich frage ihn, was er machen würde, wenn er gezwungen wäre, für seinen Unterhalt zu sorgen. Er steht auf und läuft umher. »Richtig, ich muss kein Geld verdienen im Moment. Das ist die einzige Sorge, die ich nicht habe, das weiß ich. Und dafür bin ich dankbar. Ich hatte ein großes Glück mit meinem Talent, aber ich habe ordentlich Schmerzensgeld bezahlt. Ich habe ja fast alles andere verloren.«
Sebastian wirkt ungnädig mit sich selbst und in seinem Schicksal versunken. Ich entgegne, dass auch andere Menschen aus ihren Träumen und Wünschen gerissen würden, etwa wenn sie Familienmitglieder auf tragische Weise verlören oder sich plötzlich selbst im Rollstuhl wiederfänden. Diese Menschen müssten wieder einen neuen Ansatz finden, auch weil es finanziell gar nicht anders ginge. »Ich weiß«, sagt er leise. »Ich bin noch so voll mit dem Alten. Vielleicht hört sich vieles nach Luxusproblemen an, nicht wahr?« Er macht eine kleine Pause und fährt fort: »Das, was ich hier mache, wünsche ich niemanden. Ich versuche, mich freizustrampeln von meiner Vergangenheit. Ich habe das aufgeben müssen, was ich seit meinem fünften Lebensjahr gemacht habe. Fußball war mein Lebensinhalt. Jetzt muss ich mich zwingen, davon Abstand zu gewinnen. Wenn man so will, habe ich meinen bisherigen Lebensinhalt verloren und obendrein noch meine Familie. Ich muss raus aus der Sonderrolle und aus meiner Zurückgezogenheit. Aber das ist gar nicht so einfach, das gebe ich zu, das hat auch was mit Eitelkeit zu tun.« Mit Eitelkeit? »Ich weiß, dass das Thema Fußball für mich vorbei ist. Ich habe ihm lange nachgetrauert. Schon als ich noch dabei war. Ich habe daran festgehalten, weil es das war, was ich liebte und konnte. Das Fußballspiel an sich, das, was daran so schön ist und Spaß und Freude bereitet, dem habe ich nachgehangen. Und ich mache es wohl immer noch. Innerlich lande ich immer wieder in meinem Dreck und am selben Punkt. Das zieht mich dann runter, denn ich weiß, ich werde nie mehr etwas so gut können.« Was aber habe das ausgerechnet mit Eitelkeit zu tun? Er unterbricht und verbessert mich. »Mit dummer Eitelkeit«, sagt er und erklärt: »Dumm, weil ich da oben war und niemanden an mich rangelassen habe. Dabei hatte ich kein Fundament. Selbst später, als ich in Berlin war und alles um mich rum noch mehr durchdrehte, unterschätzte ich die Wirkung auf mich.« Damals habe er stundenlange Telefonate mit seiner Mutter geführt. Er habe ihr erzählt, dass er in der Hauptstadt bekannt sei wie ein bunter Hund, dass er sich aber nicht zu Hause fühle, ihm das alles zu viel werde. Seine Mutter habe ihm geraten, er möge sich Hilfe nehmen, solle sich in professionelle Hände begeben. »Das habe ich leider nicht gemacht, ich wollte das nicht. Ich wollte mir nicht helfen lassen. Ich hatte Angst davor, dass die Presse davon erfährt. Dann hätte es geheißen: Seht her, der Deisler aus Lörrach packt es nicht. Da war er wieder, mein blöder Komplex, dass ich keine Schwäche zeigen wollte. Nein, dann lieber: Ich allein gegen alle. Ich habe geglaubt, ich packe das. Bis ich mir selber nicht mehr anders zu helfen wusste, als aufzuhören. Ja, darunter leide ich. Manches mal schäme ich mich.«
Sebastian ist von der Couch nach unten auf den Fußboden gerutscht. Er hat seine Beine angewinkelt, stützt die Stirn mit seiner Hand. »Ganz schlimm ist, dass ich nicht weiß, was ich den Leuten sagen soll, die mich draußen ansprechen und fragen. Was soll ich ihnen sagen, wenn sie mich fragen, was ich heute so mache?« »Was machst du so?« »Was ich so mache?«, fragt er gereizt zurück. »Seit Monaten versuche ich, mich freizuschaufeln. Ich wollte mich damals nicht mehr bewegen. Das muss man sich mal vorstellen, ich, der nie still sitzen konnte als Kind. Ich, der auf dem Fußballfeld immer rannte. Mein Bewegungsdrang hätte für zwei Spiele hintereinander gereicht. Ich habe immer alles gegeben, alles, was ich hatte. Am Ende habe ich eingesehen, dass es nichts mehr bringt. Das konnte ich mir und der Bayern-Mannschaft nicht mehr antun. Damals hatte ich nichts mehr zu geben, es hatte mich alles krank gemacht. Ich war voller Schmerz. Oft bin ich im Nichts eingeschlafen. Was ich hier mache, willst du wissen? Das ist harte Arbeit. Ich will meine Geschichte auflösen. Ich möchte das für mich klären, um langsam wieder losgehen und irgendwann mal wieder etwas geben zu können. Ich möchte wieder so werden, wie ich war. Ich möchte gesund werden.«
Zum Abschluss meines Besuchs frage ich ihn, wann er das letzte Mal glücklich war. »Was gehört zum Menschsein dazu, was macht uns glücklich, was hält einen am Boden? Was bedeutet Glück, was ist Glück?«. Er antwortet mit Fragen. Dann sagt er: »Es ist lange her, dass ich glücklich war – glaube ich.«